|
Betriebseinsatz |
|||
| Navigation durch das Thema |
|
||
|
Wir haben die kleinen
Lokomotiven
aufgebaut, erfahren, dass sie an den Betrieb angepasst wurden und nun
wollen wir diesen ansehen. Bei der Beschaffung musste gespart werden und
so entstand eine Maschine, die kaum für mehr als den Betrieb im
Rangierdienst
geeignet war. Dennoch sollten diese beiden Lokomotiven zu einer grossen
Bekanntheit gelangen. Daher erwartet uns nun ein spannendes Kapitel mit
dem Leben der Baureihe AI.
Es sollte aber in wenigen Monaten der Fall
sein. Jedoch war das Problem noch grösser, als wir vermuten, denn das Ziel
war der Kanton Tessin, denn dort sollten die
Testfahrten
durchgeführt werden. So mussten die beiden Lokomotiven an den geplanten Ort gelangen und das war nicht einfach. Eine Bahnlinie gab es schlicht nicht und daher hatten diese beiden Exemplare womöglich den längsten Lieferweg, der eine in der Schweiz für die Schweiz gebaute Lokomotive haben kann. Das begann bereits im Werk, wo die fertigen
Maschinen wieder zerlegt werden mussten. Als ganze
Lokomotive
war der Transport schlicht nicht möglich. Die beiden zerlegten Lokomotiven wurden dabei mit der Hilfe der vorhandenen Bahnen von Winterthur nach Basel überführt. Am Ziel erfolgte der Umlad auf ein
Binnenschiff, das die Fracht nach Rotterdam brachte, wo dann ein neues
Schiff benutzt werden musste. Dieses brachte die Fracht schliesslich um
den Kontinent nach dem Hafen von Genau und so nach Italien, wo es damals
noch nicht so viele Bahnen gab. Für die weitere Reise wurden daher Fuhrwerke
verwendet. Diese benötigten mehrere Tage, bis sie das Ziel in Airolo
erreichten. Sie haben richtig gelesen, geliefert wurden die Maschinen
nicht nach Bellinzona, wo die Tessiner Talbahnen bereits in Betrieb waren.
Es ging in den alpinen Bereich, wo gar noch nicht gefahren werden konnte.
Somit haben wir einen Transport erhalten, der mehrere Monate benötigte.
Damit endete die Lieferung und die
Inbetrieb-setzung
konnte erfolgen. Dazu wurden einfach die bereits vorhandenen Anlagen
benutzt. Wobei der zukünftige
Bahnhof
wohl kaum verlassen wurde. Bei den meisten Bahnen, so auch bei der Gott-hardbahn, ist wenig von den Fahrten vor der Be-triebseröffnung die bekannt. Jedoch mussten so-wohl die Strecke, als auch die Fahrzeuge vor dem Einsatz geprobt werden. Dazu musste man auch das Personal schulen und
das ging nun mal mit Fahrten besser, als nur in der Theorie. Daher kann
man davon ausgehen, dass bereits ein halbes Jahr vor der Eröffnung die
ersten
Lokomotiven
auf der Strecke fuhren. Die so in Airolo abgelieferten Lokomotiven wurden im dortigen Bahnhof in Betrieb genommen. Obwohl dort kein eigentliches Depot vorhanden war, muss-te man mit den Schulungen für das Personal begin-nen. Schliesslich musste dieses wissen, wie die
beiden Maschinen zu bedienen sind, wenn der Verkehr auf der Strecke
startet. Man hatte dazu noch ein paar Monate Zeit, wenn auch nicht so
lange, wie man meinte. Um zu verhindern, dass die neuen
Lokomotiven
einfach ohne Arbeit da standen, wurden die beiden Maschinen nach den
Schulungen und Erprobungen in Betrieb genommen. Sie konnten dabei durchaus
genutzt werden um die anderen sich dort befindlichen Fahrzeuge zu
formieren. So kamen die beiden Lokomotiven auch vor den auf den fertigen
Anlagen verkehrenden
Arbeitszügen
zum Einsatz. Diese gab es, auch wenn nicht viel davon bekannt ist.
Dennoch wollte man den neuen
Tunnel
nutzen, denn dieser war ja der grösste Vorteil der neuen Strecke durch die
Alpen. Nur war das nicht so leicht, wie es den Anschein machen könnte,
denn es fehlte das
Roll-material. Gerade der anstehende Winter war die treibende Kraft. Die Transporte über den Pass waren immer wieder Unterbrochen, weil die Lawinen ein Durchkommen verhinderten. Jedoch gab es nur die zwei Balancier, denn
die anderen Maschinen der
Gotthardbahn wurden weder nach Airolo, noch nach Göschenen
ge-liefert. Es musste eine Lösung gefunden werden und da auch kaum Wagen
vorhanden waren, gab es nicht viele. Mit der Post wurde daher ein Abkommen getroffen. Diese bot bisher über den Pass ein Verkehr mit Personen, aber auch mit der eigentlichen Post an. Da Personen jedoch erst nach den behördlichen
Abnahmen befördert werden durften, schieden diese aus. Aber die Briefe und
Pakete, die im Winter kaum den Weg über den Pass schafften, waren eine
andere Sache. zudem waren die Züge für die beiden kleinen
Lokomotiven
ideal. Die beiden A I, die mit den Betriebsnummern
11 und 12 versehen wurden, konnten schliesslich ab dem 01. Januar 1882 den
Gotthardtunnel
in eigener Kraft befahren. Sie hatten ihren ersten Einsatz auf der
Strecke. Noch gab es auf der neuen
Bahnlinie
keine Arbeit für
Rangierlokomotiven,
also setzte man sie dort ein, wo man sie brauchten konnte und das war
durchaus an einem Ort, wo man sie eigentlich nie vermutet hätte.
So kam es, dass die Post das Privileg hatte,
vor der offiziellen Eröffnung durch den
Tunnel
zu fahren. Ein Privileg, das nur möglich war, weil dieser Teil staatlich
geregelt war uns es von dort keine Hin-dernisse gab. Mit dem einzelnen
Postwagen
hatte die
Lokomotive
im flachen
Scheiteltunnel keine grosse Mühe. Anders wäre wohl die Fahrt über die
Bergstrecke
gewesen, aber diese war noch nicht befahrbar. So wurde die Post in Airolo
und Göschenen umgeladen und wieder mit den Kutschen befördert. Die
Lokomotiven der Reihe A I waren schliesslich auch nicht für die
Bergstrecke gebaut worden. Gerade die geringe
Leistung
war hinderlich. Es sollte nicht lange dauern, bis auch die
Reisenden der Postkutschen den Weg durch den neuen
Gotthardtunnel
nehmen durften. So mussten auch diese nicht mehr den beschwerlichen Weg
über den verschneiten Pass nehmen. Die Schlitten der Reisepost hatten
damit ausgedient und auch die übliche Kutsche sollte ab dem Frühjahr nicht
mehr eingesetzt werden. Es ging nun etwas schneller durch den neuen
Tunnel. Der Betrieb im
Gotthardtunnel
zeigte jedoch, dass das
Führerhaus
zu offen gebaut wurde. Die sehr offene auf den
Rangierdienst
ausgelegte Konstruktion war ein grosses Problem. Der Rauch aus dem
Kamin
wurde im
Tunnel
in das Führerhaus gedrückt und behinderte so das Personal auf der
Lokomotive.
So wurde die
Front
schnell verschlossen und neu zwei Fenster vorgesehen. Das Führerhaus war
also der erste umgebaute Bereich.
Als die
Gotthardbahn am 01. Juni 1882 auf der ganzen Länge eröffnet werden
konnte, endete der Einsatz im
Tunnel,
denn nun standen die dazu vorge-sehenen
Lokomotiven
zur Verfügung und der Verkehr nahm zu. Daher kamen die kleinen Lokomotiven, wie ursprünglich auch geplant, in den Rangierdienst. Zusammen mit den Maschinen A von den Tessiner Talbahnen und einer von der Tösstalbahn gekauften Lokomotive, hatte die Gotthardbahn bei der Eröffnung insgesamt sieben Rangierlokomotiven zur Verfügung. Neu waren also nur die beiden hier
vorgestellten Modelle der Reihe AI und das Geld konnte in grosse Modelle
investiert werden. Eingesetzt wurden diese sieben Lokomotiven an den grössten Standorten. Das waren die Bahnhöfe Arth-Goldau, Bellinzona und Chiasso. Dazu kamen auch andere Bahnhöfe wie Altdorf oder Erstfeld. Die Maschinen kamen daher nur noch selten auf
den Strecken zum Einsatz, so dass sie schnell ergänzt werden mussten. Der
Bestand war daher ausge-sprochen knapp bemessen worden, was angesichts der
finanziellen Lage nicht verwundert. Gerade die ersten Monate nach der
Betriebseröffnung am 01. Juni 1882 zeigten deutlich, dass man sich bei den
Prognosen für das Verkehrsaufkommen verschätzt hatte. Die Zeit der ersten
Betriebsjahre sollten auch als Sturm- und Drangjahre bezeichnet werden.
Die vorhandenen
Lokomotiven
waren daher von der ersten Stunde an sehr gut ausgelastet, das galt auch
für die
Rangierlokomotiven,
die sich nicht über mangelnde Arbeit beklagen konnten.
Bei mehreren Wagen hatte die Lokomotive bei schlechtem Wetter Mühe, die Last zu ziehen und die Wagen zu beschleunigen. Zu schnell drehten die
Räder
der leichten
Lokomo-tive
durch. Bei einer maximalen
Achslast
von le-diglich 7,5 Tonnen war das auch nicht weiter ver-wunderlich. So beschloss man bei der Gotthardbahn nach kurzer Zeit, dass zumindest die hintere Triebachse mit einem Sander nachgerüstet werden soll. Dabei kam es auch gleich zur Montage der bisher fehlenden Schienenräumer. Die
Lokomotive
war nun eigentlich komplett auf-gebaut worden und konnte so etwas besser
ar-beiten. Besonders der
Sander
spürte man im
Rangierdienst
gut. Die
Schienenräumer
schützten lediglich das
Laufwerk
vor im
Gleis
liegenden Gegenständen. Durch den stetig steigenden Verkehr am
Gotthard waren die
Lokomotiven
AI schnell sehr gut ausgelastet und mussten sich im
Rangierdienst
mächtig ins Zeug legen um die übertragenen Aufgaben ausführen zu können.
Entlastung gab es nur spärlich, da das verdiente Geld an anderen Stellen
dringender benötigt wurde und so nur sehr wenige neue
Rangierlokomotiven
beschafft wurden. Trotzdem stieg der Bestand an geeigneten Lokomotiven ein
wenig an. Auch hier muss erwähnt werden, dass es schwer
ist, betriebliche Besonderheiten bei einer
Rangierlokomotive
zu finden. Über solche
Lokomotiven
wird generell wenig berichtet und die
Gotthardbahn kannte hier keine starren Zuordnungen, wie es die
schweizerischen Bundesbahnen SBB später hatten. All das war aber normal
und somit keine Besonderheit der Gotthardbahn. Rangierlokomotiven blieben
daher immer etwas aussen vor und so ist über die ersten Jahre wenig
bekannt.
Nur konnte man damals nicht erwarten, dass
die Aufgaben im
Rangierdienst
der
Bahnhöfe
so um-fangreich werden sollte. Trotzdem wurden die schwachen Modelle wohl
eher bei geringer Aus-lastung verwendet. Der Betrieb auf der Gotthardbahn zeigte deutlich, wie mühsam ein Betrieb ohne durchgehende Brems-leitung und damit ohne durchgehende Bremse war. Selbst bei den
Reisezügen
musste eine grosse An-zahl
Bremser
verwendet werden. Diese hatten je-doch wegen den vielen langen
Tunneln
immer wie-der Probleme mit der Atmung. Kranke Mitarbeiter waren auch bei
der
Gotthardbahn nicht gewünscht, besonders dann nicht, wenn sie
verantwortlich war. Es musste eine Lösung für das Problem
gefunden werden. Angepackt wurde das auf der personellen Seite, wo neue
als
Milchküche
bezeichnete Räume zur Linderung der gereizten Atemwege geschaffen wurden.
Technisch wollte man bei der
Gotthardbahn aber auch zu einem besseren Schutz der Züge beitragen
und da war es nur logisch, wenn die
Bremsen
direkt von der
Lokomotive
aus bedient werden konnten. So starteten bereits im Jahre 1886 die ersten
Versuche mit einer durchgehenden Luftbremse. Dabei begann man vorerst bei
den
Reisezügen
mit der Verwendung einer
Vakuumbremse.
Die Vorteile der Vakuumbremse sind heute hinlänglich bekannt, aber es gab
auch grosse Nachteile, die nicht zu vernachlässigen sind. Insbesondere
konnten die
Reisezugwagen
nicht ohne angeschlossene
Bremse
rangiert werden.
Die Maschinen AI wurden so in den Versuch mit
der
Vakuumbremse
eingebunden. Das war jedoch eher eine technische Notwenigkeit, als ein
Wunsch des Betriebes. Mit dem im Jahre 1887 eingeführten neuen einheitlichen System für die Bezeichnung von Lokomotiven, wurden auch die Maschinen der Gotthardbahn neu bezeichnet. Die bisher als AI bezeichneten beiden Rangierlokomotiven wurden nun als F2 geführt. Damit war aber klar, dass die kleinen
Maschinen nicht mehr auf der
Bahnlinie
eingesetzt werden sollten. Seit den Fahrten im
Gotthardtunnel
waren diese so oder so selten. Da die beiden kleinen Lokomotiven mit ihren 75 PS kaum mehr dazu taugten, die schweren Wagen des Güterverkehrs zu bewegen, wurden sie vermehrt dort eingesetzt, wo es Reise-zugwagen zu verschieben gab. Das war letztlich auch der Grund, warum sie
mit der
Vakuumbremse
versehen wurden. Einsätze auf der Strecke mit solchen Wagen waren jedoch
nicht vorgesehen, denn dort wurde schneller gefahren und ein Zug war zu
schwer. Die
Betriebsführung
der
Gotthardbahn konnte mit den
Lokomotiven
oft gnadenlos sein. Was vorhanden war, musste etwelche Arbeit übernehmen.
Wenn die Maschine nicht passte, wurde sie einfach passend gemacht und da
waren die beiden F2 keine Ausnahme. Problem war, dass die Balancier den
Rangierdienst
mit
Personenwagen
übernommen hatten und diese kühlten im Winter während längeren Pausen sehr
stark aus.
Der kleine
Kessel
war daher gut ausgelastet, denn oft sollte die
Rangierlokomotive
dabei auch noch fahren. Jedoch gilt zu sagen, dass der Kessel durchaus
noch Reserven hatte, die man nun nutzte. Der Versuch mit der Vakuumbremse wurde bereits 1888 wieder eingestellt. Die Gotthardbahn sah in dieser Bremse keine geeignete Lösung. Die in Amerika verwendete Lösung schien
besser zu sein und daher sollte diese
Druckluftbremse
erprobt werden. Die beiden F2 wurden deshalb von der
Vakuumbremse
befreit und verkehrten in der Folge wieder für kurze Zeit ohne Luftbremse.
Schliesslich hatte sie immer noch den
Exterhebel. Nicht nachgerüstet werden sollte die Westinghousebremse. Bei dieser konnten die Druckluftbremsen der Wagen ausgelöst werden und so wurde wieder ohne Bremse an den Wagen rangiert. Sämtliche
Rangierlokomotiven
der
Gotthardbahn bremsten wieder mit der mechanischen
Bremse.
Bei den beiden F2 war daher die Bedienung immer noch sehr einfach, was
sicherlich im Interesse des Betreibers war, der nicht mehr sparen musste. Als die
Bremse
nach
Westinghouse
bei der
Gotthardbahn und bei vielen anderen Bahnen in Europa eingeführt
wurde, kam es zu weiteren Umrüstungen. Dabei gerieten die kleinen
Maschinen auch in den Fokus. Gerade mit schweren
Kompositionen
bekundeten die
Rangierlokomotiven
immer wieder Mühe mit den
Bremsweg.
Daher war es sinnvoll, wenn man die Wagen auch bremsen würde. Erneut ging
es daher in die Werkstatt.
Im Führerhaus wurde noch das Führer-bremsventil vorgesehen. Mehr war je-doch nicht mehr, denn die Lokomotive selber sollte weiterhin nur mit dem Exterhebel gebremst werden. Doch bei schweren Aufgaben, konnten zur
Unterstützung auch die
Bremsen
der Wagen beigezogen werden. All diese Massnahmen sollten aber nicht gut sein. Der kleine Kessel war nun mit den Dampfmaschinen, der Dampfheizung und der Luftpumpe überfordert. Die beiden Maschinen F2 waren nach nur
wenigen Jahren zu schwach für den
Rangierdienst
geworden. Das bemerkte die Nummer 12 recht früh, denn ab dem Jahr 1889 war
sie der
Hauptwerkstätte
in Bellinzona zugeteilt worden. Dort musste sie nur einzelne
Lokomotiven
verschieben. Nach nur sieben Jahren im Einsatz war sie
einfach ihren Aufgaben nicht mehr gewachsen. Dabei war das Problem nicht
bei der
Lokomotive
zu suchen. Der
Kessel
machte alle Ergänzungen mit und konnte ausreichend Dampf erzeugen. Jedoch
entsprach der Verkehr längst nicht mehr dem Volumen, das man um 1879 noch
erwartet hatte. Mit einer
Leistung
von 75 PS reichte die
Dampfmaschine
schlicht nicht mehr aus. Die bisher von der Nummer 12 ausgeführten
Aufgaben wurden von einer Maschine der ehemaligen Tessiner Talbahnen
übernommen. Diese Modelle konnten frei gestellt werden, weil bei der
Gotthardbahn neue dreiachsige
Rangierlokomotiven
in Betrieb genommen wurden. Diese als F3 bezeichneten Maschinen hatten
deutlich mehr
Zugkraft
und konnten daher auch das mittelschwere
Manöver
ohne grosse Probleme übernehmen.
Die relativ neue
Tenderlokomotive
war ihren Aufgaben einfach nicht mehr gewachsen. Das Direktorium der
Gotthardbahn sah deren Nutzen nur noch in der Tatsache, dass man
eventuell einen Käufer dafür finden könnte. Sie stand zum Verkauf an. Als Käufer für die Lokomotive zeigte sich die Firma von Roll Eisenwerke. Sie konnte die kleine Maschine für den Werksverkehr in ihren Eisenwerken gut gebrauchen. Man nutzte daher die Gunst der Stunde und kaufte der Gotthardbahn diese relativ neuwertige und günstige Lokomotive ab. Dieser Handel sollte der Nummer 11 ein langes
Leben be-scheren, denn sie wurde nie abgebrochen. Doch immer wieder stand
ein neues Werk an. Die Nummer 12 konnte sich noch ein paar Jahre in der Hauptwerkstätte halten. Jedoch kam sie da auch immer mehr unter Druck. Die
Modelle der Tessiner Talbahnen drängten nun in diesen Bereich. Sie hatten
den Kampf gegen die neuen
Rangierlokomotiven
mit drei
Triebachses
verloren. Der
Rangierdienst
war nun auf die Reihe F3 umgestellt
worden, denn diese waren deutlich leistungsfähiger als die alten Modelle. Auch
wenn die Nummer 12 nicht abgebrochen wurde, sie hörte als
Lokomotive
auf zu existieren. Der
Kessel
und die
Dampfmaschinen
wurden in der
Hauptwerkstätte
für den Antrieb der Transmission benötigt. So konnten sich diese Reste
noch so lange halten, dass deren Abbruch letztlich von den Schweizerischen
Bundesbahnen SBB verfügt wurde. Mit den letzten Resten verschwand die
Nummer 12 im Jahre 1912 endgültig.
Man
wusste, dass man mehr Maschinen für den
Ran-gierdienst
benötigte. Da die Kassen schlicht leer waren, suchte man nach einer
billigen Lösung. Die SLM lieferte das, was so noch möglich war und das war
dem Verkehr unterlegen. Die Gotthardbahn hatte in den ersten Betriebsjahren eine gewaltige Zunahme bei den Zügen des Güter-verkehrs erfahren. Für die schweren Züge mussten daher immer mehr Lokomotiven beschafft werden und dabei blieben die Modelle für den Rangierdienst etwas im Rückstand. Als
dort angepackt wurde, kamen neue dreiachsige Modelle mit mehr
Zugkraft.
Die ersten, die dann in der Hackfolge an den Schluss rückten, waren die
mit geringer
Leistung. Damit blieb von diesen beiden
Lokomotiven
nur noch ein Exemplar übrig. Nachdem sie von der
Gott-hardbahn verkauft wurde, wurde es um die Loko-motive
mit der ehemaligen Nummer 11 ruhig und mancher könnte meinen, dass die
Maschine auch dort zu schwach gewesen wäre, denn es war wirklich eine sehr
klein geratene
Tenderlokomotive,
wie das schnelle Ausscheiden aus dem Verkehr bei der Gotthardbahn erkennen
lässt. Doch das war nicht der Fall. Die verkaufte
Lokomotive
Nummer 11 machte sich im Werksverkehr der Von Roll gut, so dass sie die
Ausrangierungen
der alten Gotthardlokomotiven überlebte und der Nachwelt als einzige
Dampflokomotive der ehemaligen
Gotthardbahn erhalten blieb. Die Maschine kann im
Verkehrshaus der Schweiz besichtigt werden und zeigt den Vergleich zu den
anderen
Lokomotiven,
die vom Gotthard ins Museum kamen, recht deutlich auf.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
||
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2023 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Geliefert
wurden die beiden
Geliefert
wurden die beiden
 Als
die Teile in Airolo eingetroffen waren, wurden die beiden
Als
die Teile in Airolo eingetroffen waren, wurden die beiden
 Es
war nun auch zu erkennen, dass die Arbeiten im
Es
war nun auch zu erkennen, dass die Arbeiten im
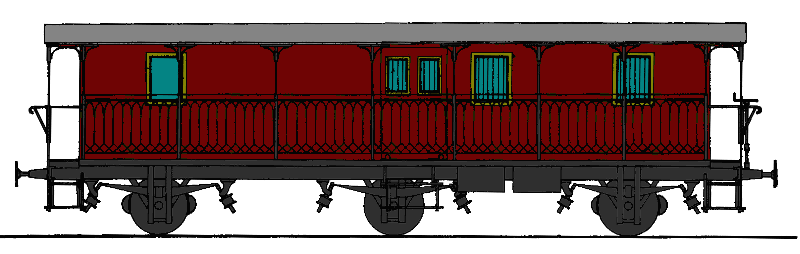 Ab
diesem Datum wurde die Post nicht mehr über den Pass, sondern provisorisch
durch den nun fertigen
Ab
diesem Datum wurde die Post nicht mehr über den Pass, sondern provisorisch
durch den nun fertigen
 Im
Im
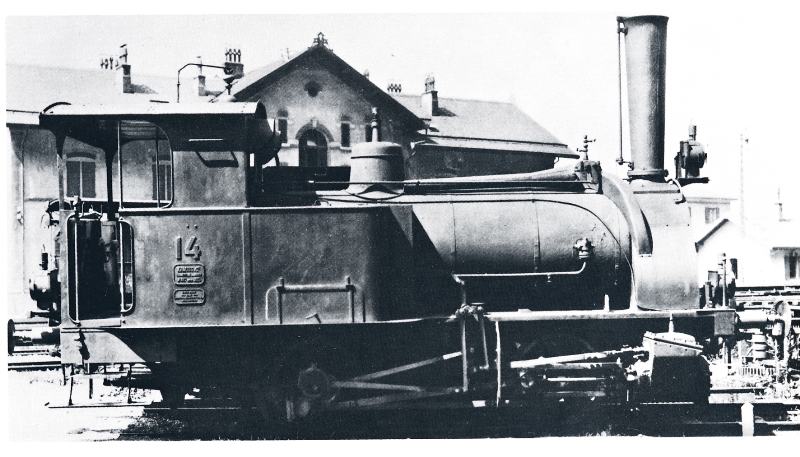 Der
Betrieb der beiden
Der
Betrieb der beiden
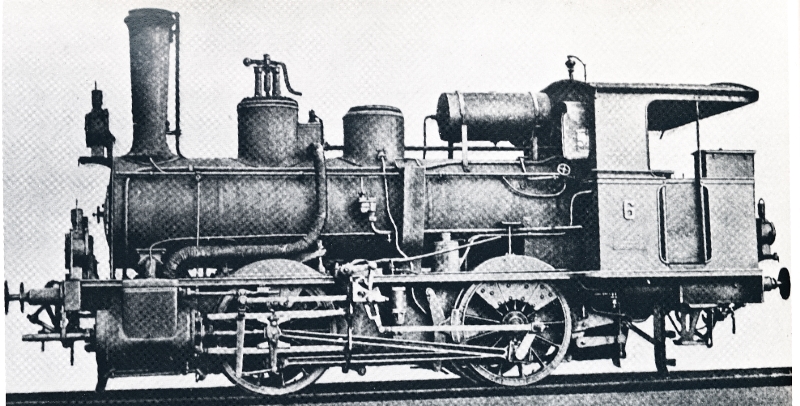 Jedoch
kann angenommen werden, dass die beiden mit nur geringer
Jedoch
kann angenommen werden, dass die beiden mit nur geringer
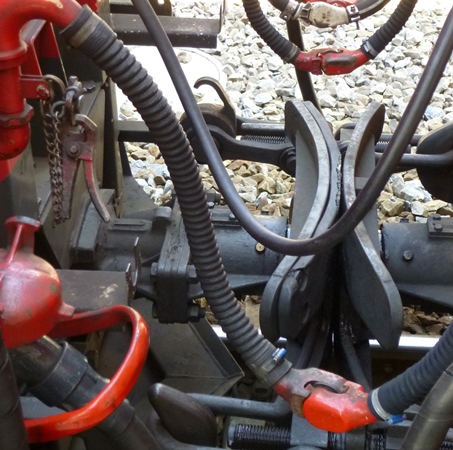 Damit
in den
Damit
in den
 Daher
beschloss die
Daher
beschloss die
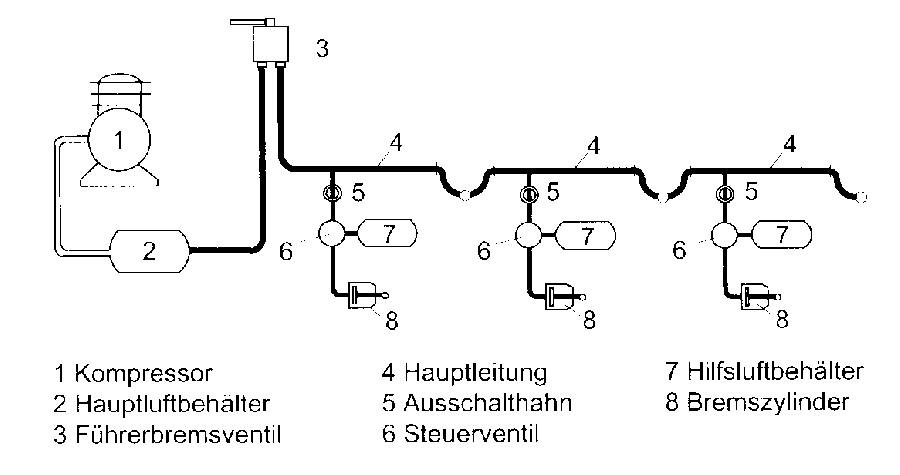 Dort
wurde die
Dort
wurde die
 So
überrascht es eigentlich wenig, dass die Nummer 11 bereits im folgenden
Jahr aus dem Betrieb genommen wurde. Nach nur acht Jahren Einsatz stand
die F2 zur
So
überrascht es eigentlich wenig, dass die Nummer 11 bereits im folgenden
Jahr aus dem Betrieb genommen wurde. Nach nur acht Jahren Einsatz stand
die F2 zur
 Nach
einem Einsatz von wenigen Jahren bei der
Nach
einem Einsatz von wenigen Jahren bei der