|
Umbauten und Änderungen |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Wenn wir hier zu den Umbauten und
Änderungen kommen, dann werden wir schnell erfahren, dass sich bei der
Baureihe BI die grössten Anpassungen ergaben. Der Grund war nicht, dass
die Maschinen schlecht waren, sondern die betrieblichen Bedürfnisse der
Gotthardbahngesellschaft.
Diese hatten oft Anpassungen zur Folge, die wir ansehen müssen. Bevor ich
damit beginne, noch ein paar Worte zur Reihe A2 und deren Veränderungen.
Das hatte zur Folge, dass die meisten Punkte bei der Inbetriebnahme im Jahre 1890 schon umgesetzt wurden und daher bereits bei Auslieferung einge-baut waren. Gutes Beispiel ist sicherlich die
Druckluftbremse
nach den Prinzip
Westinghouse,
die 1888 eingeführt wurde. In den ersten Jahren erfuhren die Lokomotiven der Reihe BI keine grösseren Anpassungen, das zeigt, dass sich die Maschinen bewährten und so nicht verändert wurden. Jedoch erfolgte nur fünf Jahre nach der
Betriebseröffnung bei der Bahn eine grosse Modernisierung. Diese war ab
dem Jahre 1887 eingeführt worden und betraf die hier vorgestellten
Lokomotiven. Dabei werden wir nun gleich das erste Problem lösen. 1887 wurden die Schemen für die Bezeichnung
neu gestaltet. Auf Grund dieser nationalen Lösung, mussten die Maschinen
der
Gotthardbahn
mit einer neuen Bezeichnung versehen werden. Aus der bisherigen Reihe BI
wurde nun die neue Baureihe A2. Die Betriebsnummern blieben indes gleich.
Auch wenn nun die Gefahr besteht, dass es zu Verwechslungen kommt, die
bisher erwähnte Reihe A2 war damals noch nicht vorhanden. Bei der
Gotthardbahngesellschaft
traten anfänglich immer wieder Überschreitungen bei den Geschwindigkeiten
auf. Diese konnten jedoch von der Obrigkeit nachträglich schwer
nachgewiesen werden. Zudem monierte das betroffene
Lokomotivpersonal
auch die fehlende Anzeige und so auch die Tatsache, dass das Tempo immer
berechnet werden musste. Rechenfehler konnten sich so ergeben, was für die
Züge jedoch sehr gefährlich war.
So konnte das Tempo genauer eingehalten
werden und die bisher vorkommenden Probleme wurden vermindert. Damit aber
die neue Disziplin weiterhin eingehalten wurde, war eine
Registrierung
vorhanden. Diese Registrierung zeichnete auf einem weissen Papier-streifen mit einem Stift die gefahrene Geschwindigkeit auf. Die Weisung an das Lokomotivpersonal war klar, dass der Streifen entnommen werden muss. Dann musste dieser mit den Angaben zur
Besatzung, zur
Lokomotive
und zu den Zügen ergänzt werden musste. Eine unbeliebte Arbeit, da
anschliessend das ganze Paket dem Vorgesetzten abgegeben werden musste.
Dieser prüfte dann die Aufzeichnung. Zusammen mit der Vakuumbremse wurde auch die Zugs-heizung eingeführt. Bei den mit den Reisezügen betrauten Maschinen musste daher ein entsprechender Regulator einge-baut werden. Zu den
Stossbalken
geführt war eine Leitung und dort die beweglichen
Verbindungen
zu den
Reisezugwagen.
Letztere waren jedoch nur vorhanden, wenn die Wagen geheizt werden
mussten. Man konnte so den Unterhalt ausführen. Da sich die
Vakuumbremse
der
Bauart
Hardy nicht bewährte, wurde diese nur ein Jahr später ausgebaut. Neu
wurden die
Lokomotiven
mit den
Bremsen
nach dem Muster
Westinghouse
versehen. Diese hatten schon seit einigen Jahren in Amerika den Durchbruch
geschafft und sollte nun auch in Europa eingeführt werden. Daher stand
1888 erneut ein Umbau an, der nun aber die Lokomotiven A2 deutlich
verändern sollte.
Da nun aber die
Luftpumpe
nicht dauerhaft mit Dampf versorgt werden sollte, musste auch ein Vorrat
für kurze Momente mit einem grossen Bedarf an
Druckluft
geschaffen werden und das war nicht so einfach. Bei der Lokomotive war der vorhandene Platz ausgesprochen gut ausgenutzt worden. Hier noch ausreichend Platz für Luftbehälter zu finden war nicht einfach. Daher wurden diese auf den beiden
Wasserkästen
montiert. Dank der grös-seren Anzahl konnte deren Durchmesser so
verringert werden, dass die Sicht über den Kasten nicht komplett versperrt
wurde. Übersichtlicher wurde die Baureihe jedoch nicht. Vom Aufbau her entsprach die Westinghousebremse dem Prinzip, wie wir es schon bei den Modellen A2 kennen gelernt haben. Dabei war dort natürlich von den Nummern 31 bis 33 die Rede. Eine erneute Vorstellung der direkten
Regulierbremse
und der indirekten
automatischen Bremse
lassen wir weg. Wichtig ist, dass nun auch diese Maschinen wieder auf dem
neusten Stand der Technik waren und so eingesetzt werden konnten. Gerade die Einführung der Westinghousebremse führte zu einer deutlichen optischen Veränderung, denn die an der Rauchkammer montierte Luftpumpe war gut zu erkennen. Seit deren Einführung sollten alle neu
ausgelieferten
Lokomotiven unab-hängig vom geplanten Einsatz damit versehen
werden. Es war also bereits zu Beginn klar, dass auch
Güterwagen
damit versehen werden sollten. Begonnen wurde aber mit den
Reisezügen. Im Jahre 1890 kamen die Maschinen mit den
Nummern 31 bis 33 in Betrieb. Auch sie wurden nach dem neuen System
bezeichnet und hörten daher auf die Bezeichnung A2. In Zukunft werden wir
daher nicht darum herum kommen, die Nummern bei diesen beiden Baureihen zu
benutzen. Zur Erinnerung die bisherigen BI hatten die Nummern 25 bis 30
bekommen und so reihten sich alle schön der Nummern entlang auf.
Dieser wurde von der Bahngesellschaft angebracht, war hier aber schon nach wenigen Tagen vorhan-den. Daher waren die Nummern 31 bis 33 im
technischen Bereich mit den älteren Maschinen ebenbürtig. Da beide im
Personenverkehr
tätig waren, war das eigentlich klar. So profitierten die Nummern 31 bis 33 von
der späteren Auslieferung und das sollte zur Folge ha-ben, das bei diesen
Maschinen kaum mehr tech-nische Anpassungen vorgenommen wurde. So kann
auch hier klar erkannt werden, dass die drei Modelle gut aufgebaut wurden.
Wie gut die neuen A2 wirklich waren, werden wir nachher beim
Betriebseinsatz sehen, denn der erste Umbau stand nach wenigen Jahren an
und betraf auch die ehemaligen BI. Es sollten nicht die letzten Anpassungen
der alten Modelle sein. Jedoch betrafen diese nun alle Maschinen. Dabei
beginne ich mit den
Bremsen,
denn diese waren bei der
Gotthardbahngesellschaft
seit der Einführung ein Thema. Gerade die schlechten Bremsen der
Lokomotiven
war dem Direktorium nicht geheuer. Als die Reihe
A3t mit gebremsten
Laufachsen
bei den
Drehgestellen
kam, zeigte sie deren Vorteil deutlich auf, denn so wurde die
Bremskraft
erhöht.
Es waren schlicht die einzigen, die neben
der Reihe
A3t mit dieser
Bremse
versehen werden sollten. Daher müssen wir etwas genauer hinsehen, denn
diese Einrichtung war bei den hier vorgestellten
Lokomotiven
neu eingebaut worden. Die Drehgestellbremse bei den Drehgestellen war auf beide Seiten aufgeteilt worden. Der Grund dafür war, dass in diesem Bereich schlicht kein Platz für ein Bremsgestänge vorhanden war. So wurde der neue
Bremszylinder
einer Seite am Rahmen des
Drehgestel
montiert und er reagierte sowohl auf die
Regulierbremse,
als auch auf die
Westinghousebremse.
Dazu wurde jedoch ein zusätzliches
Steuerventil
verbaut. Wurde
Druckluft
in den
Zylinder
gelassen, wurden die beiden
Kolben
ausgestossen und drückten die
Bremssohlen direkt gegen die
Lauffläche.
So wurde jede
Laufachse mit zwei
Bremsklötzen
versehen und das
Drehgestell
hatte vier Klötze. Das bedeutete hier schlicht eine Verdoppelung der
Bremssohlen und somit eine deutliche Steigerung der
Bremskraft.
Die Baureihe A2 war daher weiterhin auf dem aktuellen Stand der Technik. Als die Bahnen in der Schweiz erkannt
hatten, dass es ein einheitliches System braucht, wurde nicht an alle
Probleme gedacht. Als aber im Jahre 1902 die neuen Schweizerischen
Bundesbahnen SBB den Betrieb aufnahmen, änderte sich vieles. So war ab
diesem Zeitpunkt klar, dass die
Gotthardbahn
auch dazu gehören würde. Bis jedoch die
Bahngesellschaft
in die
Staatsbahnen
überführt werden konnte, passte sich diese an.
Mit anderen Worten, wir können die nun auch
ein-heitlich schwarz gefärbten Baureihen anhand der neuen Bezeichnung
leicht unterscheiden. Da die Num-mern noch blieben, war aber die nahe
Verwandt-schaft zu erkennen. Die sechs Lokomotiven, die als Reihe BI in Betrieb genommen wurden, verloren die Bezeichnung A2. Als Tenderlokomotiven wurden sie nun auch als solche bezeichnet. Da nun der Schwellwert für die
Geschwindigkeit ebenfalls angepasst wurde, verloren die Maschinen die
höchste Klasse. So wurden sie ab dem Jahre 1902 als Reihe Eb 2/4 geführt.
Noch blieben die Nummern, denn diese wurden erst 1909 zu 5425 bis 5430
geändert. So bleiben noch die drei schnellen
Maschinen. Diese konnten natürlich die höchste Klasse behalten und wurden
zur Baureihe Ea 2/4. Damit war klar geregelt, welche Baureihe nun wie
bezeichnet wurde. Die Nummern 31 bis 33 wurden im Jahre 1909 mit der
Verstaatlichung ebenfalls geändert und nun wurde die Trennung vollständig
vollzogen. Die drei
Lokomotiven
bekamen von den Schweizerischen Bundesbahnen SBB die Nummern 5031 bis
5033. Nachdem die Schweizerischen Bundesbahnen
SBB den Betrieb auf der
Gotthardbahn
übernommen hatten, gab es bei den Baureihen Eb 2/4 und Ea 2/4 keine
Umbauten mehr. Der Grund war simpel, denn nun konnten auch neu entwickelte
Modelle anderer Gesellschaften für den Verkehr genommen werden. Mit einem
Alter von rund 20 und 30 Jahren waren die Maschinen schlicht schon zu alt
geworden für weitere Anpassungen.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2023 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Sie
werden schnell erkennen, dass sich die grössten Veränderungen in den
Jahren bis zur Auslieferung der drei
Sie
werden schnell erkennen, dass sich die grössten Veränderungen in den
Jahren bis zur Auslieferung der drei
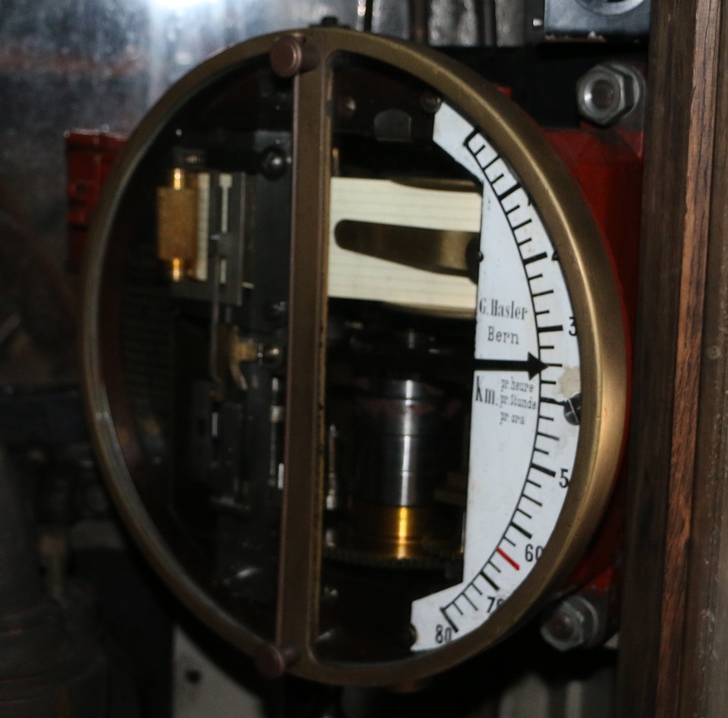 Aus
diesem Grund wurden die Maschinen ab dem Jahre 1887 mit
Aus
diesem Grund wurden die Maschinen ab dem Jahre 1887 mit
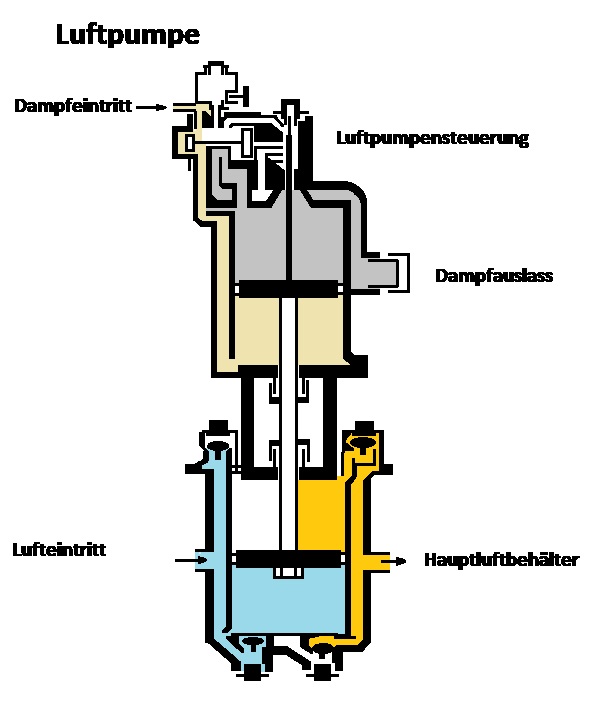 Für
die
Für
die 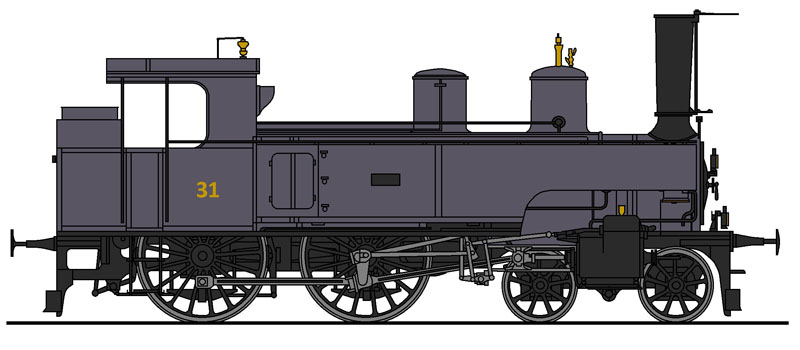 Die
neu ausgelieferten
Die
neu ausgelieferten
 Der
Hinweis, dass diese
Der
Hinweis, dass diese 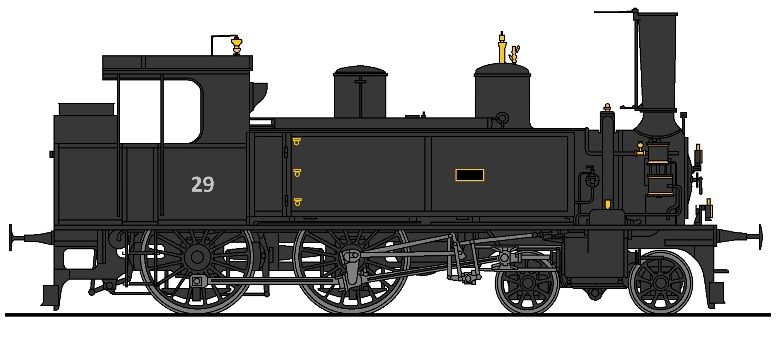 So
kam es, dass die
So
kam es, dass die