|
Betriebseinsatz Teil 1 |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Bevor wir uns dem Betriebseinsatz zuwenden,
noch ein Hinweis in eigener Sache. Mit der 1902 eingeführten Bezeichnung
hatten wir erstmals die Möglichkeit, diese beiden Serien leicht zu
unterscheiden. Daher werde ich in diesem Abschnitt mit den letzten
Bezeichnungen arbeiten. So lange aber bei der
Gotthardbahn noch eine andere Lösung angewendet wurde, wird diese
in Klammer auch noch aufgeführt werden.
Das erfolgte sogar in eigener Kraft und über
die da-mals befahrbaren Strecken. Dabei blieb die Verant-wortung für diese
Fahrten aber noch beim Herstel-ler, denn mit der
Gotthardbahn war die Übergabe klar geregelt worden. Nach der Ankunft der Lokomotiven in Rotkreuz wurden die Maschinen formell von der Gotthard-bahn übernommen. Eine Regelung, die bis zum Ende der Gesellschaft beibehalten bleiben sollte. Doch damit stellt sich uns die Frage, warum
gerade dieser
Bahnhof
gewählt wurde, denn offiziell begann die neue Strecke nach den
Sparmassnahmen im kleinen Bahnhof Immensee und man könnte dort die
Übernahme erwarten. Der Grund war simpel, denn die Strecke
zwischen Rotkreuz und Immensee wurde von der
Gotthardbahn gebaut und betrieben. Lediglich die Kilometrierung
wurde von der Aargauer
Südbahn
übernommen. So begann die Strecke nicht, wie man meinen könnte in
Immensee, sondern im benachbarten
Bahnhof
von Rotkreuz. So wird nun auch klar, dass die
Lokomotiven
an der Grenze zur
Bahngesellschaft
übergeben wurden. Nach der formellen
Übernahme
fuhren die
Lokomotiven
zuerst über die fertig gebauten Strecken nach dem Depot
von Arth-Goldau. Zwar könnte man meinem, dass Erstfeld das Ziel gewesen
ist. Da es dort aber wegen der Verschiebung an den neuen Standort zu
Verzögerungen beim Bau gekommen war, stand das Depot schlicht noch nicht
zur Verfügung. Daher musste man die Anlagen in Arth-Goldau benutzen.
Erst mit der offiziellen Eröffnung der durchge-henden Strecke, konnten auch Reisezüge befördert werden. Ein Vorgang, der bei den meisten Bahnen so
um-gesetzt wurde und der auch die Schulung des Per-sonals auf dem neuen
Arbeitsgerät erlaubte. Die sechs Lokomotiven, die mit den Nummern 25 bis 30 versehen wurden, standen daher zur Eröff-nung der Strecke mit dem Personal bereit. Das war wirklich so, da die Dampflokomotiven
im
Titularsystem
betrieben wurden. Das bedeutete, dass eine kleine
Gruppe
aus Lokführern und
Heizern
mit einer bestimmten Nummer eingesetzt wurde. Auch wenn dieses Lösung bei
den Bahnen heute unüblich ist, sie hatte Vorteile. Dadurch kannte die Besatzung ihre
Lokomotive
sehr gut und konnte die Maschine optimal einstellen. Gerade bei der
Verdampfung, oder bei der genauen Reaktion der Steuerung, gab es immer
wieder grosse Unterschiede bei den Lokomotiven, die so ausgeglichen werden
konnten. Es gab also keine einheitliche Serie in den Zeiten der
Dampflokomotiven. Der Hersteller war zwar bemüht, aber genaue
Einstellungen gab es selten. Wie alle
Lokomotiven
der
Gotthardbahn, wurden die Modelle der Baureihe Eb 2/4 (BI) für den
schweren Unterhalt der
Hauptwerkstätte
Bellinzona zugeteilt. Eine Zuteilung zu den einzelnen Depots
gab es bei der Gotthardbahn jedoch nicht. Wir können aber annehmen, dass
die Anlage in Erstfeld die Aufgaben des kleinen Unterhalts übernahm. Dort
war eine kleine Werkstatt vorhanden, die es in Arth-Goldau nicht gab.
Eingesetzt wurden sie aber nicht nur ab dort, sondern auch ab dem Depot Arth-Goldau. Welche Nummer nun wo war, ist nicht wichtig. Sie wurden vermutlich immer wieder zwischen
den beiden Standorten ausge-tauscht. Besonders dann, wenn der Un-terhalt
anstand. Die erste Bewährungsprobe hatten die neuen Lokomotiven mit den Nummern 25 bis 30 bei den Feierlichkeiten zur Er-öffnung der Gotthardbahn. Zu zweit mussten die schweren Reise-züge mit den geladenen Gästen und den Vertretern der Presse über den ersten Abschnitt geführt werden. Das führte dazu, dass sämtliche Ma-schinen
benötigt wurden und diese den Abschnitt mehrmals befahren mussten, weil es
eine grosse Feier war. Mit der Betriebsaufnahme am 01. Juni 1882
übernahmen die
Lokomotiven
den Verkehr auf der Strecke zwischen Rotkreuz und Erstfeld. Dabei hatten
die Lokomotiven neben den beiden
Schnellzügen
auch die üblichen
Regionalzüge
zu führen. Sie haben es richtig gelesen, es gab zu Beginn nur zwei
Schellzüge, die zudem über den Tag und in der Nacht verkehrten.
Regelmässige
Verbindungen
gab es also noch nicht. Die zulässigen
Normallasten
betrugen auf der Strecke 160 Tonnen. Gefahren wurde dabei meistens mit 45
km/h. Wobei es durchaus auch Abschnitte gab, wo die
Lokomotive
Eb 2/4 (BI) ihre
Höchstgeschwindigkeit
von 75 km/h erreichte. Wobei man damals das nicht so genau wusste, denn
die Lokführer mussten jederzeit die Geschwindigkeit berechnen und da
konnte sich schnell einmal ein Rechenfehler einschleichen.
Auch bei Geschwindigkeiten, die sehr nahe der
Höchstgeschwin-digkeit
lagen, waren die Eb 2/4 (BI) ausgesprochen ruhig unterwegs. So waren
vermutlich ab und zu auch Übertretungen bei den zulässigen
Geschwindigkeiten vorgekommen. Mit dem Ansturm auf die neue Strecke gab es schnell erste Probleme. Gerade die beiden Schnellzüge waren oft sehr schwer. Die Bespannung mit bis zu zwei Lokomotiven waren daher nicht selten und das auch auf den flachen Strecken. Das Problem waren aber die bei diesen Zügen
benötigten
Brem-ser.
Besonders auf der
Bergstrecke
kam es damit immer wieder zu Problemen mit den
Bremswegen,
denn jeder zog die
Hand-bremse
nach Gefühl an. 1885 begannen die ersten Versuche mit der
Vakuumbremse.
Da bei dieser
Bremse
die Wagen nur bewegt werden konnten, wenn die Leitung angeschlossen wurde
und weil man ja die
Schnell-züge
testen wollte, war klar, dass die betreffenden Maschinen und so die
Baureihe Eb 2/4 (BI) damit versehen wurden. Auf den
Lokomotiven
wurde daher eine
Vakuumpumpe
eingebaut, die mit Dampf betrieben werden konnte. Damit konnten die
Lokomotiven
auch die mit dieser
Bremseinrichtung
ausgerüsteten Wagen bremsen. Die bisherigen Signale an die
Bremser
entfielen, weil diese nicht mehr benötigt wurden. Jedoch gab es immer
wieder Probleme, da das Vakuum in Göschenen und Erstfeld unterschiedliche
Kräfte zur Folge hatte. Daher sollte neu ein System eingeführt werden, das
bei den amerikanischen Bahnen erfolgreich eingesetzt wurde.
Die bisher als Reihe BI geführten Maschinen
sollten daher neu als Baureihe A2 geführt werden. Eine Veränderung die
nicht so gross war, wie die neue
Dampfheizung
mit der Leitung am
Stossbalken. Gefährlich war das bisherige Problem mit den Überschreitungen bei den erlaubten Geschwindigkeiten. Man erkannte, dass die Berechnungen des Lokomotivpersonals oft zu Fehlern führten und bei denen keine Absicht unterstellt werden konnte. Um hier eine deutliche Verbesserung zu erreichen, wurden sämtliche Lokomotiven der Gotthardbahn mit Geschwindigkeitsmesser versehen. Diese waren von der Bauart Klose und sie arbeiteten sehr genau. Da bei dem Modell auch eine Registrierung der Fahrdaten vorhanden war, konnte gesichert werden, dass auch die bewussten Überschreitungen zum Aufholen von Verspätungen nicht mehr vorkommen sollten. Das ermöglichte auf den Strecken der
Gotthardbahn einen sicheren Betrieb der
Lokomotiven.
Da diese nun aber auch die
Vakuumbremse
verloren hatten, waren wieder die
Bremser
im Einsatz, denn noch waren die Teile nicht eingetroffen. Nur ein Jahr später führte die
Gotthardbahn die
Westinghousebremse
bei den
Reisezügen ein. Der Versuch damit zeigte schnell
deren Vorteile, so dass dieses amerikanische Prinzip auch in Europa
eingeführt werden sollte. Noch mussten aber die Teile der Firma
Westinghouse
importiert werden. Wie gut die
Bremse
wirklich war, zeigte die Tatsache, dass sie auch heute noch bei den Bahnen
in Europa verwendet wird.
Dies obwohl die
Lokomotiven
immer öfters stark ausgelastet waren und man ab und zu, zu doppelter
Bespann-ung greifen musste. Das Problem war jedoch das Tessin. Dort wurden die Reisezüge mit den Maschinen aus den Beständen der Tessiner Talbahnen gezogen. Diese hatten ein hohes Alter erreicht. Zudem konnte zwischen Biasca und Bellinzona
auch schneller gefahren werden. Das wollte man nun aus-nutzen und daher
wurden von der
Gotthardbahn für den Abschnitt im Tessin neue
Lokomotiven
beschafft. Diese sollten nach dem Muster der Reihe Eb 2/4 (A2) gebaut
werden. Die
Gotthardbahn wollte nach der Einführung der
automatischen Bremse
den Betrieb auf neue Beine stellen. So sollte der
Güterverkehr
mit einer neuen
Tenderlokomotive
mehr leisten können. In diesem Zusammenhang sollte die Reihe
D6 die Welt auf den Kopf stellen. Mit
neuen Rennern für die
Schnellzüge
sollte auch in diesem Punkt etwas gehen. Dabei waren jedoch nur wenige
Strecken für mehr als 75 km/h zugelassen worden. Im Jahre 1890 kamen die drei von der Firma
Maffei in München gelieferten Maschinen der Reihe Ea 2/4 (A2) in den
Bestand der
Gotthardbahn. Auch sie wurden in Rotkreuz übergeben und
anschliessend überführt. Das Zeil war diesmal jedoch das Tessin. Da sie
zudem die Nummern 31 bis 33 erhalten hatten, war auch klar, dass es von
der älteren Serie keine weiteren
Lokomotiven
mehr geben wird, der neue Renner sollte es richten.
Mit 90 km/h konnte sie damals in der Schweiz
wirk-lich mithalten und das war ja das Ziel gewesen. Die gemütliche
Gotthardbahn war endlich auch bei den anderen Bahnen angesehen. Bei den Versuchsfahrten im Tessin zeigte sich, dass die Normallasten der Nummern 25 bis 30 einge-halten werden konnten. Zudem war auch hier ein ausgesprochen ruhiges Fahrverhalten vorhanden. Der hochgezüchtete Renner konnte also im
Gegen-satz zum Monster für den
Güterverkehr
überzeugen. Dass sie sich damit aber ins eigene Bein schnitten, war damals
noch nicht klar, denn eine Idee der Reihe
D6 war wirklich gut. Die drei
Lokomotiven
übernahmen im Tessin die hochwertigen Züge zwischen Biasca und Bellinzona.
Dazu gehörten in erster Linie die beiden
Schnellzüge,
die wirklich eine lange
Fahrzeit hatten und die das Direktorium gern beschleunigt hätte. Der
erste Versuch waren diese Renner, die auf einem kurzen Abschnitt so
richtig Tempo machen konnten. Doch das ergab nur wenige Minuten und die
Fahrzeit am Tag blieb bei 12 Stunden. Verdrängt wurden die älteren
Lokomotiven
der Baureihe A2T, die noch aus der Zeit der Tessiner Talbahnen stammten.
Diese verschwanden zwar nicht, aber die hochwertigen Züge waren aus den
Dienstplänen
verschwunden. Sie mussten sich noch mit den normalen
Regionalzügen
ein Gnadenbrot verdienen. Mit 75 km/h waren sie einfach zu langsam
geworden und im Norden konnten sie nicht mit der Reihe Eb 2/4 (A2)
mithalten.
Schliesslich waren sie die schnellsten
Lokomotiven
der
Bahngesellschaft
und daher für diesen Bereich gebaut worden. Doch im-mer mehr zeigte sich,
dass die kleinen Maschinen am Limit waren und auch im flachen Teil oft
eine
Vorspannlokomotive
benötigten. Ab dem Jahre 1894 begann der Stern der
Tenderlokomotiven
auf beiden Seiten des Gotthards zu sinken. Die
Gotthardbahn beschaffte neue
Schlepptenderlokomotiven
für den hochwertigen Verkehr vor den
Schnellzügen.
Die Reihe
A3t konnte die schweren Züge
auch auf der
Bergstrecke
führen und so den Verkehr beschleunigen. Bei der Geschwindigkeit konnte
sie mit den Ea 2/4 (A2) problemlos mithalten und das erst noch locker. Zudem schafften die
Lokomotiven
mit den grossen Vorräten auch längere Strecken ohne Halt. Die plötzlich
alt gewordenen
Tenderlokomotiven
hatten das Nachsehen. Die
Schnellzüge
waren weg, denn dank den neuen Maschinen konnte bei den beiden
Schnellzügen auch ein
Speisewagen
mitgeführt werden. Damit konnte die
Fahrzeit am Tag um eine ganze Stunde gekürzt werden. Der Grund war der
Suppenhalt, der nicht mehr benötigt wurde. Die
Lokomotiven
der Reihen Eb 2/4 (A2) und Ea 2/4 (A2) wurden in niederere Dienste
verdrängt und führten nun nahezu ausschliesslich die
Personenzüge
auf den bisherigen Strecken. Die beiden
Schnellzüge
waren aus den
Dienstplänen
gestrichen worden, denn diese übernahmen die neuen Lokomotiven der Reihe
A3t. Mit den leichten regionalen
Zügen konnten die alten Lokomotiven jedoch auch auf der
Bergstrecke
eingesetzt werden.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2023 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
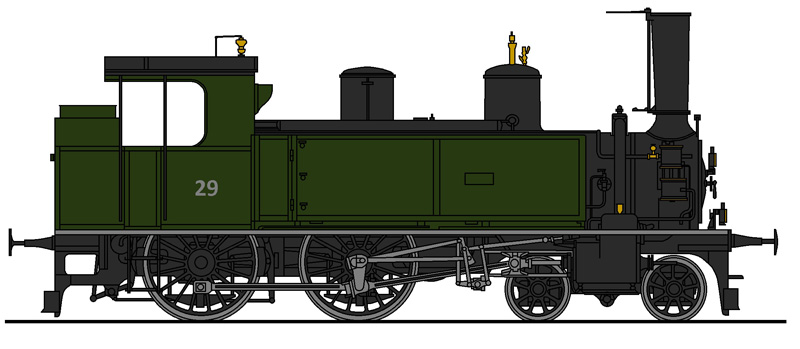 Die
sechs
Die
sechs
 Im
Anschluss begannen die
Im
Anschluss begannen die
 Man
kann deshalb davon ausgehen, dass die
Man
kann deshalb davon ausgehen, dass die
 Schon
sehr früh erkannte man bei der
Schon
sehr früh erkannte man bei der
 1887
kam es zu einer regelrechten Modernisierung der
1887
kam es zu einer regelrechten Modernisierung der
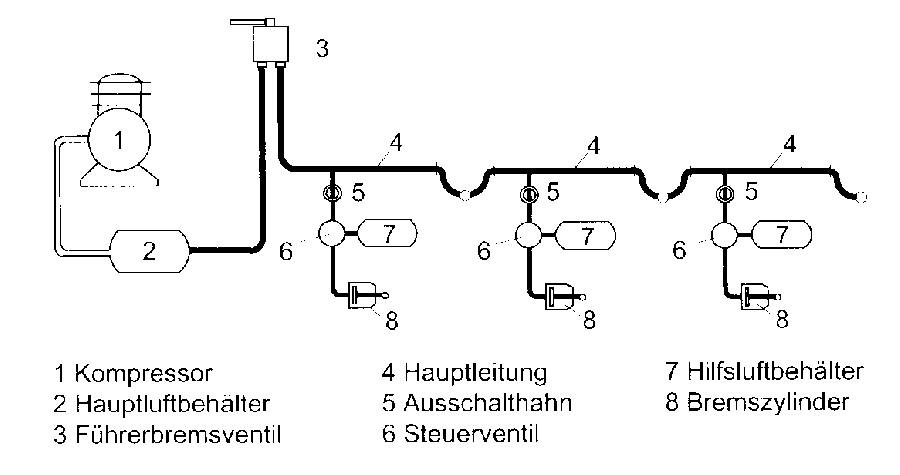 Die
Die
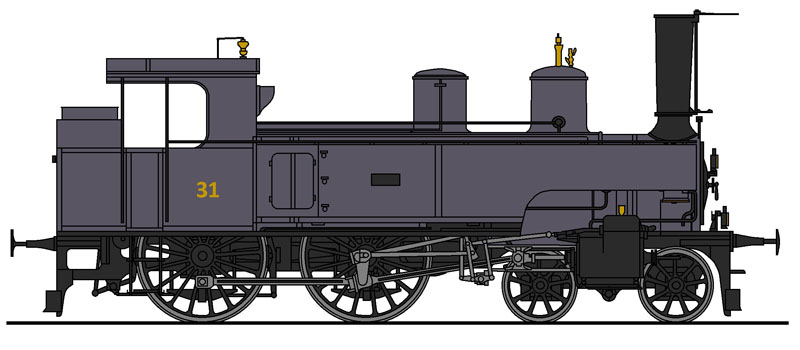 Die
neuen
Die
neuen
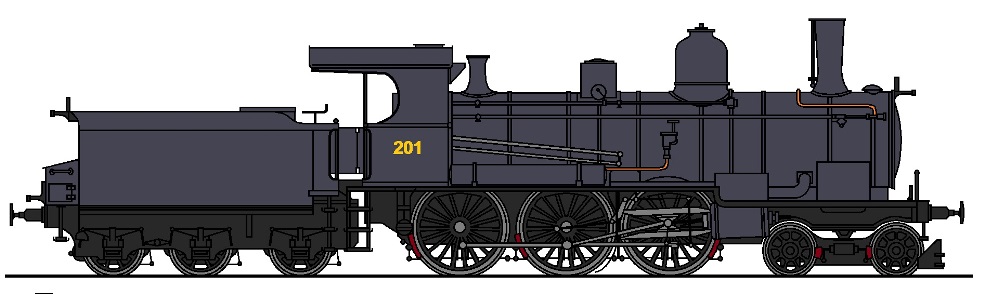 Die
Die