|
Bedienung der Lokomotive |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Bei der Bedienung gab es zwischen den
beiden Baureihen keine grossen Unterschiede. Wobei so einheitlich gebaute
Lokomotiven, wie wir sie heute kennen, gab es damals nicht. So
hatte jede ihre Macken und stellte sich dem
Lokomotivpersonal
mehr oder weniger in die Quere. Begriffe wie, dass es sich um einen guten
Verdampfer handle, oder die
Kohle
gut angenommen würden, zeugen von dieser Tatsache und Details würden
verwirren.
Das ist nicht nur bei uns so, denn um eine solche Lokomotive auf den Betrieb vorzubereiten war oft eine Arbeit erforderlich, die mehrere Stunden dauern konnte. Genau sagen liess sich das nicht, denn der
gute Ver-dampfer war vermutlich deutlich eher betriebsbe-reit, wie der
Mistbock, der nicht will. Es ist nicht überliefert worden, welche Nummer nun wie angeheizt werden musste. Das wären zudem zu grosse Details, die nicht immer belegt werden konnten. Oft hatten die Mitarbeiter einfach das
Gefühl, dass es bei der Nummer etwas besser ging, als bei der anderen. Zur
Vereinfachung nehmen wir einfach eine
Lokomotive in Betrieb. Welche Nummer diese hatte und wie lange es
für jeden Schritt brachte, lassen wird weg. Weil auch die
Gotthardbahn es sich nicht leisten konnte, das teure
Lokomotivpersonal
über Stunden in einem Depot
zu beschäftigen, waren dort Arbeiter angestellt worden, die befugt waren,
die
Lokomotiven auf den Betrieb vorzubereiten. Das mit der Bedienung
betraute Personal traf dann erst bei der Lokomotive ein, wenn die Fahrt
bevor stand. Doch wir wollen und auch diese niederen Arbeiten im Depot
genauer ansehen. Der
Hilfsheizer
war im Depot
angestellt worden, um bei den
Lokomotiven das Feuer zu entfachen und dieses Auszubauen. Dabei
konnte er durchaus auch mehrere Maschinen gleichzeitig anheizen und
regelmässig bewachen. Bei der
Gotthardbahn war eigentlich nur speziell, dass einige Hilfsheizer
auch auf der Strecke im Einsatz waren. Besonders bei den langen Steigungen
unterstützten sie den normalen
Heizer
bei seiner anstrengenden Arbeit.
Um trotzdem etwas mehr Schwung in die Sache
zu bringen, wurde die Luftströmung künstlich verstärkt. Dazu wurde eine
Anfachlanze
verwendet. Diese wurde ab den stationären Einricht-ungen versorgt. So konnte der Ausbau beschleunigt werden und der Druck im Kessel stieg an. War dieser hoch genug, konnte die Anfachlanze durch den in der Rauchkammer montierten Hilfsbläser ersetzt werden. Betriebsbereit war die
Lokomotive
damit zwar nicht, aber sie war nun nicht mehr am Depot
«angeschlossen» worden. Oft war das nun der Zeitpunkt, wo der
Hilfsheizer
sich auch um andere Feuer kümmern konnte. Mit dem Feuer, das zu diesen Zeitpunkt so
weit ausgebaut worden war, dass der gesamte Rost bedeckt war, musste
relativ lange «gekocht» werden, bis sich der Druck im
Kessel
so weit näherte, dass die
Sicherheitsventilel
öffneten. Das war aber gleich der Hinweis, dass die
Lokomotive
für den Betrieb bereit ist. Doch noch konnte nicht losgefahren werden,
denn auch der zweite von einem Depot
gestellte Mitarbeiter musste seine Arbeit noch machen. Der Schmierer füllte die Vorräte beim
Schmiermittel
bei den entsprechenden Stellen nach. Je nach Gösse der
Lokomotive
konnte das längere Zeit in Anspruch nehmen. Ob jedoch die
Schmierung
der
Lager
auch funktionierte, konnte erst auf der Fahrt festgestellt werden und
damit sind wir beim
Lokomotivpersonal
angelangt. Dieses tauchte meistens dann auf, wenn die Arbeiten gemacht
waren und sie führten viel Material mit sich mit.
Während sich der Lokführer im
Dienstgebäude
mit den aktuellen
Fahrplänen
und Anweisungen vertraut machte, besorgte der
Heizer
zeitgleich in der
Lam-pisterie
die Lampen für die
Beleuchtung
der
Loko-motive.
Es war also ein eingespieltes Team, wo jeder seine Aufgaben hatte. Bei den Dampflokomotiven waren die Lampen
nicht fest dem Fahrzeug zugeteilt worden. Diese mussten für den Betrieb
vorbereitet werden und das erfolgte in den Depots,
wo mit den gefährlichen Mitteln in einem speziellen Raum gearbeitet wurde.
Das
Lokomotivpersonal
holte dort also vor der Fahrt die benötigte Anzahl ab, nahm diese aber
nicht in Betrieb. Das Licht wurde nur in der Nacht und bei langen
Tunneln
angefacht. Gerade die
Gotthardbahn war bekannt für die vielen und auch langen
Tunneln.
So darf erwartet werden, dass bei den Maschinen der Baureihe BI im Norden
das Licht mehr vorhanden war, als bei der Reihe A2, die zwischen Biasca
und Bellinzona nur einige und auch nicht so lange Tunnel hatten. Ursache
dafür war aber nicht die
Bergstrecke,
sondern die
Bahnlinie
entlang des Urnersees, der vielen auch als
Axenstrecke
bekannt ist.
Zudem waren diese
Karbidlampen
auch mit Fächern versehen worden. In diesen waren eingefärbte Gläser
abgelegt worden. Benötigt wurden diese
Farbscheiben
für die damals noch vorhandenen zahlreichen speziellen
Signalbilder. Aufgesteckt wurden dieses Laternen auf beiden Seiten der Lokomotive über den Puffern am Stossbalken. Wobei meistens beim hinteren Balken nur eine Lampe verwendet wurde. Da an der Spitze noch eine dritte Lampe benötigt wurde, stand eine Kletterpartie an. Deren Halterung befand sich oberhalb der
Rauchkammer
und so war die Laterne nicht einfach aufzustecken, zumal man sich auf dem
schmalen Umlaufblech bewegte. Wenn der Heizer schon auf dem Umlaufblech stand, konnte auch der Kamindeckel geöffnet werden. Eine Arbeit die nur erfolgte, wenn sie noch nicht gemacht wurde. Bei der Baureihe A2 erfolgte das vor dem Aufstecken der Laterne, weil diese danach im Weg gewesen wäre. Doch damit war bei Arbeitsbeginn die Arbeit
an dieser Stelle abgeschlossen worden und wir müssen noch schnell zur
Baureihe BI wechseln. Der Kamindeckel bei der Baureihe BI musste hinter dem Kamin bedient werden. Das war nicht so leicht, da das Umlaufblech in dem Bereich keinen guten Standflächen bot. Damit sich das Personal zumindest festhalten konnte, wurde um die Kammer ein Handlauf montiert. Da dieser auch dort vorhanden war, wo das
Umlaufblech fehlte, kann man sich nach dem Nutzen dieses Handlaufes
fragen, denn hangelnd dem
Kessel
folgen war nicht beliebt. Das Lokomotivpersonal ist eingetroffen und die Maschine mit den nötigen Lampen versehen worden. Bei der Baureihe BI konnte damit die Fahrt begonnen werden. Nicht so bei den jüngeren Modellen der Reihe A2, denn dort musste noch die neue Luftpumpe aktiviert werden. Die Lokomotiven benötigten daher Durchluft um losfahren zu können. Genau genommen, um die Bremsen korrekt lösen zu können. Es dauert daher etwas länger. Auf die bei der Reihe A2 erforderlichen Bremsproben verzichten wir hier. Diese Prüfungen entsprachen den anderen
Baureihen, die mit der entsprechenden
Bremse
ausgerüstet wurden. Es wird schliesslich Zeit, dass wir mit den Reihen BI
und A2 auf die grosse Fahrt gehen. Viele Unterschiede gab es nicht, denn
Dampflokomotiven wurden grundsätzlich auf die gleiche Weise betrieben.
Neuerungen gab es auch bei der
Gotthardbahn nicht. Die Positionen des
Lokomotivpersonals
waren während der Fahrt klar festgelegt worden. So nahm der
Heizer
die Position auf der linken Seite ein und der Lokführer fand seine
Bedienelemente auf der rechten Seite. Beide verrichteten die Arbeit
stehend. Damit der Stand etwas sicherer wurde, war der Boden mit
Holzplanken belegt worden. So konnte wirksam verhindert werden, dass das
Personal auf nassem Boden ausrutschen konnte. Auch die Aufgaben war grundsätzlich klar.
Der
Heizer
sorgte für ausreichend Dampf und der Lokführer fuhr mit der Maschine.
Meistens galt bei den Bahnen, dass dieses Team nicht getrennt wurde. So
wusste jeder über die Fähigkeiten des anderen Bescheid. Da auch die
Lokomotiven
im
Titularsystem
betrieben wurde, kam es zur Situation, dass nach wenigen Wochen wirklich
eine optimal arbeitende Maschine zur Verfügung stand. Um Losfahren zu können, musste die
Fahrrichtung eingestellt werden. Dazu wurde die Steuerung entsprechend
verstellt. Der erfahrende Lokführer wusste zudem auch, wie er die
Füllmenge optimal einstellen konnte. Erst danach wurde der
Regulator
geöffnet und die
Dampfmaschinen
arbeiteten gegen die
Handbremse,
die dann noch gelöst werden musste. So bewegten sich die Räder und die
Maschine fuhr langsam los.
Der Verbrauch beim Dampf war nun auch
entsprechend hoch, so dass die Arbeiten des
Heizers
nun mehr an Bedeutung bekamen, denn er musste für den Nachschub sorgen. Die Bestückung des Feuers erfolgte oft mit der Hilfe des Lokführers, denn dieser bediente die Türe zur Feuerbüchse. Gerade bei den beiden hier im Flachland eingesetzten Maschinen musste aber nicht dauernd Kohle nachgelegt werden. In diesen Fällen wurde der Wasserstand
geprüft. Die
Nachspeisung
konnte durchaus während der Fahrt vollzogen werden. Wichtig war, dass in
dem Fall der Lokführer keine
Zugkraft
benötigte. Hatte der Heizer keine Arbeiten zu erledigen, musste er den Lokführer bei seiner Arbeit unterstützen. Diese bestand natürlich auch in der Beobachtung der Bahnlinie und in diesem Punkt waren die beiden Baureihen nicht optimal. Durch das
Frontfenster
war vor der Maschine kaum etwas zu erkennen und ein grosser toter Winkel
entstand. Auch wenn die Reihe A2 etwas schlechter war, soll das nicht
gross erwähnt werden. Bei beiden Baureihen musste das
Lokomotivpersonal
daher seitlich hinauslehnen um etwas vor der
Lokomotive
zu erkennen. Besonders wichtig war das bei den Signalen, die in der
Schweiz bekanntlich links aufgestellt wurden. Das war hier aber die Seite
des
Heizers.
Daher war die Beobachtung der Strecke oft so wichtig, dass auch der
Lokführer zur Schaufel greifen konnte. Hektisch wurde es jedoch erst, wenn
die geschlossene
Einfahrt
angekündigt wurde.
Nur wenn es die Zeit noch erlaubte, wurde
auch die
Handbremse
der
Lokomotive
angezogen. Eine heu-te abenteuerliche Bremserei, die damals aber noch ganz
gut funktionierte und die
Gotthardbahn hatte damit auch nur auf der
Bergstrecke
Probleme. So kam es, dass die Reihe A2 bei der Auslieferung über die Druckluftbremsen verfügte. Damit änder-ten sich die Handlungen bei der oben beschriebenen Situation. Nun leitete der Lokführer als erstes mit der West-inghousebremse eine Bremsung ein, nahm die Steu-erung zurück und schloss den Regulator. Da nun eine durchgehende
Bremse
vorhanden wa-ren, erübrigte sich auch die Anwendung der
Lokpfeife,
jedoch blieb die Hektik vorhanden. Wir haben damit die während der Fahrt vollzogenen Handlungen kennen gelernt. Je nach Dienstplan, kehrte die Lokomotive nach der Arbeit wieder ins Depot zurück. Dort mussten noch die üblichen Nacharbeiten
vorgenommen werden. Dazu suchte die
Lokomotive
das
Schlackengleis
auf. Dort mussten die Überreste der
Kohlen
entsorgt werden. Eine Arbeit, die nicht sehr beliebt war, aber zum Beruf
gehörte und die wichtig war. So wurde über der Grube dieses
Gleises
der
Aschekasten
geleert. Sie können sich vermutlich vorstellen, was passierte, wenn die
Asche mit Hilfe der Schwerkraft in die Grube fiel. Feine Partikel wurden
dabei zerstäubt und hingen so in der Luft um die
Lokomotive,
doch der mühsamere Teil befand sich an der Spitze und auch dort war es
nicht unbedingt gut um zu arbeiten. Besonders dann, wenn die Lokomotive
danach wieder in Dienst kam.
Dort dann mit der der Schaufel die
Lösche
zu entfernen, führte zu gereizten Atemwegen und zu einem Aussehen, das
damals von einem Fotographen nie gezeigt worden wäre. Denn schwarz
gefärbte Lokführer sah man nie vor der Kamera. Als letzte Handlung war dann noch die Ergänzung der Vorräte ausstehend. Die für die Verbrennung benötigten Kohlen wurden bei Ankunft ins Depot ergänzt. Auch Wasser wurde aufgefüllt. Nur wenn die
Lokomotive in den Unterhalt musste, wurde weder
Kohle
ge-bunkert, noch das Wasser ergänzt. Zudem wurde nun auch das Feuer in die
Schlackengrube
entlassen. Mit der Restwärme konnte dann noch zum Park-platz gefahren
werden. Dort angekommen war dann
Feierabend,
den sich, wie wir nach diesen Zeilen leicht erkennen können, das
Lokomotivpersonal
verdient hatte. Dabei war der Einsatz auf den Maschinen dieser beiden
Baureihen noch einfach und auch mit einem gewissen Ansehen versehen. Bei
den schweren Maschinen des
Güterverkehrs
sah es dann etwas anders aus. Aber dort sind wir noch nicht und wir
sollten noch wissen, was geändert wurde. Zusammenfassend kann gesagt werden, der
hier beschriebene Vorgang war selten, denn die
Lokomotiven blieben auch während der
Stilllager unter Dampf. Ein als Reservefeuer bezeichnetes Feuer blieb
erhalten. Trotzdem beim benötigten Personal konnte so nicht viel gespart
werden, denn auch ein Reservefeuer musst zur rechten Zeit ausgebaut
werden. Lediglich der
Hilfsheizer
war nicht so lange an die Maschine gebunden.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2023 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Wenn
wir davon ausgehen, dass die
Wenn
wir davon ausgehen, dass die
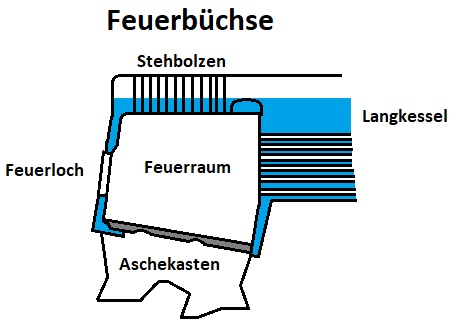 Wurde
das erste Feuer in der
Wurde
das erste Feuer in der 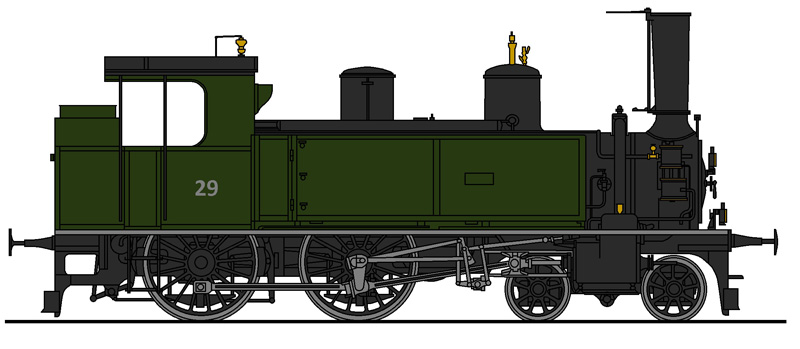 Die
Die
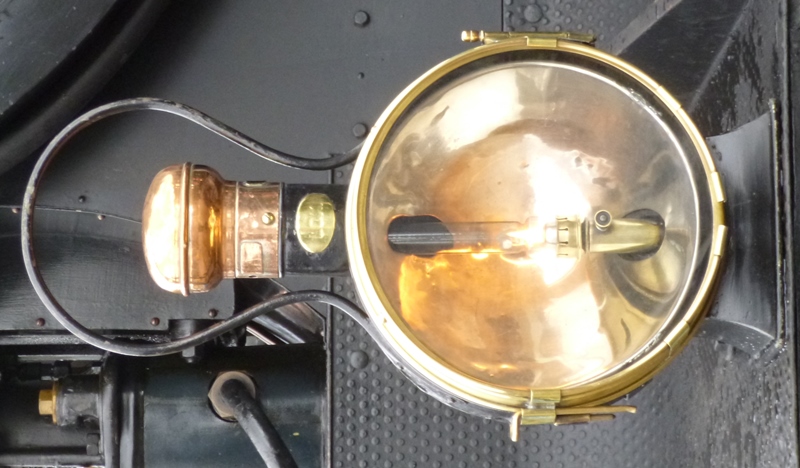 Es
handelte sich um einfache Laternen, die mit
Es
handelte sich um einfache Laternen, die mit
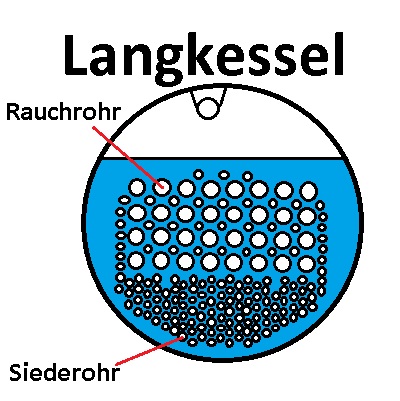 Je
nach den Einstellungen beim
Je
nach den Einstellungen beim
 Mit
den Modellen der Reihe BI wurde nun die Steuer-ung auf Neutral genommen,
der
Mit
den Modellen der Reihe BI wurde nun die Steuer-ung auf Neutral genommen,
der
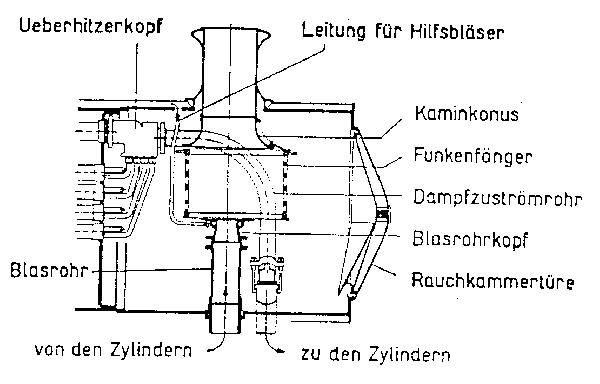 Um
die
Um
die