|
Betriebseinsatz Teil 1 |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Bei jeder
Lokomotive
beginnt der Betriebseinsatz mit einer
Inbetriebsetzung.
Die ersten Arbeiten erfolgten dabei meistens im Werk des Herstellers. Dort
wurden der
Kessel
und die
Antriebe
getestet. Ausgedehnte Fahrten waren jedoch nicht üblich. Das waren
Schritte, die von jeder bestellten Lokomotive absolviert werden mussten,
denn der Kessel musste bekanntlich eine behördliche Abnahme über sich
ergehen lassen.
Ein erster längerer Aufenthalt gab es an der
Gren-ze, denn die Maschine musste ja in die Schweiz eingeführt werden.
Damals war die zolltechnische Arbeit sehr genau. Nachdem die Maschinen offiziell eingeführt wur-den, konnten sie weiter fahren. Das Ziel jeder Lokomotive für die Gotthardbahn war der Bahnhof von Rotkreuz. Dort begann der Wirkbereich der
Bahngesellschaft
und so musste nun die Fahrt unter deren Regie weiter geführt werden. Damit
das auch rechtlich zu keinen Problemen führte, wurde das neue Fahrzeug an
diesem Ort offiziell übernommen. Es war nun im Eigentum der
Gotthardbahn. Die bestellten acht
Lokomotiven
wurden im Lauf des Jahre 1882 ausgeliefert und sofort in Betrieb genommen.
Das war zu einer Zeit, wo die Arbeiten an der neuen Strecke nahezu
abgeschlossen waren. Seit dem ersten Januar fanden überall die ersten
Probefahrten
statt. Lediglich der
Scheiteltunnel verfügte über einen Verkehr, der regelmässig erfolgte
und bei dem auch die ersten Reisenden mitfahren durften. Im Rahmen dieser
Versuchsfahrten
gelangten die
Lokomotiven
ins Tessin. Dort mussten sofort die Schulungsfahrten beginnen, denn es war
wirklich ein grosser Zeitdruck vorhanden. Mit dem Abschluss der Arbeiten
begann der Verkehr und da sollte das
Lokomotivpersonal
schon wissen, wie mit der neuen Lokomotive gearbeitet werden musste.
Dampflokomotiven verlangten nach einer grossen Erfahrung, denn nur so
arbeiteten sie wirtschaftlich.
Obwohl die Eröffnungszüge in der fe-sten Hand der Baureihe C waren, konnten die Modelle CI auch etwas leisten. Damit war nun auch die Zu-teilung erfolgt. Die Maschinen waren dem
Depot
Bel-linzona zugeteilt worden und das ent-sprechende
Lokomotivpersonal war den im
Titularsystem
betrieben Ma-schinen zugeteilt worden. Mit der Betriebsaufnahme kamen die Maschinen in erster Linie südlich vom Depot Bellinzona zum Einsatz. Dort bespannten sie die Reisezüge über die Rampe des Monte Ceneri und gelang-ten so auch über die ehemalige Tes-siner Talbahn an die Grenze von Chiasso. Der Vorrat bei der
Kohle
reichte dabei durchaus für eine Fahrt, jedoch war das Wasser für die Fahrt
bis hoch nach Rivera-Bironico knappt bemessen worden. Wir müssen bedenken, dass die steile Strecke
viel Dampf benötigte und es auf der Fahrt von Giubiasco hoch keine
Möglichkeit gab, das wertvolle Wasser für den
Kessel
zu bekommen. Das Tessin war dafür bekannt, dass die Quellen oft nicht
ergiebig genug waren. Im Bereich der
Rampe
gab es diese zwar, aber es war kein
Bahnhof
vorhanden. Die grossen
Wasserkästen
der Reihe CI waren die direkte Folge dieser Tatsache. Neben den Reisezügen auf dem benannten
Abschnitt gehörten auch
Leistungen
als Vorspann-, oder
Schiebelokomotive
zum
Dienstplan.
Die acht
Lokomotiven
waren damit sehr gut ausgelastet. Oft fehlte dann eine Maschine, die den
Güterzug
in Biasca hätte abholen können. Der Bestand war als sehr knapp bemessen
worden. Oft fuhren dann die Maschinen vom Gotthard mit dem Güterzug nach
Luino, oder gar nach Chiasso.
Da diese mit dem gleichen Kesseldruck
versehen waren und dabei auch die gleichen
Dampfmaschinen
verbaut wur-den, konnte ein direkter Ver-gleich angestellt werden. Wir
wollen diese Vergleiche anstellen und so die Vorteile erkennen. Auf den steilen Abschnitten am Monte Ceneri war es der Tenderlokomotive leicht möglich rund zehn Tonnen mehr Anhängelast zu ziehen. Der Grund lag in erster Linie darin, dass kein Tender mitgeführt werden musste. Die Baureihe CI war daher eine durchaus gelungene Lokomotive. Einzig beim Personal gab es Probleme, denn
dieses war dem Kohlenstaub sehr stark ausgesetzt und im Sommer mel-dete
dieses sehr hohe Temperaturen. Es zeigte sich, dass die acht Ma-schinen gut
waren, aber dem Betrieb längst nicht mehr gewachsen waren. Es mussten mehr
Exemplare her. Nach nur wenigen Wochen im planmässigen Einsatz sollten
weitere vier Maschinen bestellt werden. Diesmal sollten diese aber nicht
mehr aus Esslingen, sondern aus Winterthur kommen. Die Schweizerische
Lokomotiv- und Maschinenfabrik SLM hatte sich auch bei der
Gotthardbahn durchsetzen können. Die vier nachbestellten Maschinen der
Baureihe CI kamen im Jahre 1883 in Betrieb. Damit waren nun zwölf
Exemplare vorhanden, die am Monte Ceneri gute Arbeit verrichten konnten.
Neben den
Reisezügen gehörten auch die Vorspannleistungen und
die Einsätze als
Schiebelokomotive
immer noch in den
Dienstplan
dieser guten Maschinen. Dass nicht mehr davon bestellt wurden, lag nicht
an der Baureihe sondern beim
Güterverkehr.
Die kleineren Modelle verloren den
Güterverkehr
auf den flachen Abschnitten und so reichte der Bestand ohne grosse
Probleme aus. Sie sehen, dass es in den Jahren wirklich nur in einem
Bereich ein grosses Wachstum gab. Auch wenn man bei der Gotthardbahn mit den Lokomotiven sehr zu frieden war, sie hatten auch Probleme. So zeigten sie ein unruhiges Lauf-verhalten, das sich in einem Intensiven Unterhalt bei den Radsätzen zeigte. Die noch neuen
Lokomotiven
mussten mit Problemen bei den
Spurkränzen
die
Hauptwerkstätte
aufsuchen. Es mussten deshalb Untersuchungen angestellt werden, das
Problem konnte man nicht anstehen lassen. Ein weiteres Problem waren die mitgeführten
Vorräte. So reichte das Wasser für die lange Strecke von Giubiasco nach
Rivera-Bironico nur knapp aus. Der etwas grössere Vorrat bei den Maschinen
im Nachbau brachte auch keine merkliche Besserung. Damit war schnell klar,
es sollte keine weiteren Modelle mehr geben. Die Strecke über den Monte
Ceneri benötigte alleine wegen den mitgeführten Vorräten einen
Tender. Schon nach einem kurzen Einsatz war die
Lösung für ein Problem bei den zwölf Maschinen gefunden. Diese Maschinen
zeigten bei gewissen Geschwindigkeiten starke Vibrationen, die der
Laufruhe nicht förderlich waren. Das Problem war der etwas zu schwache
Rahmen. Daher wurde der
Plattenrahmen
an einigen Stellen verstärkt. Diese Massnahme brachte den Erfolg, auch
wenn die Modelle nun bei den Lasten sehr nahe beim Limit waren.
Eine Arbeit, die in diesen Bereich gehörte
und der nicht nur
Revisionen
umfasste. Manchmal mussten auch kleinere Umbauten vorgenommen werden. Die
nun ruhig laufenden
Lokomotiven
waren daher ein sehr gutes Zeugnis für die Leute in der
Hauptwerkstatt. Deutlich mehr Mühe hatte das Lokomotivpersonal mit den nun ruhig laufenden Maschinen. In den vergangenen Jahren hatte dieses sich an das Gerüttel gewöhnt und es wusste genau, wie schnell bei bestimmten Schwingungen gefahren wurde. So musste nicht immer gerechnet werden. Man
fuhr nach Gefühl und das konnte trügerisch sein, wenn die
Loko-motive
plötzlich einen ruhigen Lauf an den Tag legte. Die Folgen waren klar. Während es immer wieder zu Überschreitungen bei den Geschwindigkeiten kam, zeigten die Massnahmen bei den Spurkränzen grosse Erfolge. Das
Lokomotivpersonal wurde daher zu mehr
Disziplin angehalten. Eine Kontrolle, ob dieses sich daran hielt, gab es
nicht. Ein durchaus gefährliches Problem, denn ein zu schnell fahrender
Zug konnte leicht entgleisen und gerade am Ceneri schnell den Hang hinab
stürzen. Wenn wir nach wenigen Jahren in die
Dienstpläne
sehen, erkennen wir schnell, dass die Arbeiten gut verteilt wurden. Die
Baureihe CI fand sich dabei in erster Linie vor den Personen- und
Schnellzügen
auf der Strecke über den Monte Ceneri. Vereinzelt waren aber auch noch
Güterzüge
auf den flachen Abschnitten vorhanden. Als Füller waren dann noch die
Hilfsdienste eingebaut worden. Die Gemischtzuglokomotive machte ihrem
Namen alle Ehre.
Die knapp bemessene Zahl von
Loko-motiven
wurde daher so gut es ging eingesetzt. Keine der beiden Baurei-hen konnte
sich daher über mangelnde Arbeit beklagen. Als im Jahre 1885 die ersten Versuche mit der neuen Vakuumbremse began-nen, waren die Modelle der Reihe CI nicht eingebunden worden. Es waren zu Beginn nur
Versuchszüge
im Einsatz und dazu waren wenige
Lokomotiven
angepasst worden. Als dann jedoch die betrieblichen Ver-suche mit den
Reisezügen aufgenom-men wurden, musste diese
Bremse
auch bei den hier vorgestellten Maschinen eingebaut werden. Spannend dabei war, dass nicht alle Maschinen
damit ausgerüstet wurden. Die Dienste mussten daher so geändert werden,
dass die Modelle ohne
Vakuumbremse
vermehrt vor
Güterzügen
eingesetzt wurden. Gerade die Güterzüge von Bellinzona nach Luino waren
dort enthalten. Eine Strecke, die mit einer
Tenderlokomotive
ohne grosse Probleme befahren werden konnte. Es gab erst mit dem Abbruch
der Versuche wieder eine Bereinigung. Nach einem Einsatz von fünf Jahren begann die
Gotthardbahn mit ersten grundlegenden Veränderungen. So kamen neue
Bezeichnungen, weil diese nun nach einem Abkommen mit den anderen
Privatbahnen
erfolgen sollte. Aus der Reihe CI wurde so die neue Baureihe B3. An den
Einsätzen änderte sich damit jedoch nicht viel. Jedoch sollten auch diese
nun für das
Lokomotivpersonal leichter zu fahren
sein, den der neue
V-Messer
registrierte die Daten.
Das wirkte sich auf den Betrieb aus, da nun
die Sicherheit deutlich erhöht werden konnte. Die
Registrierung
sorgte zudem dafür, dass sich das Personal auch daran hielt. 1887 war zudem auch das Problem mit den bitterkalten Personenwagen im Winter gelöst worden. Die Gotthardbahn führte bei den Reisezügen die Dampfheizung ein. Wer dort eingesetzt wurde, bekam diese
Heizung
und musste sich die Arbeiten gefallen lassen. Die Reihe B3 gehörte dazu,
auch wenn eigentlich nur die
Zuglokomotive
heizen musste. Der Bestand war so knapp, dass die
Dienstpläne
schlicht nicht bereinigt werden konnten. Wenn die Lokomotive schon gerade in der Hauptwerkstätte war, wurde bei denen, die damit ausgerüstet worden waren, die Bauteile für die Vakuumbremse wieder ausgebaut. Der Betrieb damit war zu umständlich und die grossen Diffe-renzen bei der Höhe führten immer wieder zu Problemen mit den Bremsen. Der Versuch musste daher abgebrochen werden.
Eine andere Lösung gefiel der
Gotthardbahn deutlich besser. Nur ein Jahr später begannen die Versuche mit
der
Westing-housebremse.
Nach den Erfahrungen mit der
Vakuumbremse
wurden nur wenige
Lokomotiven
angepasst. Verkehrten die Wagen mit einer Lokomotive, die nicht über die
Bremse
verfügte, wurde jene der Wagen einfach ausgelöst und die
Handbremse
mit einem
Bremser
besetzt. Schon konnten die Wagen auch von der Reihe B3 gezogen werden. Ein
Umbau stand daher nicht an.
Damit war nun auch klar, dass mehr Modelle
mit den Bauteilen versehen wurden. Da zuerst die
Reisezugwagen
vorgesehen waren, wurde auch die Reihe B3 in die
Hauptwerkstätte
ge-rufen. Sie sollten nun auch die
Druck-luftbremse
bekommen. Mit dem Einbau der Westinghouse-bremse veränderte sich das Erschein-ungsbild der Lokomotiven. Besonders gut zu erkennen war hier der Luft-behälter, der auf dem Kessel montiert wurde Diese zeigten jedoch, dass der Platz hier
knapp bemessen war. Auswirkungen hatte das nun aber auch auf die
Achslasten.
Die
Triebachsen
lagen nun bei den erlaubten 16 Tonnen. Auf die
Adhäsion
hatte das jedoch nur einen geringen Einfluss. Ein neuer Anstrich kam nun auch zur
Anwendung. Dieser orientierte sich an der nagelneuen
Lokomotive
D6. Diese Monster hatte nun vier
Dampfmaschinen,
und sie nutzte dank dem
Verbund
den Dampf doppelt. Das musste sie, weil bei der
Tenderlokomotive
der
Kessel
eine geringe Grösse hatte. Ein Problem, waren nun die erlaubten
Achslasten.
Das endgültige Todesurteil, denn nun war endgültig klar, von der Reihe B3
sollte es nicht mehr Modelle geben. Das Problem der
Tenderlokomotiven
bestand darin, dass sich der mitgeführte Vorrat auch auf dem Fahrzeug
befand. Ein paar Tonnen
Kohle
und etwa die dreifache Menge Wasser sorgten für sehr viel Gewicht. Das
musste an anderer Stelle gespart werden. Bei der Reihe
D6 war das der
Kessel,
bei der Reihe B3 waren es die Vorräte, die sehr knapp bemessen werden
mussten. Beide hatten aber sehr hohe
Achslasten.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2023 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
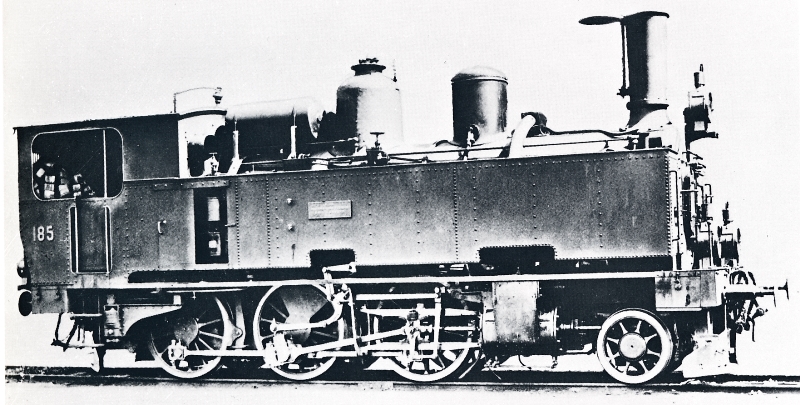 Die
ersten bei der Maschinenfabrik Kessler in Ess-lingen gebauten und
geprüften
Die
ersten bei der Maschinenfabrik Kessler in Ess-lingen gebauten und
geprüften
 Es
gelang, dass die acht Maschinen aus Esslingen pünktlich zu Eröffnung der
Linie am 01. Juni 1882 verfügbar waren.
Es
gelang, dass die acht Maschinen aus Esslingen pünktlich zu Eröffnung der
Linie am 01. Juni 1882 verfügbar waren. Die
Gemischtzuglokomotive musste sich dabei nicht vor den grossen Mo-dellen
verstecken. Wegen dem gerin-gen Bestand, mussten am Monte Ceneri auch die
Maschinen der Reihe
Die
Gemischtzuglokomotive musste sich dabei nicht vor den grossen Mo-dellen
verstecken. Wegen dem gerin-gen Bestand, mussten am Monte Ceneri auch die
Maschinen der Reihe  Dieser
hatte in den wenigen Jahren so zuge-nommen, dass mit den
Dieser
hatte in den wenigen Jahren so zuge-nommen, dass mit den
 Ausgeführt
wurden die Arbeiten in der eigenen Werk-stätte. Jene der
Ausgeführt
wurden die Arbeiten in der eigenen Werk-stätte. Jene der
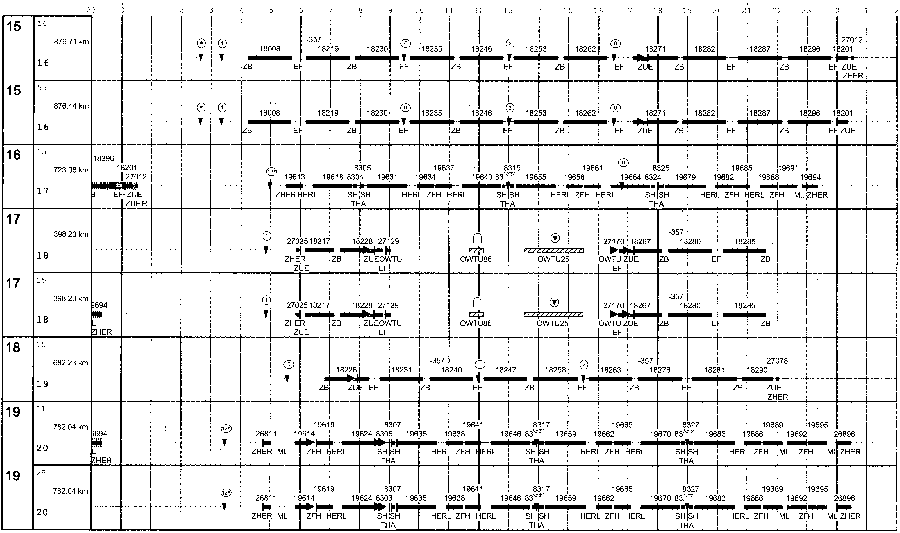 Immer
wieder kam es auch zu We-chseln, denn die Maschinen der Reihen CI und
Immer
wieder kam es auch zu We-chseln, denn die Maschinen der Reihen CI und
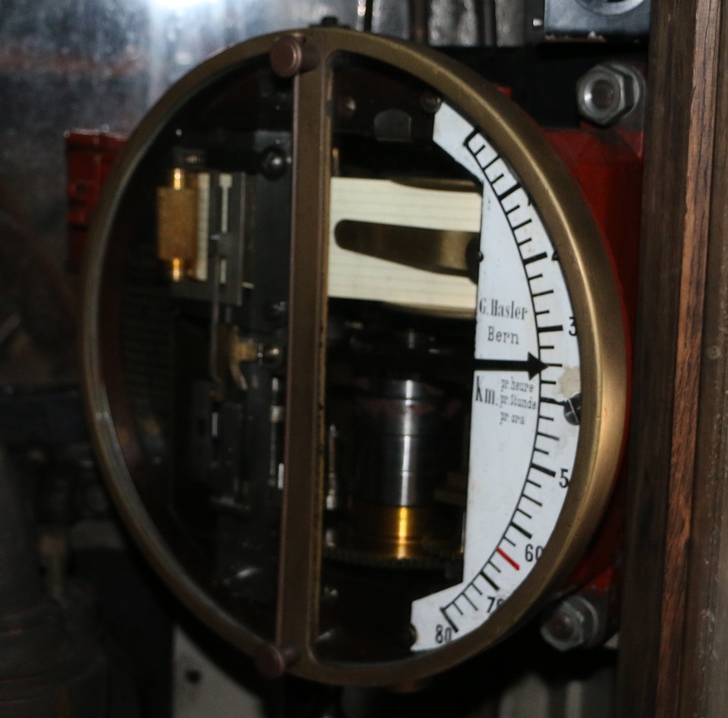 Damit
führte die
Damit
führte die
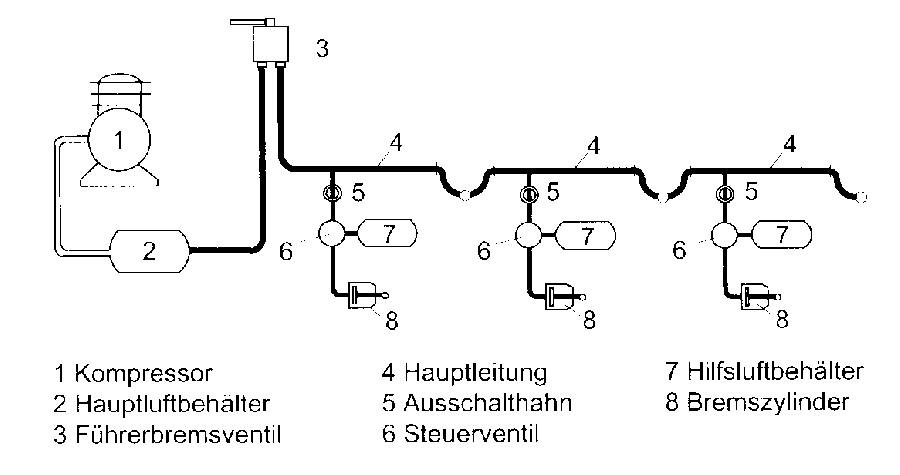 Wie
gut diese
Wie
gut diese