|
Dampfmaschine mit Steuerung |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Der im
Kessel
durch das Feuer erzeugte Dampf sammelte sich, wie wir zuvor bereits
erfahren haben, im
Dampfdom.
Der hier enthaltene
Nassdampf
wurde in erster Linie von den
Dampfmaschinen
genutzt. Dazu war am Dampfdom ein
Regulator
vorhanden. Dieser konnte aus dem
Führerhaus
mit einer
Schubstange
geöffnet werden. So wurde der unter Druck stehende Dampf durch die
Dampfrohre zu den beiden Dampfmaschinen geführt.
Zwischen diesen beiden Maschinen gab es nur
einen Unterschied, den wir uns rasch ansehen müssen. Wegen dem
Stangenantrieb
und den beiden dort vorhandenen Totpunkte, mussten die beiden Ma-schinen
mit einem
Versatz
versehen werden. Bei Lokomotiven mit zwei Zylindern war der Ver-satz immer auf 90° festgelegt worden. Das hatte zur Folge, das nie beide Seiten beim Totpunkt sein konnten. Die Fahrrichtung konnte daher jederzeit korrekt eingestellt werden. Wer es genau nehmen will, der sollte
eigentlich noch wissen, dass die linke
Dampfmaschine
der Rechten nachlief. Genau diese rechte Maschine wollen wir uns nun etwas
genauer ansehen. In die Dampfrohre wurde der
Nassdampf
über den Schieberregulator geregelt geleitet. Je nach der erfolgten
Öffnung strömte mehr oder weniger Dampf durch das Rohr. Dabei endete
dieses Dampfrohr bei der unter dem
Wasserkasten
verbauten
Dampfmaschine.
Genau genommen, waren das die
Schieber,
die je nach der Stellung des
Antriebes
den Zugang zum
Zylinder
regelten. Der
Schieberkasten
befand sich daher über dem
Dampfzylinder. Mit den
Schiebern
wurde die Zufuhr des Dampfes in den
Zylinder
geregelt. Dabei strömte diese durch das Bauteil in den Bereich hinter dem
Kolben.
Durch den Druck desselben wurde die
Schubstange
aus dem
Dampfzylinder
gestossen und so der
Antrieb
in Bewegung versetzt. Abgeschlossen wurde dieser Vorgang erst, wenn der
Kolben den anderen Endpunkt erreicht hatte. Danach erfolgte der gleiche
Vorgang in der anderen Richtung.
Der maximal mögliche Kolbenhub wurde
hingegen mit 640 mm angegeben. Diese Werte entsprachen den Modellen, wie
sie bei der Baureihe C eingebaut wurden.
Das hatte nun auch Auswirkungen auf die verfügbare
Leistung. Maximal konnte in den beiden Dampfmaschinen, bei einem Dampfdruck von zehn bar, eine Leistung von 368 kW, oder 500 PS abgerufen werden. Damit hatte die Maschine für eine Tenderlokomotive eine ausgesprochen hohe Leistung erhalten. Im Vergleich zu den vergleichbaren
Lokomotiven
der Bau-reihe C ergab das in diesem Punkt
keinen Unterschied, so dass die Maschine CI dank dem geringeren Gewicht
mehr
Anhängelast
ziehen konnte. Hatte der Dampf seine Arbeit getan und
wurde die
Dampf-maschine
umgesteuert. Sorgte der nun auf der anderen Seite einströmende
Nassdampf
dafür, dass der zuvor benutzte Dampf aus dem
Zylinder
in ein weiteres Dampf-rohr geleitet wurde. Dieses wiederum endete in der
Rauchkammer
in einem
Blasrohr,
das den Abdampf direkt in den
Kamin
entliess. Da dies stossweise erfolgte, sprach man oft auch von
Auspuffschlägen. Beim hier verwendeten Aufbau mit einer
einfachen Ausnutzung des Dampfes erfolgten pro Umdrehung des
Rades
vier Auspuffschläge, die in gleichmässigem Abstand erfolgten. Es muss
jedoch erwähnt werden, dass die Intensität dieser Schläge mit zunehmender
Belastung verstärkt wurde. Die voll ausgelastete Maschine war daher von
weit zu hören und daher konnte nicht von einer leisen
Lokomotive
gesprochen werden.
So war gesichert, dass die Zufuhr des
Dampfes in den
Zylinder
immer korrekt erfolgte. Doch bei der Ausführung der hier verbauten
Steuerungen gab es zwischen den einzelnen
Lokomotiven
dieser Baureihe einen Unterschied zu beachten. Gemeinsam war, dass die Steuerung nur auf der rechten Seite vorhanden war. Diese Lösung reichte durchaus und so konnten auch die Kosten verringert werden. Steuerungen waren teuer, da die Herstellung
einen grossen Aufwand be-deutete. Die
Schieber
der linken
Dampfmaschine
wurden mit einer einfachen Stange so umgesetzt, dass der
Versatz
eingehalten werden konnte. Eine nach-trägliche Verstellung war daher nicht
mehr möglich. Bei den Lokomotiven mit den Nummern 81 bis 88 kam eine Heusinger-steuerung zur Anwendung. Die von der SLM gebauten Maschinen besassen jedoch eine Steuerung der Bauart Walschaerts. Dabei konnten die Unterschiede
vernachlässigt werden und bei der
Gotthard-bahn wurde, wie das in der Schweiz durchaus üblich war,
bei allen zwölf
Lokomotiven
von einer
Walschaertssteuerung
gesprochen. Uns sollte aber die Funktion mehr interessieren. Mit der Steuerung wurde über eine
Schubstange
aus dem
Führerhaus
die Zufuhr des
Nassdampfes
über die Füllmenge geregelt. Dabei arbeiteten die Steuerungen sehr präzise
und sie erlaubten den beiden
Dampfmaschinen
einen flüssigen Lauf. Das war für eine vor
Reisezügen
eingesetzte
Lokomotive
von grosser Wichtigkeit und daher kamen hier auch die sehr teuren, aber
guten Lösungen nach
Walschaerts
und
Heusinger
zum Einbau.
So konnte neben der Füllzeit und damit der
Leist-ung,
auch die Richtung der Bewegung verändert werden. Daher diente diese
Schubstange
auch zur Wahl der Fahrrichtung. Die
Lokomotive
konnte dank der stufenlosen Verstellung sehr feinfühlig bedient werden. Die Dampfmaschinen dieser Baureihe konnten auch anders genutzt werden, als wir das bisher erfahren haben. Stand eine Talfahrt an, wurde im Zylinder ein gegen die Laufrichtung aufgebauter Dampfdruck aufgebaut. Bei dieser
Gegendruckbremse
wurde so der Lauf der
Dampfmaschine
gehemmt und die
Lokomotive
verzögert auf Grund des erhöhten
Widerstandes.
Eine ausgesprochen wirksame
Bremse,
die den Einsatz der
Bremsklötze
verringerte. Da beim Einsatz der
Gegendruckbremse
und bei einem längeren Stillstand in den
Hochdruckzylindern
Wasser entstehen konnte, musste dieses aus dem Bauteil entfernt werden.
Dazu wurden unten am
Zylinder
die entsprechenden
Schlemmhähne
eingebaut. Wurden diese geöffnet, stiess der Dampf das Wasser aus dem
Zylinder und somit ins Freie. So war ein sicherer Betriebs der
Dampfmaschine
jederzeit gewährleistet. Wir haben die
Lokomotive
nun fertig aufgebaut. Es wird nun Zeit, wenn wir uns deren Gewicht genauer
ansehen. Dabei galt bei Dampflokomotiven, dass diese immer betriebsbereit
gewogen wurden. Hier bedeutete das, dass sowohl die
Kohle,
als auch das Wasser vorhanden waren. Ergänzt wurden diese mit den
notwendigen Werkzeugen. Doch auch so gab es innerhalb der Serie grössere
Unterschiede, die wegen veränderter Vorräte entstanden.
Damit hatte jede
Triebachse
eine
Achslast
von ungefähr 15 Tonnen erhalten. Wobei die
Achsen
nicht ausgeglichen waren. Für die
Laufachse
dieser
Lokomotiven
war mit zwölf Tonnen ein recht hoher Wert vorhanden. Damit waren die Modelle mit den Nummern 81 bis 88 recht schwere Lokomotiven und sie wurden noch durch die Modelle aus dem Hause SLM übertroffen. Bei den Nummern 89 bis 92 wurde das Gesamtgewicht auf 57.8 Tonnen erhöht. Das war teilweise wegen dem grösseren
Wasservorrat bedingt, jedoch auch durch die baulichen Veränderungen
begründet. Das höhere Gesamtgewicht, hatte auch Aus-wirkungen auf die
anderen Lasten. So wurde bei den Modellen der SLM ein
Adhäsionsgewicht
von 47.7 Tonnen erreicht. Das war eine deutliche Steigerung der
Achslasten
auf 15.9 Tonnen. In Anbetracht, dass damals die Strecke nur für 16 Tonnen
ausgelegt worden war, ein sehr hoher Wert. Jedoch konnte hier mit knapp
über zehn Tonnen die Achslast der
Laufachse
verringert werden. Die Nummern 89 bis 92 nützten daher das vorhandene
Gewicht besser aus. Damit waren die
Lokomotiven
der Baureihe CI, die in Winterthur gefertigt wurden, die schwersten
Maschinen der
Bauart
Mogul, die es je geben sollte. Nur schon diese Tatsache zeigt, mit was für
einer aussergewöhnlichen
Tenderlokomotive
wir es hier zu tun haben. Die Baureihe CI konnte es also ohne Probleme mit
den Maschinen mit
Schlepptender
aufnehmen. Die Baureihe C der
Bahngesellschaft
ist zum Vergleich ideal, da sie nahezu gleich war.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2023 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
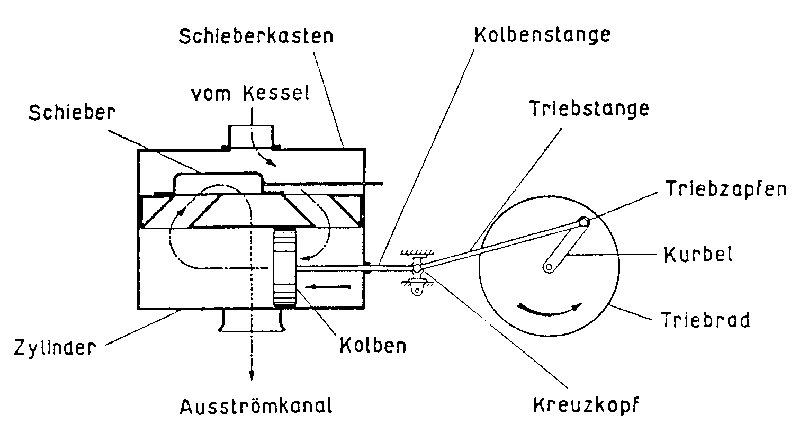 Wie
bei den
Wie
bei den
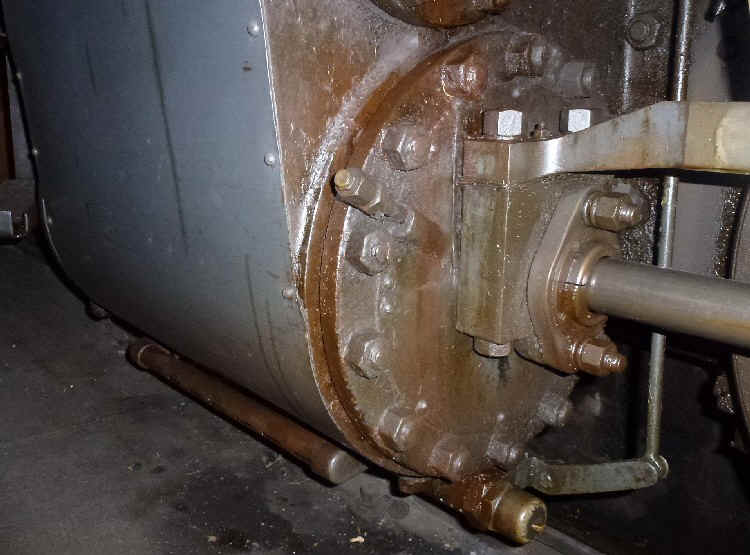 Um
die Eckwerte eines
Um
die Eckwerte eines
 Die
hier vorgestellte
Die
hier vorgestellte
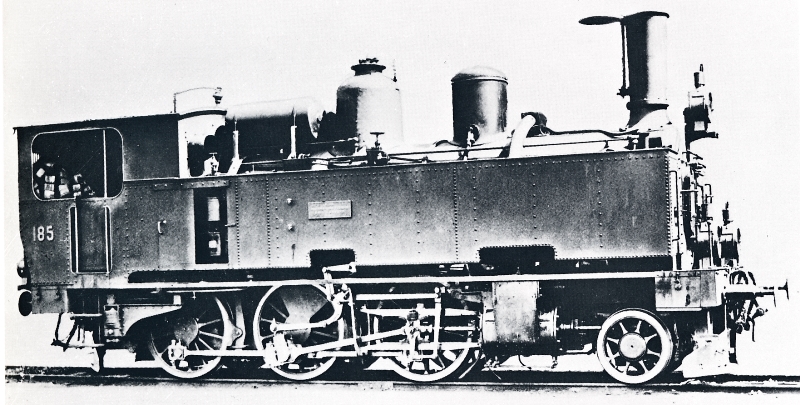 Mit
Hilfe der
Mit
Hilfe der
 Beginnen
wir die Bestimmung der Gewichte mit den Maschinen aus Esslingen. Diese
hatten ein Gewicht von 56.8 Tonnen erhalten. Für das
Beginnen
wir die Bestimmung der Gewichte mit den Maschinen aus Esslingen. Diese
hatten ein Gewicht von 56.8 Tonnen erhalten. Für das