|
Bedienung der Lokomotive |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Grundsätzlich unterschiedlich war die Bedienung
dieser Lokomotiven
nicht. Auch bei den
Dampfmaschinen machten die
Hersteller nicht neue Experimente. So musste der
Regulator und die
Steuerung bedient werden. Ob nun dazu Hebel, oder
Handräder verwendet
wurden, war eher nebensächlich. Je nach Ausrüstung wurde dann mit der
Steuerung, oder dem Regulator gefahren. Meistens war das vom Hersteller
abhängig.
Neben den beiden Personen des
Lokomotivperso-nals, waren dazu noch Helfer in den
Depots
vor-handen. Hersteller
unterhielten damals meist auch solches Personal für die Prüfungen. Bevor überhaupt mit der Arbeit begonnen werden konnte, mussten die Vorräte auf der Lokomotive ergänzt und der Kessel vorbereitet werden. Über den Ablassstutzen konnte Wasser direkt in den Kes-sel gefüllt werden. Das war ohne Probleme möglich, da dieser ja noch
nicht unter Druck stand und so einfach ein Behälter gefüllt wurde. Das
galt auch für die beiden
Wasserkästen, denn Wasser wurde in der ersten
Phase benötigt. Bei den
Wasserkästen konnte das Wasser mit den
üblichen
Wasserkränen eingefüllt werden. Dazu war auf beiden Seiten ein
mit einem Deckel verschlossenes Einfüllloch vorhanden. Da die beiden
Kästen mit einem Rohr verbunden wurden, reichte es, wenn man nur auf einer
Seite Wasser in die Kästen füllte. Das Rohr sorgte zudem dafür, dass die
Radlasten der einzelnen
Achsen immer ausgeglichen waren. Auch Brennmaterial wurde benötigt. Das war in erster
Linie die
Kohle, die verladen wurde. Dabei zeigte sich bei den Nummern 81
bis 88 eine kräftige Staubwolke im
Führerstand. Diese sollte dafür sorgen,
dass bei der Nachbestellung das
Kohlenfach
verändert wurde. Sie sehen, der
konstruktive Fehler war schnell zu erkennen und trotzdem gab es keine
Anpassungen während der Lieferung der ersten Maschinen, der Grund lag bei
den Kohlen.
Beim Hersteller ging man daher davon aus,
dass bei den
Briketts
die Belastung mit dem Kohlenstaub ge-ringer sein
würde. So sah man keinen Grund für Än-derungen am Aufbau. Mit Kohle allein ist es nicht möglich ein Feuer zu ent-fachen. Mit den ersten Flammen war noch nicht genug Hitze vorhanden, dass die Kohle sofort in Brand ge-raten würde. Daher wurde zuerst mit Holz gearbeitet. Kleine Holzbalken, die oft aus den Abschnitten beim Bau von
Wagen stammten, wurden mit einem Lappen, der in
Petrol getränkt wurde, in
Brand gesteckt. Wo solche Abfälle nicht vorhanden waren, kamen auch
Reisigbündel zum Einsatz. Allgemein kann behauptet werden, dass dieses
An-feuerholz nicht angekauft wurde. Entweder kamen Ab-schnitte aus der
Schreinerei, oder Bündel mit Schnittgut aus den Anlagen zum Einsatz. Man
nahm einfach das, was man finden konnte, denn viel wurde gar nicht
benötigt. Der Grund war, dass bei einem ansprechenden Feuer auch grössere
Holzstücke verbrannt werden konnten. Diese stammten nicht selten aus
Einkäufen. Für das mit
Holz
aufgebaute Feuer reichte die
natürliche Strömung im
Kessel aus. Beim Einsatz der
Kohlen sollte die
Strömung aber stärker sein. Daher wurde eine
Anfachlanze benutzt. Diese
simulierte mit Dampf, oder
Druckluft aus der Werkstatt den Abdampf der
Maschinen. So wurde die Strömung verstärkt und das Feuer konnte mit den
ersten Kohlen ausgebaut werden. Ein Vorgang, der oft mehrere Minuten
dauern konnte.
Ein Vorgang, der
durchaus mehrere Stunden dauern konnte, denn es war schwer, genug Druck zu
be-kommen. Der Grund waren die Metalle, die auch noch erwärmt wurden. In dem Moment, wo im Kessel ein genug grosser Druck vorhanden war, konnte in der Rauchkammer der Hilfsbläser aktiviert werden. Damit wurde die Anfachlanze entfernt. Die
Lokomotive
war nun frei, konnte
aber noch nicht eingesetzt werden, denn bei der ersten In-betriebnahme
eines
Kessel
durfte man die Fahrt gar noch nicht beginnen. Der Grund war,
dass die Kes-sel zuerst behördlich abgenommen werden muss-ten. Der
Kesselinspektor prüfte die Bauteile auf Schäden
und er hatte auch die Erlaubnis, an den
Sicher-heitsventilen Anpassungen
vorzunehmen. So wur-den diese eingestellt und der maximale Druck im
Kessel
auf einen Wert von zehn
bar
begrenzt. Erst wenn das stimmte, wurden die
Ventile
plombiert, denn sie durften im Betrieb nicht mehr verstellt
werden. Behördliche Kontrolle sorgten zudem für die Einhaltung. Nach der behördlichen Abnahme des
Kessels, konnten
die weiteren Arbeiten vorgenommen werden. Schon vor der Abnahme begann die
Vorbereitung des
Lager. Für deren
Schmierung mussten die Vorratsbehälter
gefüllt werden. In unseren Fall, wo noch kein
Öl vorhanden war, konnte
durchaus viel
Schmiermittel benötigt werden. Daher machte diese Arbeit ein
als Schmierer bezeichneter Arbeiter und der hatte schon früh Hilfsmittel.
Daher auch das separate
Personal in den Werkstätten.
Hilfsheizer und Schmierer wurde daher erst
kurz vor dem Beginn der Fahrt durch den
Heizer
und den Lokführer abgelöst.
Diese hatten nun die Aufgabe, die restlichen Arbeiten an der Maschine
vorzunehmen. Eine der vom Lokomotivpersonal ausgeführten Arbeiten, war die Erstellung der korrekten Beleuchtung. Dazu muss gesagt werden, dass die dazu benutzten Laternen nicht zum Fahrzeug gehörten. Vor der Fahrt
mussten diese deshalb in der
Lampisterie bezogen werden. Dank dieser
Lösung, war gesichert, dass die Lampen der
Lokomotive
immer für den
Betrieb vorbereitet waren. Wichtig war das bei Fahrten in der Nacht und
bei langen
Tunnel. Wie bei allen Lokomotiven wurden Karbidlampen verwendet. Bei diesen wurde das feste Kalziumkarbid mit der Hilfe von Wasser aufgelöst. Durch die chemische Reaktion entstand Acetylengas, das dann entfacht werden konnte. Diese Lampe gab ein helles weissliches Licht
ab, das jedoch gerade dazu geeignet war, ein paar Meter zu erhellen. Die
Lampen der
Lokomotive
dienten deshalb mehr der Signalisation, als der
Beleuchtung. Für die zahlreichen Signalbilder einer Lokomotive wurden mindestens vier Laternen benötigt. Drei davon waren an der Spitze anzubringen. Dazu waren über den beiden Puffern die Hal-terungen vorhanden. Die dritte Lampe an der Spitze fand ihren Platz über der
Türe zur
Rauchkammer
in der Mitte. Es entstand so ein
Signalbild, das einem Dreieck glich. Die
vierte
Karbidlampe wurde auf der anderen Seite hinten rechts aufgesteckt. Bei allen vier Lampen wurden in einem Fach die damals benötigten Vorsteckgläser mitgeführt. Da die Lampen jedoch bei Tag nicht angezündet wurden, mussten in dem Fall für die Signalbilder spezielle Scheiben verwendet werden. Im Gegensatz zu den Lampen, wurden diese immer
auf der
Lokomotive
mitgeführt und ge-hörten daher zum Inventar. Doch damit
sind die vielen Arbeiten vor der Fahrt bereits abgeschlossen. Um mit der Fahrt zu beginnen, musste zuerst die
Steuerung eingelegt werden. Damit wurde die Fahrrichtung der
Lokomotive
festgelegt. Aber je nach der Einstellung konnte auch die Füllmenge
verstellt werden. Es war Sache des Lokführers die richtigen Einstellung zu
finden. Da jede
Dampfmaschine ihre Eigenheiten hatte, wurden die
Dampflokomotiven im
Titularsystem
betrieben. So kannte das Personal
«seine» Lokomotive. Wurde der
Regulator geöffnet, strömte Dampf zu den
beiden Maschinen. Diese nahmen damit die Arbeit auf und wenn die
Handbremse
gelöst wurde, setzte sich die
Lokomotive
in Bewegung. Je nach
der Dampfmenge stand mehr oder weniger
Zugkraft zur Verfügung. Die volle
Leistung
konnte nur abgerufen werden, wenn alle Einstellung auf das
Maximum gestellt wurden. Oft erfolgte das erst, wenn schneller gefahren
wurde. Bei Beginn der Fahrt wurden zudem die
Schlemmhähne
geöffnet. So wurde allenfalls im
Zylinder befindliches Wasser
ausgestossen. Bei einer neuen Maschine entstand das Wasser sogar durch den
Dampf. Da die Metalle noch kalt waren, kühlte der Dampf so stark aus, dass
Wasser ausgeschieden wurde. Dieses konnte nur teilweise ausgestossen
werden. Mit den Schlemmhähnen trat das Kondensat jedoch zusammen mit Dampf
ins Freie.
In vielen Fällen, wurde der kritische Wert nicht erreicht,
trotzdem musste die Geschwindigkeit be-stimmt werden. Dem
Lokomotivpersonal blieb
da-her nichts anderes übrig, als die Werte zu be-rechnen. Es versteht sich von selbst, dass sehr oft nach Er-fahrung und Gefühl gefahren wurde. Bei einer ruhig laufenden Maschine konnten so leicht Übertret-ungen entstehen. Der Vorgesetzten blieb daher nur an die Vernunft der Arbeiter zu appellieren. Gerade die hier
vorgestellten
Lokomotiven
neigten zu einem ruhigen Lauf und daher waren oft
Über-tretungen vorhanden. Wir halten uns natürlich an die Werte. Stand eine längere Talfahrt an, wurde die
Gegen-druckbremse der Eine Eigenart der Dampflokomotiven war, dass diese
nur eine bestimmte Strecke befahren konnten. So wurde Wasser verbraucht,
das aber in jedem grösseren
Bahnhof nachgefüllt werden konnte. Schlimmer
war der Vorrat bei der
Kohle, denn diese
im
Endbahnhof konnte nur in einem
Depot
ergänzt
werden und wurde dieses aufgesucht, fanden auch andere Arbeiten und
eventuell der Besuch der
Drehscheibe statt. Wir
gehen nun davon aus, dass dieses Fahrzeug in den Unterhalt überstellt
wurde.
Im Fall, dass die Maschine in den Unterhalt musste, wurde auch
das Feuer in die Grube entlassen. In allen anderen Fällen wurde nur dessen
Grösse ver-ringert, was schon bei der Anfahrt zum
Depot er-folgen konnte. Neben diesen Arbeiten, die durchaus viel Staub aufwirbeln konnten, musste auch noch die Lösche aus der Rauchkammer entfernt werden. Das war jedoch eine unangenehme Arbeit. Mit dem
Öffnen der Türe fiel die Zirkulation der Luft aus. Die Kammer füllte sich
augenblicklich mit beis-sendem Rauch. In dieser Umgebung musste dann die
Lösche mit einer Schaufel in die Grube befördert werden. Die Fahrt zur Ergänzung der Vorräte und in die Werkstatt konnte durchaus in eigener Kraft erfol-gen. Die heissen Metalle erzeugten noch genug Dampf, dass die Lokomotive bewegt werden konn-te. Für
Arbeiten an der
Feuerbüchse
musste diese auskühlen und das dauerte oft
mehrere Tage. Doch auch dann war die Arbeit mit viel Schweiss verbunden,
denn man wartete nur, bis es nicht mehr gefährlich heiss war. Es bleibt zu sagen, dass die
Lokomotiven im Betrieb
immer unter Dampf waren. Bei einem längeren
Stilllager, wurde einfach das
Feuer reduziert und während dem Stillstand ein Reservefeuer unterhalten.
Diese Aufgabe wurde dann wieder durch das Personal der
Depots
wahrgenommen. Das
Lokomotivpersonal musste sich nur um die Lampen kümmern und
konnte dann in die Pause, oder in den
Feierabend wechseln. Wir haben die
Bedienung abgeschlossen.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2023 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
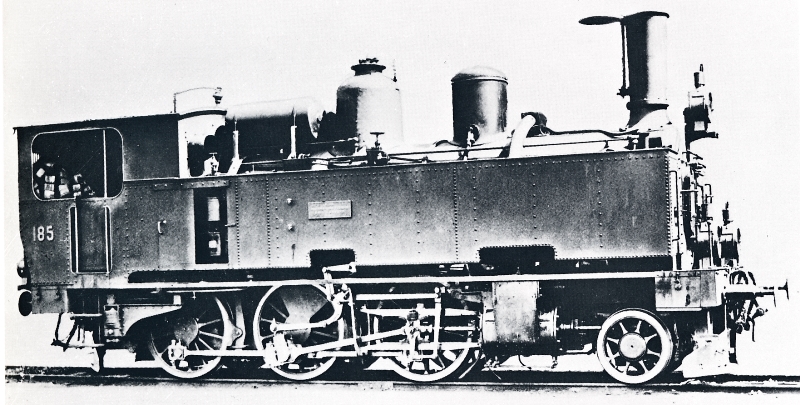 Wir wollen einfach wegen der Vollständigkeit die
Wir wollen einfach wegen der Vollständigkeit die
 Während bei den meisten Bahnen
Während bei den meisten Bahnen
 Durch den Wärmeeintrag des angefachten Feuers begann
sich das Wasser im
Durch den Wärmeeintrag des angefachten Feuers begann
sich das Wasser im
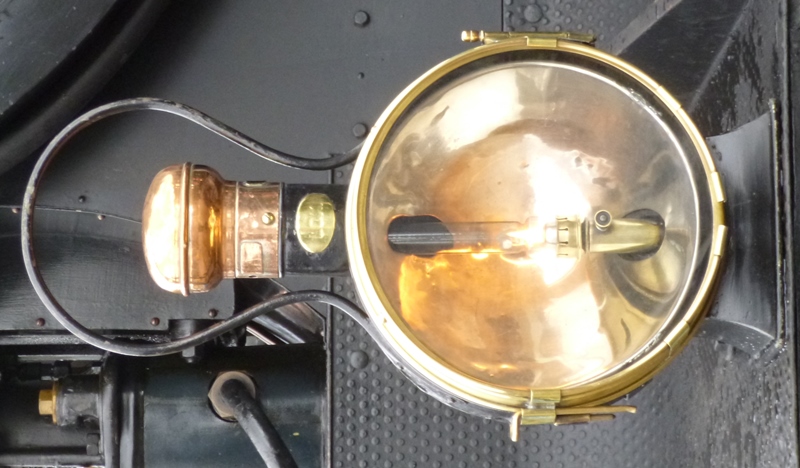 Erst wenn die
Erst wenn die
 Mit zunehmender Geschwindigkeit wurde diese zu einem
Problem. So musste sich das
Mit zunehmender Geschwindigkeit wurde diese zu einem
Problem. So musste sich das
 Nach Ankunft im
Nach Ankunft im