|
Fahrwerk mit Antrieb |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Wenn wir ein
Fahrwerk
ansehen, dann beginnt dies immer mit der
Achsfolge.
An dieser Praxis wollen wir nichts ändern, denn die damit gemachten
Erkenntnisse halfen schon immer weiter. Bei den hier vorgestellten
Lokomotiven
mit der nicht viel sagenden Bezeichnung CI wurde die Achsfolge mit 1’C
angegeben. Auch wenn man nun meinen könnte, dass zwischen der Achsfolge
und der Bezeichnung ein Zusammenhang besteht, war dem nicht so.
Die
Bahnlinie
über den Ceneri passte in dieses Bild. Spannend ist nur die Tatsache, dass
diese Ma-schinen bei der
Gotthardbahn die einzige Baureihe darstellten, die nach der
Bauart
Mogul aufgebaut wurden. Es lohnt sich ein genauer Blick. Bedingt durch den Aufbau des Fahrwerkes hatte die Lokomotive eine Fahrrichtung. Diese konnte mit der erlaubten Geschwindigkeit von 65 km/h für die Nummern 81 und 88, beziehungsweise 60 km/h für die Nummern 89 bis 92 befahren werden. In der Gegenrichtung waren die erlaubten
Höchst-geschwindigkeiten
jedoch deutlich tiefer und so lang die Höchstgeschwindigkeit in diesem
Fall nur noch bei 40 km/h. Schuld dabei war die Laufachse. Wir beginnen die Betrachtung des
Laufwerkes
mit den drei
Triebachsen.
Hier kamen Wellen aus hochfesten geschmiedeten Stählen zur Anwendung.
Diese
Achsen
besassen die Aufnahmen für die
Räder
und die
Achslager.
Dabei kamen die
Lager
innerhalb der Räder zur Montage. Das war eine Folge des bei
Dampflokomotiven verwendeten
Antriebes
mit
Triebstangen.
Dazu kommen wir später uns interessiert eher das Lager.
Alle anderen Richtungen waren mit Ausnahme
der mittleren
Triebachse
so gehemmt, dass es keine Verschiebung gab. Bei der mittleren
Achse
musste jedoch ein seitliches Spiel zugelassen werden. Nur so war es
möglich mit der
Lokomotive
eine
Kurve
zu befahren. Bei den Führungen zu den Achslagern kamen lineare Gleitlager zum Einbau. Diese waren offen aufgebaut worden und sie arbeiteten mit Stahl auf Stahl. Die hier zu erwartenden Bewegungen liessen dies zu. Trotzdem sollten auch diese
Gleitlager
geschmiert werden. Als
Schmiermittel
kam hier das damals übliche
Öl
zur Anwendung. Die bei diesen Lösungen ideal arbeitenden
Fette,
waren damals noch nicht so verbreitet. Für das eigentliche Achslager musste jedoch ein etwas grösserer Aufwand betrieben werden. Dieser war wegen den grossen Drehzahlen erforderlich. So wurden hier die Lagerschalen aus Weissmetall aufgebaut. Dieses weiche Metall besass sehr gute
Schmiereigenschaften und war daher für solche Einsätze ideal. Das Problem
war jedoch die Wärme, denn war die-ser Wert zu hoch, begannen die
Weissmetalle
zu schmelzen. Um das zu verhindern, musste die Reibung verringert werden, denn diese er-zeugt bekanntlich die Wärme. Gleichzeitig sollte noch eine wirksame Kühlung vorhanden sein. Beide Aufgaben wurden von der
Schmierung
übernommen. Das
Schmiermittel
Öl
wurde mit Hilfe von Schmierkissen auf die Welle übertragen und von dieser
im
Lager
verteilt. Verbrauchtes Öl wurde anschliessend ausgeschieden und so im
Laufwerk
verteilt. Mit der
Lagerung
der
Achsen
und dem Wissen, dass die mittlere
Triebachse
seitlich verschoben werden konnte, können wir den festen
Radstand
bestimmen. Dieser wurde hier mit 3 400 mm angegeben. Ein recht hoher Wert,
der jedoch damals noch üblich war, auch wenn man bereits wusste, dass
Gebirgsstrecken kürzere Lösung benötigten. Dank der grossen Länge konnte
jedoch auch bei 65 km/h ein stabiler Lauf erreicht werden.
Auf diesem aufgezogen wurde schliesslich das Ver-schleissteil. Diese Bandage besass neben einer Ver-schleissrille auch die Lauffläche und der Spurkranz. Komplett aufgebaut ergab sich so bei den
Trieb-rädern
ein Durchmesser von lediglich 1 350 mm. Gerade dieser Durchmesser zeigt deutlich, dass es sich bei der Reihe CI um eine Berglokomotive han-delte. Sollten diese über eine grosse Zugkraft ver-fügen mussten kleinere Räder verwendet werden. Wer schneller fahren wollte, baute grössere
Trieb-räder
ein. Es war also immer ein Kompromiss und hier reichte der Wert dazu, dass
die
Höchstge-schwindigkeit
bei hoher
Zugkraft
auch ausgefahren werden konnte. Um die auf das Rad übertragenen Schläge und Stösse von den Aufbauten fern zu halten, mussten die drei Triebachsen abgefedert werden. Dazu war bei jedem Achslager eine Feder eingebaut worden. Hier kamen die damals üblichen und gut
funktio-nierenden
Blattfedern
zum Einbau. Der Vorteil die-ser
Federung
bestand darin, dass wegen der langen Schwingungsdauer nicht dazu neigte,
sich aufzuschaukeln. Nicht gleich eingebaut wurden die
Federn.
So war jene der führenden
Triebachse
oberhalb des
Achslagers
eingebaut worden. Die beiden anderen
Radsätze
hatten jedoch unten liegende
Blattfedern
erhalten. Um
Kuppen
und
Senken einfacher befahren zu können, waren die
Federungen
der mittleren und der hinteren Triebachsen mit
Ausgleichshebeln
versehen worden. So war gesichert, dass die
Achslasten
immer eingehalten wurden.
Diese wurden als führend eingebaut und sie
erlaubte es, das Tempo auf mehr als 50 km/h zu steigern. Damit sind wir
aber auch gleich bei der
Laufachse
der Baureihe angetroffen und können uns diese ansehen, denn nur so haben
wir auch gleich die korrekte
Bauart
Mogul. Bei der
Laufachse
handelte es sich um eine
Bissellaufachse.
Deren Rahmen war als Deichsel ausgeführt worden. Diese wiederum war an
einem Ende mit dem Rahmen der
Lokomotive
beweglich verbunden worden. Am anderen Ende dieses einfachen Rahmens war
dann die eigentliche Laufachse eingebaut worden. Kräftige
Federn
sorgten dafür, dass der Rahmen zentriert wurde. Auch hier wurden liegende
Blattfedern
benutzt. Die
Achse
selber unterschied sich bei Aufbau und der
Lagerung
nicht gross von den
Triebachsen.
Auch bei der
Laufachse
kamen daher innenliegende
Gleitlager
zu Anwendung. Obwohl der Rahmen abgefedert wurde, konnte sich die
Laufachse in der vertikalen Richtung mit einem linearen Gleitlager
verschieben. Das eigentliche
Achslager
besass ebenfalls
Lagerschalen
aus
Weissmetall
und daher wurden auch diese mit
Öl
geschmiert. Auf den Achswellen wurden schliesslich die
beiden
Räder
aufgezogen. Auch hier wurden dazu
Speichenräder
mit aufgezogener
Bandage
verwendet. Der fertige
Radsatz
hatte aber nur noch einen Durchmesser von 870 mm erhalten. Das war auch
für
Laufachsen
ein sehr geringer Wert, der aber dafür sorgte, dass das Gewicht der
Laufachse verringert werden konnte. Sie sehen, es wurde Gewicht gespart,
wo es nur ging.
Diese bestand aus den bekannten Paketen der
Blatt-feder.
Wie bei der führenden
Triebachse
war die
Feder
hier oben eingebaut worden. Hier musste das jedoch erfolgen, weil es
unterhalb der Deichsel schlicht keinen Platz mehr gab. Damit auch die Laufachse einen Teil der Last auf-nehmen konnte, musste sie zusätzlich abgestützt werden. Aus diesem Grund wurde im Plattenrahmen eine Abstützung verbaut. Diese war so aufgebaut worden, dass sich
die
Lauf-achse
frei bewegen konnte. Die dazu erforder-lichen Gleitplatten wurden zu
Verringerung der Reibung mit
Öl
geschmiert. Eine damals durchaus übliche Lösung, die erst mit den
Fetten
geändert wurde. Mit der
Laufachse
haben wir das
Laufwerk
nach dem Baumuster Mogul aufgebaut. Der komplette
Radstand
wurde bei der
Lokomotive
CI mit 6 000 mm angegeben. Wobei dieser Wert nur im geraden
Gleis
für beiden Seiten galt. Durch die
Bissellaufachse
gab es in den
Kurven
eine Änderung des Winkels, womit sich die beiden Seiten leicht verschoben.
Der Wert war jedoch so gering, dass es nur wenige Millimeter waren. Auch wenn unsere
Lokomotive
nun auf dem
Fahrwerk
steht, eigentlich haben wir damit erst einen speziellen Wagen erhalten. Um
daraus ein
Triebfahrzeug
zu machen, musste ein
Antrieb
eingebaut werden. Bei der
Achsfolge
1’C betraf das die drei im Rahmen der Lokomotive gelagerten
Achsen.
Daher wurde vorher in diesem Bereich auch von den
Triebachsen
gesprochen. Wobei das eigentlich nur bei einer Achse stimmte.
Wegen dem
Antrieb
mussten die beiden Maschinen mit einem
Versatz
versehen werden. Dieser wurde bei die-sen Maschinen wegen der Anzahl
Zylinder
auf 90 Grad festgelegt. Im Zylinder wurde mit Hilfe des Dampfes eine lineare Bewegung erzeugt. Diese wurde nun auf die Kolben-stange übertragen, welche durch den Zylinder geführt worden war. Das zweite Ende dieser waagerecht verlaufenden Kol-benstange befand sich beim Kreuzgelenk. Dieses Gelenk lenkte die lineare Bewegung nur um. Wegen den hier entstehenden Kräften, musste
das
Kreuzgelenk
geführt werden. Hier kam eine doppelte Führung zur Anwendung. Am Kreuzgelenk war die zweite Schubstange ange-schlossen worden. Diese Stange endete schliesslich im Kurbelzapfen der zweiten angetriebenen Achse. Diese
Achse
musste wegen dem im
Kreuzgelenk
maximal erlaubten Winkel gewählt werden. Wir haben damit nun aber die
Triebachse
kennen gelernt, denn korrekt durfte nur diese direkt angeschlossene
Triebachse als solche bezeichnet werden. Die anderen Achsen galten als
Kuppelachsen. Für die beiden
Kuppelachsen
waren waagerecht verlaufende
Kuppelstangen
verbaut worden. Diese waren im Bereich der
Triebachse
mit einem
Gelenk
versehen und hingen im
Kurbelzapfen
der beiden Endachsen. Dieses Gelenk sorgte dafür, dass die drei
angetriebenen
Achsen
unabhängig voneinander der
Federung
folgen konnten. Ein Prinzip, das bei Dampflokomotiven mit nur zwei
Dampfmaschinen
sehr oft angewendet wurde.
Diese waren ein Bestandteil der Gussteils
und sie waren nicht bei jeder
Achse
gleich ausgeführt worden. Mit an-deren Worten war der Unterschied zwischen
der
Trieb-achse
mit grossen Gewicht und den beiden
Kuppelachsen
mit kleinem Gewicht zu erkennen. Ein Stangenantrieb hatte viele Gelenke und Drehlager. Die-se fanden sich bei jedem Rad bei den Kurbelzapfen, aber auch beim Kreuzgelenk. Hier kamen die damals üblichen Gleitlager zur Anwendung. Auch bei diesen
Lagern
wurden
Lagerschalen
aus
Weiss-metall
verwendet. Diese Lager wurden jetzt aber mit einer kompakten
Nadelschmierung
versehen. So konnte das
Öl
dosiert zugeführt werden, was den Verbrauch verringerte. Die Aufgabe des
Kurbelzapfens
bestand eigentlich darin, aus der linearen Bewegung eine drehende zu
machen. Damit entstand nun im
Rad
ein
Drehmoment,
das für den
Antrieb
genutzt werden konnte. So wurde das Drehmoment mit Hilfe der
Haftreibung
zwischen der
Lauffläche
und der
Schiene
in
Zugkraft
umgewandelt. Diese Kräfte wurden nun im Rahmen der
Lokomotive
gebündelt und so auf die
Zugvorrichtungen
übertragen. Mit den beiden
Dampfmaschinen
konnte bei der Reihe CI eine maximale
Zugkraft
von 55 kN erzeugt werden. Diese Werte konnten jedoch im gesamten Bereich
der Geschwindigkeit gehalten werden. Wegen den vorhandenen
Achslasten
konnte die
Anfahrzugkraft
jedoch dafür sorgen, dass die
Adhäsion
überschritten wurde. Das führte dazu, dass die
Triebachsen
leer durchdrehen. Ein Aufbau von Zugkraft war in dem Fall nicht mehr
möglich. Um bei schlechtem Schienenzustand die
Haftreibung
der
Räder
auf diesem hohen Wert zu halten, wurde die
Lokomotive
mit einer
Sandstreueinrichtung
ausgerüstet. Dabei wurde der
Quarzsand,
der in einem Sanddom über dem
Kessel
gelagert wurde, durch eine Leitung vor die erste
Triebachse gerieselt. Eine Unterstützung durch Luft, oder Dampf
gab es hingegen nicht. Die Anlage funktionierte alleine mit der
Schwerkraft.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2023 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
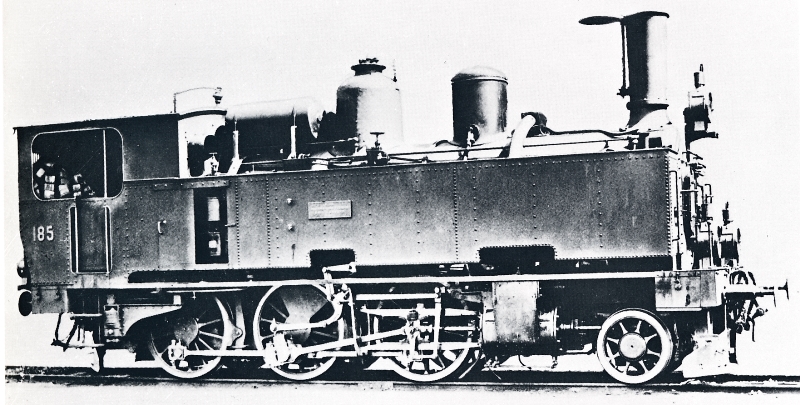 Diese
Bauweise ist jedoch besser als Typ Mogul bekannt. In der Schweiz gab es
viele Maschinen die nach dieser
Diese
Bauweise ist jedoch besser als Typ Mogul bekannt. In der Schweiz gab es
viele Maschinen die nach dieser
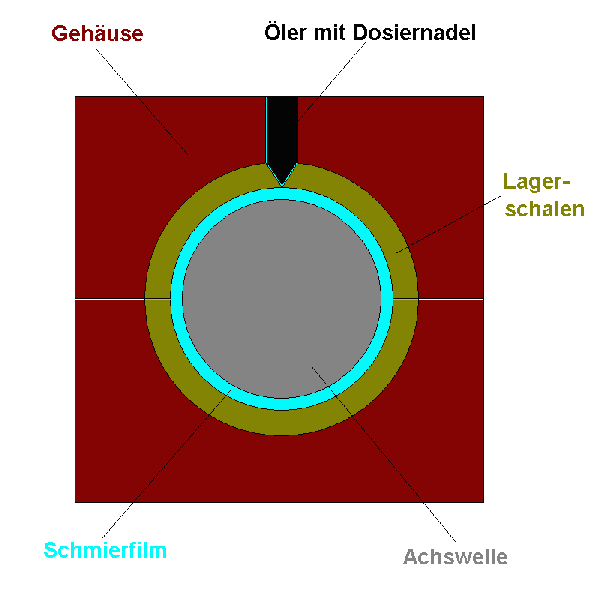 Die
Die
 Schliesslich
wurden auf den
Schliesslich
wurden auf den 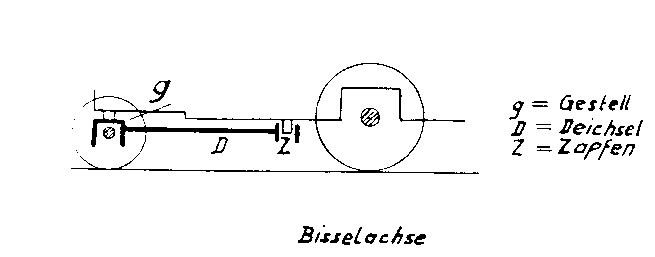 Um
die
Um
die
 Wegen
dem geringen Durchmesser erreichte die
Wegen
dem geringen Durchmesser erreichte die
 Die
Aufgabe des
Die
Aufgabe des
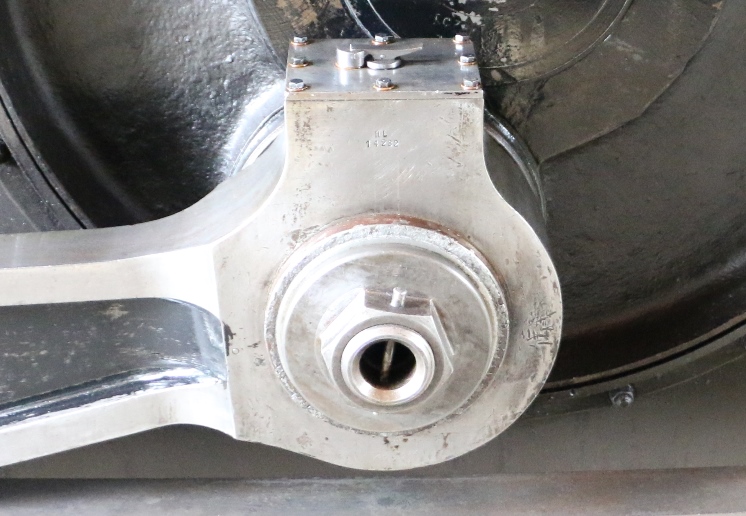 Die
in den einzelnen
Die
in den einzelnen