|
Mechanische Konstruktion |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Wie bei den meisten Dampflokomotiven wurde
auch hier als tragendes Element ein Rahmen verwendet. Es wurde bei allen
Lokomotiven
dieser Baureihe ein damals üblicher
Plattenrahmen
aufgebaut. Dieser bestand aus Stahlblechen, Gussteilen und vereinzelt auch
aus Profilen. Der Hauptanteil fiel aber auf die 30 mm starken Bleche.
Diese wurde vor der Montage zugeschnitten und wo es möglich war, mit
Aussparungen versehen.
Dabei muss jedoch erwähnt werden, dass die
teuren Schrauben nur dort benutzt wurden, wo lösbare
Ver-bindungen
erforderlich waren. Im Laufe dieses Ab-schnitts werden wir erfahren, wo
das genau erfolgte und teilweise auch den Grund betrachten. Hauptteile waren die beiden Längsträger. Diese wur-den mit verteilten Querträgern so verbunden, dass ein rechteckiges Bauteil entstand. Eine übliche Bau-weise, die noch lange angewendet werden sollte. Speziell waren dabei nur die beiden am Ende
der Längsträger angebrachten Bauteile. Diese wurden als
Stossbalken
ausgebildet und wir müssen uns daher diese Bereiche etwas genauer ansehen,
denn das Ende war wichtig. In der Mitte des
Stossbalkens
wurden die
Zugvorrich-tungen
nach den Normen der
UIC
eingebaut. Dazu war im Rahmen der
Zughaken
vorhanden. Dieser wurde mit kräftigen
Spiralfedern
nach hinten gezogen, so dass der Haken in der Regel bündig am Stossbalken
anliegen konnte. Führungen sorgten dafür, dass sich der Zughaken jedoch
nur in der Längsrichtung bewegen konnte. Eine radiale Einstellung war
daher nicht vorhanden. Am
Zughaken
wurde die
Schraubenkupplung
montiert. Diese war so beweglich, dass sie sich auch seitlich auslenken
konnte. Das sorgte dafür, dass die
Zugkräfte
nicht immer optimal in den Haken und damit in den Rahmen geleitet werden
konnten. Ein Problem, das erst behoben werden konnte, als sich auch die
Zughaken seitlich bewegen konnten. Zur Zeit dieser
Lokomotiven
hatte man diese Erkenntnis jedoch noch nicht erlangt.
Diese einfache Ablage war eines der Bauteile,
das mit Profilen aufgebaut wurde. Damit haben wir aber die hier verbauten
Zugvorrichtungen
abgeschlossen und kön-nen uns dem zweiten Teil der Einrichtungen zuwenden. Mit der beweglichen Schraubenkupplung nach UIC war es schlicht nicht möglich, dass Stosskräfte übertragen werden konnten. Daher mussten die Zugvorrichtungen mit den beiden seitlich am Stossbalken montierten Stossvorrichtungen ergänzt werden. Diese wurden mit vier Schrauben am
Stossbalken
angebaut. Dank dieser lösbaren
Verbindung
war es in einer Werkstatt leicht möglich defekte Elemente auszu-tauschen. Die Stossvorrichtungen bestanden aus Puffern. Hier wurden, wie es damals üblich war, Stangenpuffer verwendet. Bei diesen konnte sich die namensgebende Stange gegen die Kraft von kräftigen Spiralfedern bewegen. Die
Federn
sorgten zudem dafür, dass die nicht benutzten
Stossvorrichtungen
an den äusseren Anschlag gedrückt wurden. So konnte der komplette Federweg
immer für die Aufnahme der Kräfte genutzt werden. Abgeschlossen wurden die
Stossvorrichtungen
mit den runden
Puffertellern.
Diese waren auf der Stange befestigt worden und sie wurden nicht bei
beiden
Puffern
identisch ausgeführt. Der auf der linken Seite montierte
Stangenpuffer
hatte einen flachen Teller. Rechts wurde jedoch ein gewölbter Pufferteller
montiert. So war gesichert, dass sich nie zwei gleich ausgebildete
Lösungen treffen konnte. Wichtig war das in den
Kurven.
Um das zu verhindern waren in diesem Bereich
Gussteile als Abstützung vor-handen. Da dieser Bereich verkleidet wurde,
waren die Teile jedoch nicht zu erkennen. Es waren zugleich auch die
einzigen Gussteile. Da beidseitig vom Plattenrahmen zwei identisch ausgerüstete Stossbalken montiert wurden, können wir bereits die Länge der Lokomotive bestimmen. Diese betrug bei allen zwölf Maschinen 10 355 mm. Da nun auch die Länge der
Puffer
genormt war, können wir daraus auch die effektive Länge des Rahmens
ableiten. Diese war mit 9 055 mm deutlich unter zehn Metern. Damit haben
wir eine eher kurze
Lokomotive
erhalten. Mit den Zug- und
Stossvorrichtungen
nach den Normen der
UIC
haben wir aber noch nicht alle Anbauteile kennen gelernt. Unterhalb des
Plattenrahmens
war in erster Linie das
Fahrwerk
eingebaut worden. Dieses werden wir später im nächsten Kapitel noch
genauer ansehen. Jedoch hatte dieses weitere Anbauteile zur Folge, die dem
Laufwerk
als Schutz dienten. Diese geben uns nun auch einen Hinweis zu den
Fahrrichtungen. Auf beiden Seiten der
Lokomotive
wurden am Rahmen Halterungen montiert. Soweit gab es keinen Unterschied,
denn sie wurden überall gleich aufgebaut. Dabei waren sie so ausgerichtet
worden, dass sie ein paar Zentimeter über dem Kopf der
Schienen
endeten. Wenn wir nun aber zu den an diesen Halterungen angebrachten
Baugruppen kommen, dass beginnen die grossen Probleme. Beginnen wir mit
der vorderen Seite.
Die hier vorgestellte Baureihe bildete davon
keine Ausnahme und so wurden dort an den Halterungen
Schienenräumer
montiert. Diese waren nach einem einheitlichen Muster aufgebaut worden.
Zur Befestigung kamen Schrauben zur Anwendung, denn nur so konnte die Höhe
eingestellt werden. Die Aufgabe dieser Schienenräumer bestand darin allenfalls auf dem Gleis liegende Gegenstände zur Seite hin am Laufwerk vorbei zu leiten. Nur mit der Halterung wäre die Gefahr bestanden, dass der Räumer zu Innenseite wegge-drückt werden konnte. Damit das nicht so leicht erfolgen konnte,
wurde zwischen den Halterungen eine Stange eingebaut. So waren die
Schienenräumer
stabilisiert worden und konnten ihre Aufgabe übernehmen. Wir können uns damit der Rückseite zuwenden. An Stelle der Schienenräumer wurden dort nur Bündel aus Reisig montiert. Diese waren dafür vorgesehen, die Schienen wie ein Besen zu reinigen. Da sie diese aber nicht berührten, war das
eine grobe Reinigung vor grösseren Objekten. Somit war klar, die
Lokomotive
der Reihe CI war für eine Fahrrichtung ausgelegt worden, denn sonst hätte
man beidseitig
Schienenräumer
montieren müssen. Es wird nun Zeit, dass wir uns auf die obere
Seite des
Plattenrahmens
begeben. Wie bei den Dampflokomotiven üblich, war das markanteste Bauteil
der
Kessel.
Diesen werden wir später noch im Detail ansehen und spannend dabei ist
jetzt eigentlich nur, dass davon kaum etwas zu sehen war. Bei den
Maschinen mit den Nummern 81 bis 88 war zumindest das Umlaufblech, das
sonst dem Kessel entlang lief noch vorhanden. Ein
Kessel,
der nicht zu erkennen war und ein Umlaufblech, das kaum den Namen wert
war, lässt eine spannende Geschichte bei den anderen Aufbauten erwarten.
Diese bestanden aus den beiden seitlichen
Wasserkästen, dem
Führerhaus
und dem
Kohlenfach.
Soweit gab es zwischen den beiden Herstellern keinen Unterschied. Da es
jedoch nicht mehr gemeinsame Punkte gab, müssen wie die Aufbauten getrennt
ansehen. |
|||
|
Aufbauten der
Nummern 81 bis 88 |
|||
|
Beginnen wir mit den
Lokomotiven,
die mit den Betriebsnummern 81 bis 88 in Esslingen gebaut wurden. Diese
hatten zwei markante Aufbauten. Zum einen waren das die beiden zeitlich
von
Kessel
montierten
Wasserkästen und das
Führerhaus
mit dem
Kohlenfach.
Im kaum erkennbaren Fach konnten bis zu 2.5 Tonnen
Kohle
geladen werden. Wobei bei der
Gotthardbahn genau genommen
Briketts
aus Ruhrkohle verwendet wurden.
Wir beginnen die Betrachtung des
Führerhauses
und damit mit den Aufbauten mit der
Frontwand.
Diese wurde um den
Kessel
aufgebaut und war kaum zu er-kennen. Im sichtbaren Bereich der Frontwand waren zwei Fenster eingebaut worden. Diese waren jedoch nicht sehr gross und sie fanden auf beiden Seiten des Kessel über den Wasserkästen ihren Platz. Wie bei Dampfloko-motiven üblich, waren sie oben und unten rund aufge-baut worden. Das hier verwendete Glas war gehärtet worden
und bildete so bei einem Bruch keine scharfkantigen Scherben. Daher dürfen
sie nicht mit den heute üb-lichen Lösungen verglichen werden. Um den Blendeffekt der tief stehenden Sonne etwas zu mildern, waren über den beiden Frontfenster auffällige und stark gerundete Sonnendächer montiert worden. So war die Frontwand, die keine weiteren Merkmale mehr hatte, nach den damals üblichen Regeln ausgebaut worden. Dazu gehörte auch, dass diese Fenster von innen geöffnet werden konnten. Eine Möglichkeit, die hier wegen dem Führerhaus öfters benutzt wurde.
Die Wände wurden nach hinten bis zum
Abschluss der
Lokomotive
aufgebaut und umfassten so auch das dort montierte
Kohlenfach.
Neben den einfachen Wänden war in der hinteren oberen Hälfte eine grosse
Öffnung vorhanden. Diese umfasste etwas zweidrittel von der Länge. Im Bereich dieser Öffnung waren dann die seitlichen Zugänge vorhanden. Diese waren für das Lokomotivpersonal vorgesehen und mussten vom Boden her erreicht werden. Dazu waren unter dem Führerhaus erforderlichen Lei-tern montiert worden. Die Leitern mit den Sprossen aus einfachem
Stahlblech konnten aber nur mit den im Bereich der Seitenwand montierten
Griffstangen
bewältigt werden. Eine Lösung, die nie so richtig verändert wurde. Der Zugang selber war mit einer einfachen Türe verschlossen worden. Diese reichte jedoch ebenfalls nur bis zu Hälfte. Es war also eine Absturzsicherung vorhanden, die damals durchaus nicht üblich war. Speziell war eigentlich nur, dass die rechte
Stange auch im Bereich der Öffnung vorhanden war. Jedoch führte das dazu,
dass die Löcher in den Seitenwände nicht mehr so dominant wirkten, wie sie
effektiv waren. Es wird Zeit, dass wir uns der Rückwand zuwenden. Diese wurde in der unteren Hälfte leicht nach hinten gezogen. Wegen dem dort benötigten Berner Raum, musste das von Stossbalken schräg bis zur Hälfte erfolgen. Wobei die Modelle aus Esslingen in diesem
Punkt noch gnädig waren. Der obere Teil war einfach senkrecht nach oben
gezogen waren. Da sich nun das
Kohlenfach
vollständig im
Führerhaus
befand, musste eine Öffnung vorgesehen werden. Die Rückwand besass daher eine grosse Lucke,
die ausgeklappt werden konnte. Dabei war die Lucke so aufgebaut worden,
dass sie nach aussen geklappt wurde und dort eine schräge Fläche bereit
stellte. So konnte die Abdeckung dazu genutzt werden, die
Kohlen
in das entsprechende Fach leiten zu können. Die 2.5 Tonnen mussten also
nicht mit Muskelkraft auf der
Lokomotive
verladen werden. Nach dem Verlad wurde die Lucke geschlossen.
Dieser Überstand verhinderte, dass das
Dachwasser in den Innenraum tropfen konnte. Eine Lösung, die damals auch
üblich war und so hatten die Ma-schinen mit den Nummern 81 bis 88 ein
damals durchaus üblichen
Führerhaus
erhalten. Vor dem Führerhaus waren die beiden seitlich vom Kessel montierten Wasserkästen vorhanden. Deren oberen Abschluss fanden sich auf etwa der gleichen Höhe, wie die untere Kante der seitlichen Öffnung der Seitenwand. Unten war jedoch ein Umlaufblech vorhanden,
das erkannt werden konnte, weil es zwischen diesem und dem unteren
Abschluss eine schmale Lücke gab. Eine sehr besondere Lösung, da die
Wasserkästen sonst auf dem Blech abgestellt wurden. Im Gegensatz zu den
Tenderlokomotiven
der anderen Bahnen wurden die Kästen in der Längsausrichtung bis in den
Bereich der
Rauchkammertüre
verlängert. Das führte zu einem grossen Vorrat. Bei den Maschinen mit den
Nummern 81 bis 88 wurde dieser mit 7.0 m3
angegeben. Wichtig war dieser grosse Vorrat, wegen der langen Steigung von
Giubiasco nach Rivera und wegen der Tatsache, dass dort kein Wasser
gefasst werden konnte. Soweit können wir die Aufbauten bei den
Lokomotiven
mit den Nummern 81 bis 88 abschliessen. Klar waren noch weitere Punkte
vorhanden, diese werden aber später noch erwähnt werden. Im Moment haben
wir noch das Problem, dass wir bei vier Lokomotiven die Aufbauten noch
nicht kennen gelernt haben. Daher wird es Zeit, dass wir uns den ein Jahr
später gelieferten Maschinen mit den Betriebsnummern 89 bis 92 zuwenden. |
|||
|
Aufbauten der
Nummern 89 bis 92 |
|||
|
Bei den bei der SLM gebauten
Lokomotiven
wurden Änderungen vorgenommen, die sich optisch auf die Erscheinung der
Baureihe auswirken sollten. Hier flossen jedoch bereits erste Erfahrungen
mit den aus Esslingen gelieferten Modellen ein. Dort war das grösste
Problem die hohe Staubbelastung im
Führerhaus,
wenn die
Kohlen
verladen wurden. Daher sollte hier das
Kohlenfach
aussen montiert werden. Das führte dazu, dass sich die Sache optisch
anders präsentierte.
Daher betrachten wir nun auch diese Maschinen
mit allen Bereichen, wie das zuvor bei den Nummern 81 bis 88 erfolgt war.
Der Anfang macht dabei das
Führerhaus,
das nun zwischen dem
Kohlenfach
und den
Wasserkästen ein-geklemmt wurde. Der grundsätzliche Aufbau bestand aus den beiden Seiten-wänden, der Rückwand und der vorne aufgestellten Front-wand. Abgedeckt wurde das ganze von einem Dach. Auch bei diesen Maschinen war die
Frontwand
hinter den
Wasserkästen verdeckt und sie umfasste den Kessel. Selbst die
beiden
Frontfenster
mit den Gläsern aus gehärtetem Glas waren vorhanden. Das war auch ein
Bereich, bei den nicht viel verändert werden konnte. Wenn wir so denken, haben wir die Rechnung
nicht mit den Herstellern gemacht. Die SLM verzichtete auf die Montage der
Sonnendächer.
Diese wirkten nur bedingt gegen den Blendeffekt der Sonne und waren daher
unnützen
Ballast.
Ein Punkt, der gerade bei diesen vier
Lokomotiven
wichtig war. In der Geschichte sollten sie in der Schweiz als die
schwersten nach der
Bauart
Mogul gebauten Lokomotiven in die Bücher kommen. Da war der Verzicht
logisch.
Da nun aber bei den Modellen der SLM das
Kohlenfach
nicht eingebunden wurde, waren die beiden Seitenwände deutlich kürzer
ausgefallen. Das führte letztlich zum optischen Unterschied, auch wenn er
nicht alleine dafür ver-antwortlich sein sollte. Auch bei den Nummern 89 bis 92 war der Zugang über die beiden seitlichen Türen möglich. Wie ich es vorher schon angedeutet habe. In diesem Bereich gab es keine Änderungen zu dem Modellen aus Esslingen. Es war nun einer der wenigen Bereiche, die
nicht verändert werden konnten. Wenn wir einen Unterschied suchen, dann
würden wir ihn bei der Position finden. Obwohl er anhand der Lücke nach
hinten verschoben war, blieb er am gleichen Ort. Nach hinten schloss sich das Führerhaus mit der Rückwand ab. Diese war senkrecht aufgestellt worden und sie besass in der unteren Hälfte eine Öffnung, die mit Balken leicht verschlossen werden konnte. Im oberen Teil waren aber zwei Fenster
vorhanden, die nach den gleichen Regeln der
Frontwand
aufgebaut wurden. So war die Sicht nach hinten bei den Maschinen der SLM
etwas besser gelöst worden, denn bei den anderen war bekanntlich nichts
vorhanden. Abdeckt wurde das Führerhaus mit einem gewölbten Dach. Im Gegensatz zu den Modellen aus Esslingen war nun aber eine kräftigere Rundung vorhanden. So wirkte das Führerhaus höher und wichtiger. Nicht verändert wurde in diesem Punkt
eigentlich nur der Überstand, der auch hier verhinderte, dass das
Dachwasser in den
Führerstand
tropfen konnte. Doch noch können wir hier das Dach nicht abschliessen. Bei den Nummern 81 bis 88 war kaum ein Abzug
der Wärme vorhanden. So wurde es im Sommer im
Führerstand
sehr heiss. Damit das etwas gemildert werden konnte, war bei den Modellen
der SLM auf dem Dach ein Abzug vorhanden. So konnte dort die heisse Luft
aus dem Fahrzeug geführt werden. Der Aufbau war so, dass sogar durch den
Fahrtwind ein zusätzlicher Sog entstehen konnte. Das
Führerhaus
sollte daher nicht so heiss werden.
Jedoch war das nur eine Auswirkung der
Bauart,
wo einfach das Blech bis zum Ende gezogen wurde. Dieses war deutlich
verändert worden, denn hier war die schräge Wand stärker nach hinten
gezogen worden. Nötig wurde diese Lösung, die auch als Rucksack bezeichnet wurde, wegen der Tatsache, dass hier das Führerhaus vom Kohlenfach befreit wurde. So wurde das Fach nicht ganz so hoch und der Führerraum konnte auch nicht ausreichend verkürzt werden. In der Folge musste der Platz anders
beschafft werden und das ging nun mal mit dem Zurücksetzen der Rück-wand.
Sie sehen der Platz war wirklich gut ausgenutzt worden. Mit dem oben noch sichtbaren Teil des
eigentlichen
Kohlenfachs,
konnten auch hier 2.5 Tonnen
Kohlen
verladen werden. Damit wurde gegenüber den Model-len aus Esslingen der
Vorrat nicht erhöht. Die gut sichtbaren Veränderungen waren daher wirklich
nur eine Folge der Tatsache, dass das Kohlenfach nicht mehr im
Führerhaus
eingebaut wurde. Gebrochene
Briketts
waren jetzt auch nicht mehr so unbeliebt. Uns bleiben nur noch die beiden vor dem
Führerhaus
aufgebauten
Wasserkästen. Diese wurden, wie bei den Modellen aus Esslingen bis
nach vorne zur Türe der
Rauchkammer
geführt. Auch der obere Abschluss entsprach den älteren Maschinen. Jedoch
wurden die Wasserkästen auf dem Umlaufblech abgestellt und die Lücke
verschwand. Deren Nutzen war nicht gegeben und daher wurde auf diesen
Bereich verzichtet. Wichtiger waren wohl eher die damit
verbundenen Anpassungen bei der Füllmenge. Die
Lokomotiven
der SLM konnten in den beiden
Wasserkästen einen Vorrat von 7.4 m3
Wasser aufnehmen. Das waren ganze 400 Liter mehr, als das bei den Modellen
aus Esslingen der Fall war. Ein Punkt, der klar ein Mehrgewicht zur Folge
hatte und dieses musste nun mit dem
Fahrwerk
auf das
Gleis
abgestützt werden. Das erfolgt jedoch in einem eigenen Kapitel.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2023 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Die
einzelnen Bauteile für den
Die
einzelnen Bauteile für den
 Die
nicht benutzte
Die
nicht benutzte
 Ein
Problem gab es mit der Einleitung der Kräfte in den
Ein
Problem gab es mit der Einleitung der Kräfte in den
 Zuerst
stellt sich natürlich die Frage, wo denn vorne ist. Bei Dampfloko-motiven
ist das eigentlich noch ganz einfach, denn vorne ist dort, wo der
Zuerst
stellt sich natürlich die Frage, wo denn vorne ist. Bei Dampfloko-motiven
ist das eigentlich noch ganz einfach, denn vorne ist dort, wo der
 Wie
vorher angedeutet, war das
Wie
vorher angedeutet, war das  Wenn
wir nun zu den beiden Seitenwänden kommen, dann haben wir es etwas
einfacher, denn zwischen den beiden Seiten gab es schlicht keinen
Unter-schied.
Wenn
wir nun zu den beiden Seitenwänden kommen, dann haben wir es etwas
einfacher, denn zwischen den beiden Seiten gab es schlicht keinen
Unter-schied.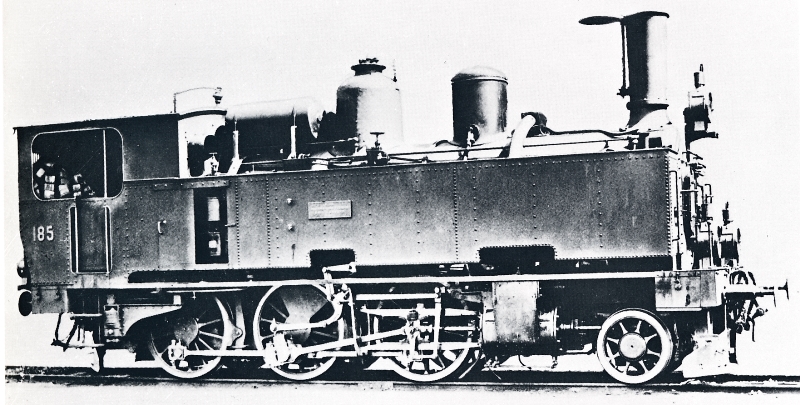 Dieses
Dieses 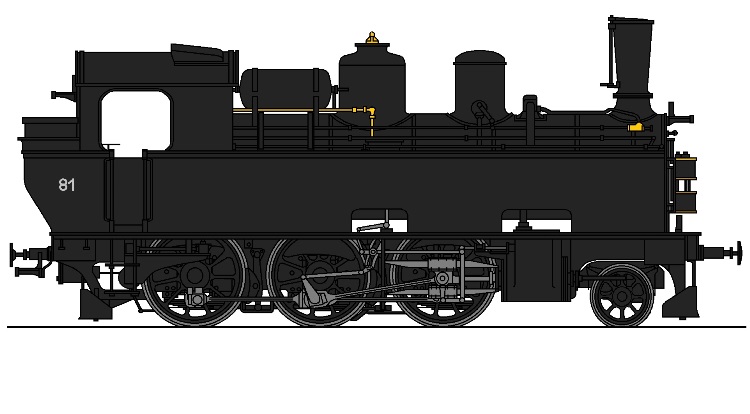 Im
groben Überblick können wir feststellen, dass eigent-lich gegenüber den
älteren Modellen wirklich nur das
Im
groben Überblick können wir feststellen, dass eigent-lich gegenüber den
älteren Modellen wirklich nur das