|
Entwicklung und Beschaffung |
||||
| Navigation durch das Thema | ||||
| Baujahr: | 1882 - 1883 | Leistung: | 368 kW / |
|
| Gewicht: | 60.5 - 62.6 t | V. max.: | 60 - 65 km/h |
|
| Normallast: | 120 t bei 20 km/h | Länge: | 10 355 mm |
|
|
Für die flachen Abschnitte nördlich und
südlich der
Bergstrecke
waren mit den Baureihen BI und den
entsprechenden Modellen aus den Beständen der Tessiner Talbahnen genug
Maschinen vorhanden. Die Lücke dazwischen sollte mit einer grossen
Lokomotive
mit
Schlepptender
überbrückt werden. Somit waren die Maschinen für die neuen
Schnellzüge
bis Bellinzona vorhanden und auch über die Strecke nach Luino konnten
diese verkehren.
Danach ging es flacher zur Sache. Wobei der
Sotto Ceneri durch Hügel gekennzeichnet war, die über-quert werden
mussten. So gab es auch im Süden steilere Abschnitte, die befahren werden
mussten. Einziger Unterschied ist, die Strecke über den Mon-te Ceneri ist um einiges kürzer, als die Gotthard-strecke. Das sollte letztlich Auswirkungen auf die für diese Strecke bestellten und eingesetzten Lokomotiven haben. Wobei natürlich immer noch die gleichen
Regeln galten, denn auch für diese Maschinen war eigent-lich das Geld gar
nicht vorhanden. Daher sollten wir nachsehen, was vorgesehen war und was
bereits im Einsatz stand. Auf den Strecken der ehemaligen Tessiner Talbahn-en, verkehrten die dort schon vorhandenen Loko-motiven. Das waren im Raum Bellinzona die
Lokomotiven
der
Gruppen
I und II. Bei der Gruppe I handelte es sich um eine
Tenderlokomotive,
die recht langsam war. Das konnte mit der
Schlepptenderlokomotive
der Gruppe II kompensiert werden. Gerade letztere war seinerzeit für die
Reisezüge der neuen Strecke vorgesehen worden. Auch wenn wir mit der
Gruppe
II eine durchaus passende Baureihe hatten, war sie nicht für den Nachbau
vorgesehen worden. Warum es dazu kam, müssen wir auf dem südlichen Netz
ansehen. Dort verkehrten die Modelle der Gruppe III und die hatten
durchaus eine ansprechende Grösse. Zu Beginn für
Güterzüge
vorgesehen, sollte dieses Modell als Muster für die grosse
Universallokomotive
der
Bergstrecke
werden.
Dieses wiederum gelangte anschliessend in
die
Dampf-maschine,
wo das Volumen für den Dampf gemildert wurde. Ein Problem, das es so bei
der
Gruppe
II nicht gab, auch wenn sie über die gleiche Lösung beim
Kessel
ver-fügte. Der Grund waren die flachen Abschnitte. Der Fehler mit dem Kessel konnte nicht behoben werden und so verkehrte diese Lokomotive mit Schlepptender nur zwischen Biasca und Locarno. Dazu waren jedoch die mitgeführten Vorräte
völlig überdimensioniert. Der
Tender
wurde im Betrieb fast nicht leer. So gesehen, hätte sich die Fahrt bis
Chiasso nicht ausgewirkt. Doch die Erfahrungen mit der
Gruppe
III liessen erwarten, dass die
Leistung
für die
Rampen
nicht ausreichend war. Ideal für den Abschnitt über den Ceneri
waren eigentlich die Modelle, die für die
Bergstrecke
beschafft werden sollten. Deren Vorräte hätten für den Abschnitt von
Biasca bis Chiasso ausgereicht und in den Steigungen konnten die Werte vom
Gotthard genommen werden. Die befürchtete Vielzahl von kleineren Baureihen
wäre damit verhindert worden. Doch auch diese Maschine hatte ein grosses
Problem, das wir ansehen müssen. Die Reihe C
war für die
Reisezüge
auf steilen
Bergstrecken
ausgelegt worden. Das führte dazu, dass man zur Einsparung beim Gewicht
auf eine führende
Laufachse
verzichten musste. Nur schon der
Tender
musste an der
Anhängelast
abgezogen werden und so wurde die
Lokomotive
so leicht, wie es nur ging, gebaut. Auf die Geschwindigkeit wirkte sich
das jedoch negativ aus, und so blieb sie mit 55 km/h eher bescheiden.
Aber dann wäre nur noch der Ab-schnitt nach Chiasso übrig geblieben und dort wurde schlicht kein Schlepp-tender benötigt. Warum das so war, müssen wir uns ansehen,
denn so kommen wir dann zur Lösung, die umgesetzt werden sollte. Dampflokomotiven verkehrten mit ihr-em Vorrat beim Brennstoff immer von einem Depot zum anderen. Hin- und Rückfahrten gab es nur bei kleineren Bahnen, wo es oft nur ein Depot gab. Wegen der Vorgeschichte mit den Tes-siner Talbahnen waren die Standorte in Biasca und in Chiasso vorgesehen worden. Diese konnte man auch nach der Er-öffnung
der durchgehenden Linie nu-tzen und sich so Baukosten für die Anlagen
ersparen. In Bellinzona war eigentlich nur der
Bahnhof
vorgesehen worden. Die von Biasca kommenden Züge legten einen Stopp ein
und fuhren weiter. Das war mitunter auch der Grund, warum bei den Tessiner
Talbahnen
Schlepptenderlokomotiven
vorhanden waren. Doch die Geldnot und findige Geldmacher, sollten diese
Idee auf den Kopf stellen. Dazu ein kleiner Einblick in die Geschichte des
Baus und dabei der Anlagen. In der Planung war vorgesehen, dass in
Altdorf ein
Depot
mit
Hauptwerkstätte
entstehen sollte. Jedoch konnten die geforderten Preise für das Land
schlicht nicht bezahlt werden. Das führte dazu, dass letztlich das Depot
nach Erstfeld verschoben wurde. Für die Hauptwerkstätte wurde ein anderer
Standort gesucht und dabei boten sich eigentlich die definierten Standorte
bei den Depots an. Erstfeld war ungeeignet und in Biasca war es zu teuer.
Dieses stand in Biasca und somit zu weit
weg. Daher wurde in Bellinzona ein zusätzliches
Depot
benötigt. Die Distanz für die
Reisezüge halbierte sich damit, und das hatte
direkte Auswirkungen auf die neuen
Lokomotiven. Mit dem zusätzlichen Depot haben wir eine neue Situation erhalten. Im Norden hat sich nichts geändert, dort wurden die Baureihen BI und C vorgesehen. Die Vorräte bei der Reihe C hätten durchaus eine Fahrt bis nach Bellinzona erlaubt. Zwar waren dann kaum noch Reserven
vorhanden. Hinzu kam der langsame
Reisezug
auf dem Abschnitt im Tessin. Dort hatte man mit den
Lokomotiven
der
Gruppe
II bereits passende Modelle. Was jedoch fehlte, war die zugkräftige Maschine für die Steigungen am Monte Ceneri und im Sotto Ceneri. Dort könnte man nun auch die Modelle der Baureihe C be-nutzen, denn diese passten ideal. Das Problem war, dass die Distanz für eine
Lokomotive
mit
Schlepptender
zu gross war. Eine Fahrt von Bellinzona nach Chiasso und zurück wäre ohne
Probleme möglich gewesen. Das
Depot
in Chiasso müsste nicht mehr aufgesucht werden. So schön das klingt, bei einer
Dampflokomotive war das oft nur ein Wunsch des dicken Direktors.
Betrieblich machte das jedoch keinen Sinn. Die Vorräte mussten, ob sie auf
der
Lokomotive
verstaut wurden, oder sich in einem
Tender
befanden, auch befördert werden. Beim
Kohlenwagen
kam dessen Gewicht auch noch hinzu. Das konnte nicht der
Anhängelast
zugeschlagen werden. Am Monte Ceneri war das jedoch ein Problem.
Ziehen wir nun den halben Vorrat für eine Fahrt ab, dann sind wir bereits bei einem Gewicht von 18 Tonnen. Damals entsprach das fast zwei
Reisezugwagen,
die nicht mitgenommen werden konnten. Sie sehen, das waren bei einem
Tender
deutliche Einbussen. Die Berechnung der für eine Fahrt benötigten Vor-räte beschränkte sich nur auf die Kohlen. Diese konnten unterwegs bei einem kurzen Halt nicht nachgefüllt werden. Beim Wasser funktionierte das sogar ohne
Probleme und das musste auch mit den grossen Modellen gemacht werden. Es
gab damals schlicht keine Dampflokomotive, die genug Wasser mitnehmen
konnte. So war die Berechnung auch etwas einfacher und das gab oft
spezielle Lösungen. Auch jetzt wollen wir rechnen. Auf dem
Tender
der
Gotthardbahngesellschaft
konnten 4.5 Tonnen
Kohlen
verladen werden. Wurde dieser Wert nun halbiert, verringert sich das
Gewicht auf rund 2.3 Tonnen. Wenn wir nun das
Kohlenfach der
Reihe BI ansehen, dann erkennen
wir, dass dort zwei Tonnen verladen werden konnten. Somit fehlten nur noch
300 Kilogramm und für die würde sich sicherlich ein Platz finden. Wir haben daher die
Lokomotive
für die
Reisezüge am Monte Ceneri bereits definiert. Diese
sollte über die
Zugkraft
der Baureihe C verfügen und daher auch die
gleiche Anzahl
Triebachsen
besitzen. Wegen den benötigten Vorräten wurde auf die Mitgabe des
Tenders
verzichtet und diese auf die Lokomotive gepackt. Damit ergaben sich aber
Probleme mit den
Achslasten.
Daher wurde noch eine
Laufachse
benötigt.
Damit konnte man sich viel Geld für die
Entwicklung der neuen Baureihe ersparen. Trotz allem dürfen wir nicht
vergessen, das Geld war knapp und daher nutzte man die vorhandenen
Möglichkeiten so gut es ging. Für die neue Tenderlokomotive definierte die Gotthard-bahn die Normallasten. Diese sollten auf der steilen Rampe des Monte Ceneri etwa 130 Tonnen betragen und dabei sollte eine Geschwindigkeit von 25 km/h erreicht werden. Das verlangte eine
Leistung
von rund 500 PS. Werte, die von der Baureihe C
erreicht wurden und die wir nun zum Vergleich der Giganten hinzu nehmen,
denn nun zeigte sich der Nachteil des
Tenders. Da die Eckdaten für den
Kessel
und die
Triebachsen
gleich waren, wie bei der Reihe C hatten
diese die gleiche
Zugkraft.
Die
Tenderlokomotive
konnte dabei rund zehn Tonnen mehr mitnehmen. Das war nicht viel, aber das
leicht höhere Gewicht verhinderte, dass die
Anhängelast
um rund 30 Tonnen erhöht werden konnte. Mit dem Gewicht kommen wir nun zu
einem anderen Vorteil, der die
Lokomotive
für den Ceneri aufweisen konnte. Wegen dem höheren Gewicht ergaben sich
Probleme mit den erlaubten
Achslasten.
Um diese ausgleichen zu können, war eine führende
Laufachse
vorzusehen. Dank dieser sollte sich das Fahrverhalten leicht bessern und
so wurden nun erwartet, dass die
Tenderlokomotive
mit 60 km/h verkehren konnte. Keine grossen Schritte, denn auch hier stand
die
Zugkraft
und nicht die Geschwindigkeit im Vordergrund der Planung.
Hier wurde eigentlich geplant, dass die
neue Be-spannung in Bellinzona erfolgen sollte. Der
Rangier-bahnhof
San Paolo war eine Folge davon. Die
Schlepptenderlokomotive
lief daher vom Gotthard kommend, bis nach Bellinzona. Da auch auf den steilen Rampen des Monte Ceneri in südlicher Richtung Vorspann- und Schiebelokomoti-ven erwartet wurden, war auch die neue Maschine so einsetzbar. Es sollte jedoch leicht anders kommen, denn
die
Lokomotive
war in erster Linie für
Reisezüge auf steilen Abschnitten. Damit stellt sich
aber die Frage, wer dieses Wunderding bauen sollte, denn es gab schon
ähnliche Maschinen, aber nicht mit dieser
Leistung. Eine eigentliche Ausschreibung für diese
Maschine mit der
Achsfolge
Mogul erfolgte jedoch nicht. Der Grund dafür war, dass die Eckdaten der
Reihe C genommen wurden. Um sich die
Kosten für die Planung sparen zu können, bot sich eigentlich an, dass man
zum gleichen Hersteller griff. Dieser konnte so schnell und mit geringen
Kosten arbeiten. Geringe Kosten klangen in den Ohren der Chefs bei der
Gotthardbahn
wie Musik. So wurden bei der Maschinenfabrik Kessler
in Esslingen (D) acht
Lokomotiven
der Baureihe CI vorgesehen. Nur schon diese Bezeichnung zeigt, wie nahe
verwandt diese beiden Typen waren. Der Stückpreis dürfte vermutlich leicht
unter jenem der Reihe C gelegen haben und
die Lieferung sollte im Jahre 1882 auf die geplante Eröffnung hin
erfolgen. Diese aus Esslingen gelieferten Maschinen sollten mit den
Nummern 81 bis 88 versehen werden.
Nur schon diese Tatsache lässt vermuten,
dass die ersten Modelle als Finanzausgleich in Deutschland beschafft
wur-den. Die Reihe war gut und nur ein Jahr später wurde der Hersteller
gewechselt. Die SLM konnten von der Baureihe CI jedoch nur diese vier Exemplare mit den Nummern 89 bis 92 liefern. Optisch konnten die beiden Hersteller jedoch leicht unterschieden werden. Das Modell aus Winterthur war im Bereich
des
Führer-hauses
verändert worden. Technisch waren die
Lokomo-tiven
der SLM jedoch nahezu gleich aufgebaut worden, so dass wir eine
einheitliche Serie von insgesamt 12 Exemplaren hatten. Es war kein Problem der Baureihe, die eine weitere Beschaffung verhinderte. Mit der Betriebsaufnahme er-lebte der Güterverkehr am Gotthard einen Ansturm, dem die Bahn kaum gewachsen war. Immer mehr Maschinen wurden beschafft
werden und dazu gehörten auch die 1883 ausgelieferten Lokomotiven C I von
der SLM in Winterthur. Man musste nach nur einem Jahr den Bestand massiv
erhöhen, denn es waren doch 50%. Damit die schweren
Güterzüge
befördert werden konnten, musste noch mehr gezogen werden. Die Reihe C I
wurde deshalb nahezu ausschliesslich vor
Reisezügen eingesetzt und dort war der Ansturm nicht
so gross, dass viele neue Maschinen benötigt wurden. Alleine die 33
Exemplare der Baureihe C zeugen von dieser
Tatsache. Im
Güterverkehr
hatten die
Schlepptenderlokomotiven
dank dem Verkehr den Sieg errungen.
|
||||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | ||
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | |
|
Copyright 2023 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
||||
 Das
Problem, das noch gelöst werden musste, war aber die Strecke über den
Ceneri und somit das Teilstück bis an die Grenze in Chiasso. Diese war
speziell, besass sie doch Abschnitte, die mit einer
Das
Problem, das noch gelöst werden musste, war aber die Strecke über den
Ceneri und somit das Teilstück bis an die Grenze in Chiasso. Diese war
speziell, besass sie doch Abschnitte, die mit einer
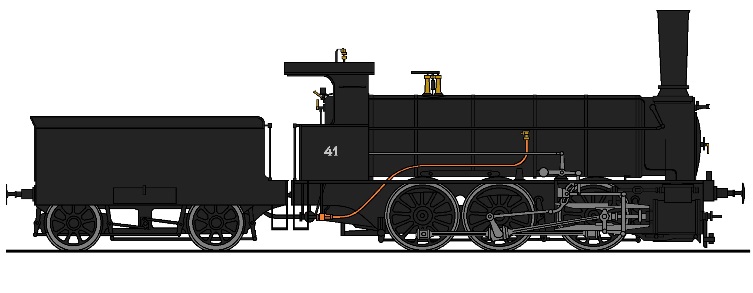 Das
Problem dieser nach dem Baumuster Bourbonnais ge-bauten
Das
Problem dieser nach dem Baumuster Bourbonnais ge-bauten
 Sie
war daher in den flachen Abschnit-ten zu langsam unterwegs. Der Verlust
bei der
Sie
war daher in den flachen Abschnit-ten zu langsam unterwegs. Der Verlust
bei der
 Das
führte letztlich dazu, dass die
Das
führte letztlich dazu, dass die
 Wenn
wir uns die Gewichte des bei der
Wenn
wir uns die Gewichte des bei der
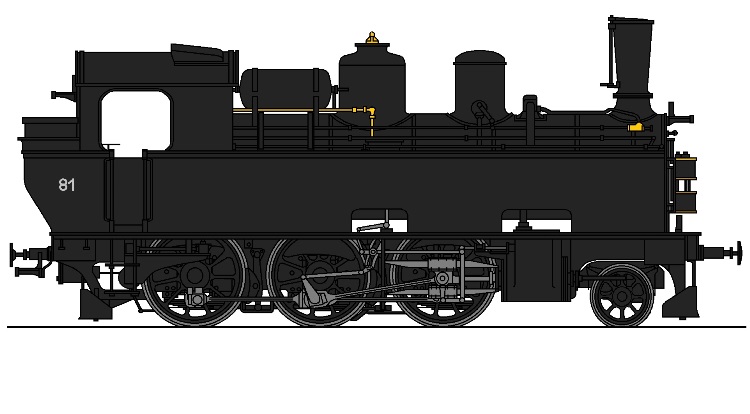 Die
oben gemachten Überlegungen wurden auch vom Direktorium der
Die
oben gemachten Überlegungen wurden auch vom Direktorium der
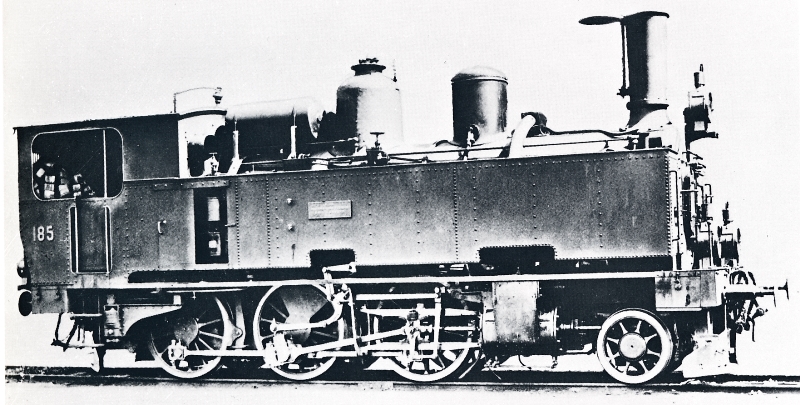 Auch
die
Auch
die
 Eher
speziell war, dass es nur ein Jahr später eine Nachbestellung von weiteren
vier Maschinen gab. Diese erfolgte nun aber nicht mehr an die
Maschinenfabrik Kessler, sondern an die Schweizerische Lokomotiv- und
Maschinenfabrik SLM in Winterthur.
Eher
speziell war, dass es nur ein Jahr später eine Nachbestellung von weiteren
vier Maschinen gab. Diese erfolgte nun aber nicht mehr an die
Maschinenfabrik Kessler, sondern an die Schweizerische Lokomotiv- und
Maschinenfabrik SLM in Winterthur.