|
Druckluft und Bremsen |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Wir sind beim komplizierten Thema
Dampflokomotive und
Druckluft
angelangt. Diese diente bei diesen Fahrzeugen ausschliesslich den
Bremsen.
Damit war die Sache einfach, denn wurde das Fahrzeug vor der Einführung
der
Druckluftbremsen
ausgeliefert, gab es keine entsprechenden Einrichtungen. Wir können somit
die
Lokomotiven
mit den Nummern 101 bis 131, also jene aus München, bereits zur Seite
legen.
Doch nun stellt sich die Frage, warum eine Güter-zugslokomotive mit dieser Bremse versehen wurde. Das war einfach, denn einen reinen Einsatz gab es bei der Gotthardbahn nicht. Ab dem Jahre 1895 sollen auch die ersten
Güter-züge
eine
Druckluftbremse
bekommen. Das hatte zur Folge, dass auf den nach
diesem Jahr ausgelieferten Maschinen die Einrichtungen bereits bei der
Auslieferung eingebaut werden mussten. Damit haben wir bei den Reihen D4T
und D 4/4 auch
Druckluft
vorhanden und deshalb müssen wir uns in diesem Thema annehmen. Damit die
Bremse
funktionierte, musste also zuerst eine Vorrichtung verbaut werden, die
ausreichend Druckluft erzeugen konnte. Die zur Erzeugung von
Druckluft
benötigte
Luftpumpe
wurde auf der linken Seite des
Kessels
an der
Frontwand
des
Führerhauses
montiert. Auch hier galt die Regel, dass der erforderliche Platz für die
Bauteile gesucht werden musste. Der hier gewählte Ort war insofern gut,
als man die Luftpumpe kaum erkennen konnte. Wir müssen sie aber trotzdem
etwas genauer ansehen, denn betrieben wurde sie mit Dampf.
Mit diesem Dampf wurde schliesslich eine
Dampfmaschine
mit einer automatischen Steuerung in Bewegung versetzt. Diese Bewegung
sorgte nun dafür, dass auch auf der pneumatischen Seite mit der
Kolbenstange
ein
Kolben
in Bewegung versetzt wurde. Auf der pneumatischen Seite der Luftpumpe arbeitete eigentlich auch eine besondere Form der Dampfmaschine. Diese wurde mechanisch in Bewegung versetzt und statt Dampf wurde Luft durch den Kolben verdrängt. Einfache
Ventile
sorgten dafür, dass diese Verdrängung nur in Richtung der angeschlossenen
Leitung erfolgen konnte. Es wurde also Luft in das System gepumpt und
daher auch der Name für die
Luftpumpe. Die Leitung führte nur unter dem Kessel durch und endete dort bei den Nummern 132 bis 136 in einem auf dem Umlaufblech mon-tierten Luftbehälter. Bei den fünf Modellen aus dem Nachbau fand
man einen anderen Platz, da hier der Rahmen bereits auf die Aufnahme
dieser Baugruppen vorbereitet werden konnte. Daher war der Behälter bei
den Nummern 141 bis 145 nur noch schlecht zu erkennen. Trotzdem war er
vorhanden. Im Luftbehälter konnte keine Druckluft gespeichert werden. Er diente vielmehr der Bereitstellung eines grösseren Volumens. So konnten auch kurzfristig erfolgte grössere Entnahmen bei der Druckluft aufgefangen werden. Auf die Speicherung konnte verzichtet
werden, da eine Dampf-lokomotive auch ohne
Druckluft
in Betrieb genommen werden kann. Daher war wirklich nur das grössere
Volumen für den Behälter verantwortlich. Auf ein
Überdruckventil
zur Begrenzung des
Luftdruckes
konnte verzichtet werden. Die
Luftpumpe
arbeitete so lange, bis im System für
Druckluft
der Luftdruck jenem des Dampfes entsprach. In diesem Fall stellte die
Pumpe einfach den Betrieb ein. So hatte das System für die Druckluft bei
dieser
Lokomotive
einem maximalen Luftdruck von acht
bar
erhalten, was anderen Baureihen und dem damaligen Wert entsprach.
So finden wir das Bauteil bei allen Lokomotiven an der gleichen Stelle. Genau genommen handelte es sich um die Einrichtung für die akustischen Signale. Auf dem Dach des Führerhauses wurde dazu eine Lokpfeife montiert. Diese arbeitete auf die gleiche Weise, ob sie nun mit Druckluft, oder mit Dampf betrieben wurde. Dort, wo man Dampf zur Verfügung hatte, wurde dieser benutzt. Durch den dort höheren Druck war jedoch das
akustische Signal mit Dampf deutlich lauter. Das war bei den Modellen ohne
Druckluft
sehr wichtig, da so den
Bremsern
Aufträge erteilt wurden. Aktiviert wurde die Pfeife mit einem Griff. Zog man daran, ertönte das Signal durch den ausströmenden Dampf. Erst wenn wieder losgelassen wurde, verstummte die Lokpfeife. Je nachdem, wie kräftig am Griff gezogen
wurde, ertönte ein lauteres oder auch leiseres Signal. Selbst
unterschiedliche Klangfolgen konnten mit etwas Übung mit der
Lokpfeife
ohne Probleme erzeugt werden. Unterschiede bei der
Pfeife
gab es nur durch den Dampfdruck, der nicht immer gleich war. Wir können nun aber zu den pneumatischen
Bremsen
der damit ausgerüsteten Modellen wechseln. Zu Erinnerung sei erwähnt, dass
bei der Auslieferung lediglich die Modelle der SLM damit versehen wurden.
Das waren die Nummern 132 bis 136 und die Serie 141 bis 145. Beide hatten
jedoch das gleichen
Bremssystem
erhalten, so dass es in diesem Punkt keine Unterschiede zu beachten gab.
Wichtiger ist die Betrachtung der Bremsen.
An dieser Leitung war dann bei den damit
versehenen Fahrzeugen ein
Bremszylinder
angeschlossen worden. Wie das genau gemeint ist, erörtern wir später, denn
zuerst die Leitung. Die Leitung der Regulierbremse wurde zu den beiden Stossbalken geführt. Dort endete sie in speziellen Luft-schläuchen, die mit einem Absperrhahn versehen wurden. So konnten auch andere Fahrzeuge an dieser
Bremse
an-geschlossen werden. Es war also im besten Fall möglich, mit dieser
Regulierleitung
einen ganzen Zug zu bremsen. Eine Lösung, die besonders bei Talfahrten auf
den
Berg-strecken
von grossem Vorteil war. Wegen dem Problem, dass die Bremswirkung ausfiel, wenn die Anhängelast von der Lokomotive getrennt wurde, musste ein zweites Bremssystem verbaut werden. Aus diesem Grund wird oft auch von der
Doppelbremse nach
Westinghouse
gesprochen. Wir müssen uns nun aber das zweite als
Westinghousebremse
bezeichnete System etwas genauer ansehen, denn es arbeitete nach dem
umgekehrten Prinzip und die Druckluft wurde zum lösen benötigt.
Auch diese
Hauptleitung
wurde zu den beiden
Stossbalken
geführt und endete dort in
Luftschläuchen
mit
Absperrhahn.
Damit die Leitung nicht mit der
Regulierleitung
ver-wechselt werden konnte, waren andere
Kupplungen
vorhanden. Eine Bremsung wurde bei diesem System eingeleitet, wenn der Luftdruck in der Haupt-leitung abgesenkt wurde. Das konnte durch das Führerbremsventil, aber auch wegen einer geöffneten Leitung erfolgen. So wirkte die
Bremse
auch beim hinteren Teil, wenn es zu einer
Zugstrennung
gekommen war. Wir haben eine Bremse bekommen, die der Sicherheit diente,
die aber noch ein Pro-blem hatte, denn so konnte kein
Bremszylinder
versorgt werden. Es musste ein Steuerventil eingebaut werden. Dieses stammte ebenfalls aus dem Hause Westinghouse und es war als einlösiges Ventil ausgeführt worden. Wurde die Hauptleitung abgesenkt, steuerte es um und versorgte den Bremszylinder mit Druckluft. Erfolgte jedoch eine Erhöhung des
Luftdruckes
in der
Hauptleitung
löste das
Steuerventil
vollständig. Dabei spielte es keine Rolle, ob der Regeldruck erreicht
wurde, oder nicht. Die beiden Druckluftbremsen nach Westinghouse hatten hier grosse Auswirkungen auf die mechanischen Bremsen. Dabei müssen wir die Bremsen der Lokomotive und des Tenders getrennt ansehen. Wir beginnen mit den Lösungen, die bei der
Lokomotive
eingebaut wurden. Dabei behandeln wir jedoch weiterhin die Modelle, die
mit
Druckluft
ausgerüstet wurden. Bei den Nummern 101 bis 131 war hier schlicht keine
Bremse
vorhanden. Bei den
Lokomotiven
mit
Bremse
wurde ein
Bremszylinder
eingebaut, der mit Hilfe der
Druckluft
ein
Bremsgestänge
so bewegte, dass mit der Luft eine
Bremsung
erfolgte. Wurde diese wieder aus dem
Zylinder
entfernt und sorgte eine Rückholfeder dafür, das die Bremse auch gelöst
wurde. Der Bremszylinder reagierte bei der
Regulierbremse,
aber auch bei der
Westinghousebremse,
auf die genau gleiche Weise.
Jedoch musste diese Nachstellung manuell
und daher im Unterhalt der
Lokomotiven
erfolgen. Ein Punkt, der da-mals nicht anders gelöst werden konnte, da es
nur diese Lösung gab. Wenn wir nun zu den an diesem Bremsgestänge ange-schlossenen Bremsklötze kommen, beginnen die Unter-schiede. Bei den Modellen mit den Nummern 132 bis 136 wurden insgesamt vier Bremsklötze verbaut. Bei den Nummern 141 bis 145 konnte die
Anzahl auf sechs Stück erweitert werden. Mehr
Bremsklötze
waren aber wegen dem Aufbau des
Fahrwerkes
nicht möglich, da die
Triebachsen
zu nahe beisammen standen. Ich habe bereits angedeutet, dass bei den Modellen mit den Nummern 101 bis 131 bei der Lokomotive schlicht keine Bremsen vorhanden waren. Bei diesen wurde eine rein mechanische wirkende Lösung beim Tender ver-wendet. Da nun auch bei den Modellen mit
Westinghousebremse
beim
Kohlenwagen
die gleiche Lösung benutzt wurde, können wir nun alle Maschinen ansehen.
Der Grund war, dass der
Tender
keine
Druckluftbremse
hatte. Der
Tender
wurde mit einer einfachen
Klotzbremse
abgebremst. Bei dieser wurde das
Bremsgestänge
mit einer auf dem
Wasserkasten
montierten
Spindelbremse
bewegt. Diese war so aufgebaut worden, dass die Kurbel arretiert werden
konnte. Daher durfte die
Bremse
des Tenders auch dazu genutzt werden, die abgestellte
Lokomotive
gegen entlaufen zu sichern. Eine Lösung, die bei
Handbremsen
durchaus üblich war.
Bei den Modellen mit
Druckluftbremse
war jedoch kein
Bremszylinder
verbaut worden, so konnten diese
Bremssysteme
den
Tender
nicht beeinflussen, was damals durchaus üblich war. Daher bestand der
Unterschied wirklich nur bei der
Lokomotive,
die unterschiedlich war. Die insgesamt acht am Gestänge
angeschlossenen
Bremsklötze
wirken bei jedem
Rad
des zweiachsigen
Tenders
von beiden Seiten auf die
Lauffläche.
Damit war der Tender sehr gut abgebremst, was sinnvoll war, da die
Lokomotiven
mit den Nummern 101 bis 131 sonst keine
Bremsen
besassen. Der
Kohlenwagen
hatte eine sehr gute Bremswirkung, daher konnten alle
Schlepptenderlokomotiven
ohne Probleme mit dieser Bremse abgestellt werden. Zusammenfassend kann erwähnt werden, dass
effektiv nur die Modelle mit der
Westinghousebremse
über eine gute Bremswirkung verfügten. Das war wichtig, denn mit diesen
Systemen konnten auch die gefahrenen Geschwindigkeiten erhöht werden. Um
in diesem Fall die vorhandenen
Bremswege
einhalten zu können, wurde eine deutlich bessere Bremswirkung benötigt.
Auch das Thema mit den
Bremsrechnungen
kam erst jetzt auf. Es bleibt nur die Frage, warum bei den
Modellen mit den Nummern 101 bis 131 auf eine mechanische
Bremse
bei der
Lokomotive
verzichtet wurde. Der Grund fand sich bei der Ausrüstung der Maschinen mit
einer weiteren mit Dampf betriebenen Bremse. Bevor wir diese jedoch
ansehen können, müssen wir uns dem
Kessel
und damit der Dampferzeugung annehmen, denn ohne diese konnte schlicht
nicht gefahren waren.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2023 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
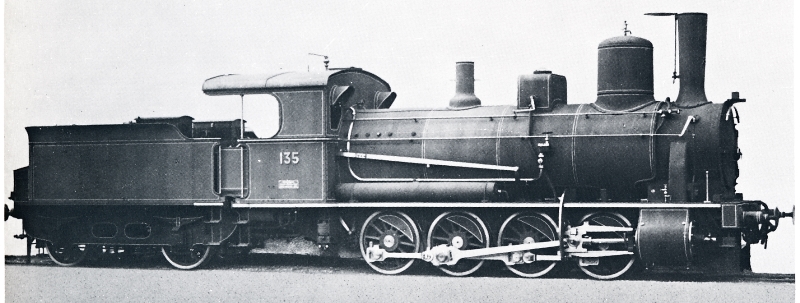 Spannender
waren da schon die Nummern 132 bis 136 und die Modelle 141 bis 145. Diese
Maschinen wurden nach der Einführung der
Spannender
waren da schon die Nummern 132 bis 136 und die Modelle 141 bis 145. Diese
Maschinen wurden nach der Einführung der
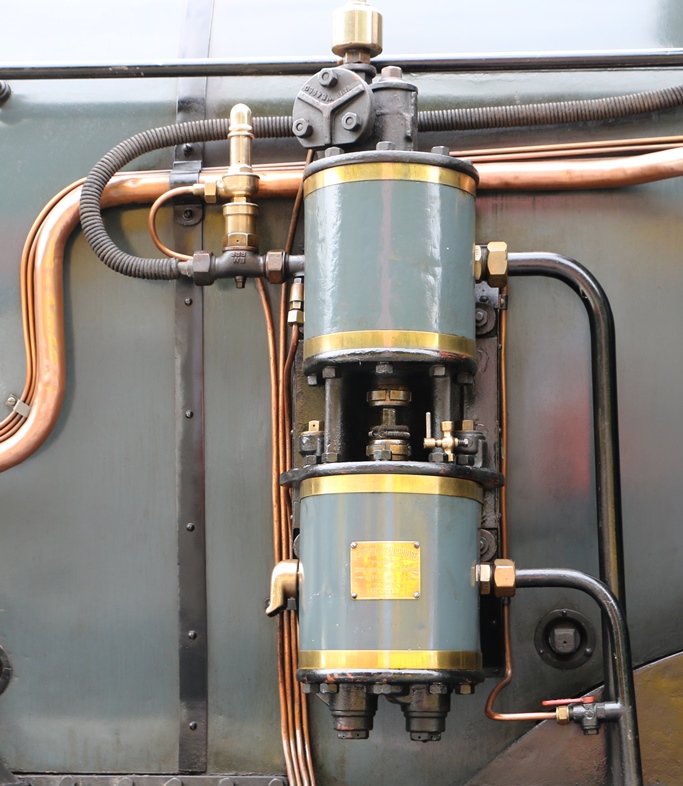 Versorgt
wurde die Pumpe über den
Versorgt
wurde die Pumpe über den
 Wenn
wir uns den Verbrauchern der
Wenn
wir uns den Verbrauchern der  Verwendet
wurden zwei unterschiedliche Systeme, die von der Firma
Verwendet
wurden zwei unterschiedliche Systeme, die von der Firma
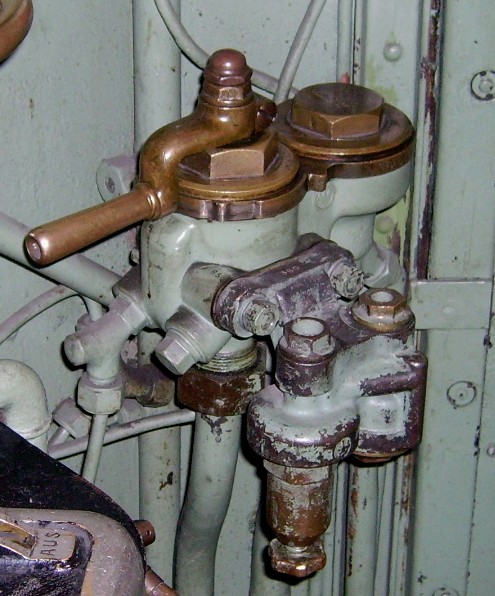 Bei
der
Bei
der
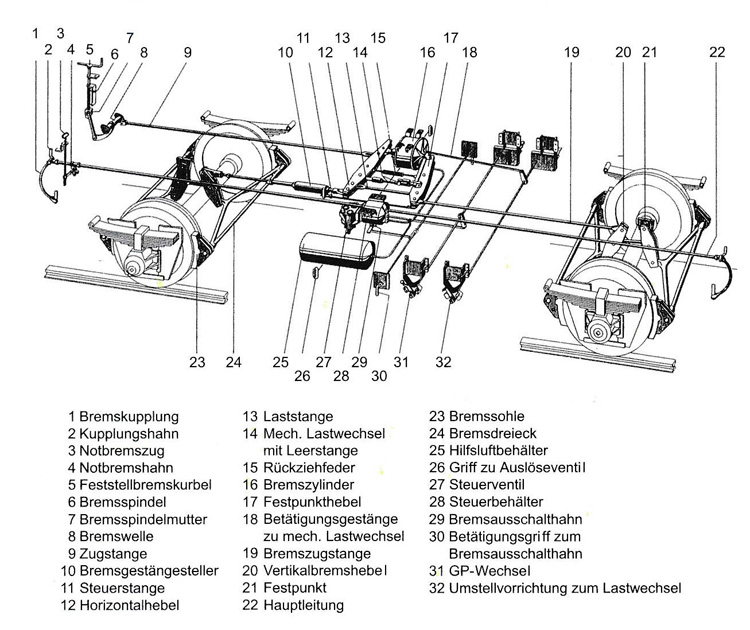 Unterschiede
bei den Modellen mit
Unterschiede
bei den Modellen mit 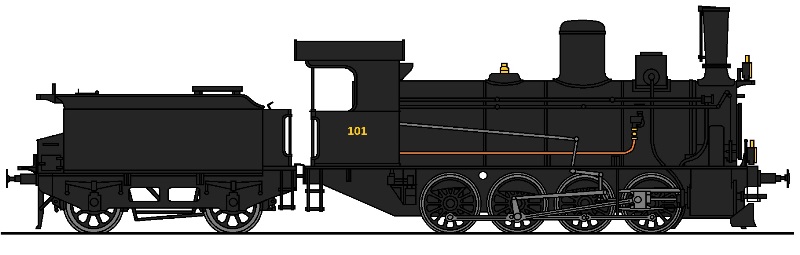 An
der
An
der