|
Der Kastenaufbau |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Für den Kasten und
seinen Aufbau zeichnete sich die Schweizerische Lokomotiv- und
Maschinenfabrik SLM in Winterthur verantwortlich. Ein Unternehmen, das
bisher sehr viel Erfahrung beim Bau von Dampflokomotiven sammeln konnte.
Beim mechanischen Aufbau einer elektrischen Maschine mussten jedoch andere
Lösungen gefunden werden. Dabei spielten die sechs vorgesehen
Triebachsen
der Baureihe Fc 2x 3/3 eine wichtige Rolle.
Das erlaubte, dass er
deutlich leichter gebaut werden konnte. Ein Vorteil, der dann beim Einbau
der elektrischen Ausrüstung genutzt wurde. Trotzdem musste dieser Kasten
auch einen Teil der Last tragen. Wie schon bei der Lokomotive MFO 2 wurde der Kasten aus mehreren Teilen erstellt. Der Boden bildete dabei eine Lokomo-tivbrücke und diese trug die beiden Führerstände und die beiden Seitenwände. Abgedeckt wurde das ganze mit einem Dach.
Wir beginnen die
Betrachtung mit dem Boden und folgen dann den Schritten des Herstellers.
Es entstand so eine Bauweise, die später auch bei anderen Modellen
angewendet werden sollte. Die Lokomotivbrücke war das tragende Element des Kastens. Sie wurde mit einfachen Profilen aus Stahl aufgebaut. Diese wieder-um wurden mit Nieten zum Bauteil verbunden.
Dabei wurden die
Querträger so eingebaut, dass die
Brücke
dort verstärkt wurde, wo grössere Kräfte wirkten. So konnte viel Ge-wicht
eingespart werden, da nicht unnötige Bauteile vorhanden waren. Sie sehen,
man achtete beim Bau sehr auf das Gewicht.
Eine generelle
Abdeckung der
Lokomotivbrücke
gab es nicht. Diese wurde lediglich dort abgedeckt, wo es erforderlich
war. Das waren die Bereiche der
Führerstände
und beim Durchgang im
Maschinenraum.
An anderen Stellen blieb sie daher offen. Eine Lösung, die bereits bei der
erwähnten Musterlokomotive aus den Versuchen im Raum Zürich angewendet
wurde. Damit können wir uns den Aufbauten annehmen und dabei beginnen wir
mit den
Führerkabinen.
Da bei den elektrischen
Lokomotiven die Richtung nicht mehr mit dem
Kamin
definiert werden konnte, wurden in den Unterlagen Nummern ver-geben. Der
Einfachheit wegen, wurde von eins und zwei gesprochen. Die weiteren
Baugruppen wurden entsprechend ausgerichtet.
Meine Wahl fiel auf die
Seite eins und damit auf die vordere
Führerkabine.
Wenn nachfolgend von links und rechts gesprochen wird, ist immer die
Blickrichtung aus dem
Führerstand
eins auf die Strecke massgebend. Wobei dieser Hinweis gerade bei dieser
Maschine keine so grosse Rolle spielt, da beide Seiten nahezu gleich
gestaltet wurden. Lediglich die Führerkabinen wurden gespiegelt, da ja die
Front
nach vorne zeigen sollte.
Die
Führerkabinen
wurden als eigenständige Baugruppen angesehen. Sie wurden auf der
Lokomotivbrücke
mit Hilfe von
Nieten
montiert. Dabei war die Kabine nicht ganz an das vordere Ende der
Brücke
montiert worden. Es entstand so davor eine schmale
Plattform.
Diese war notwendig, da von der BLS ein direkter Zugang vom Zug gewünscht
wurde. Das war wichtig, weil damals auch die
Güterzüge
mit einem
Zugführer
verkehrten.
Sehen wir uns diese
Plattform
genauer an. So war der Zugang nur von einem anderen Fahrzeug und aus dem
inneren der
Lokomotive möglich. Ein Geländer umgab diese Plattform so,
dass auch während der Fahrt kein Absturz möglich war. Im Bereich des
Überganges zur
Anhängelast waren die Stangen des Geländers so nach vorne
verlängert worden, dass seitlich den Bleches zwei gut zugänglich
Haltegriffe entstanden.
War es
jedoch abgeklappt, war zwar der Durchgang frei, aber das Personal musste
auf die kleine nun entstandene Stufe aufpassen. So blieb der Wechsel
während der Fahrt eine abenteuerliche Angelegenheit. Da die Plattform im Bereich der Front nur sehr schmal war, können wir zur Kabine wechseln. Deren Frontwand war in drei Bereiche aufgeteilt worden. Das war die eigentliche quer zur Fahrrichtung montierte Partie und die beiden abgeschrägten Ecken.
Diese
nahmen zusammen in etwa die Hälfte der kom-pletten
Front ein. Zuerst sehen
wir uns aber die mittlere Partie an, denn diese war ebenfalls aufgeteilt
worden. Die Frontwand wurde ebenfalls aufgeteilt. Dabei war die rechte Hälfte als normale Wand ausgeführt worden. In der oberen Hälfte wurde darin jedoch ein grosses Fenster eingebaut.
Dieses bestand aus gehärtetem Glas, das bei einem Bruch keine
scharfkantigen Scherben ergab. Zudem konnte es bei nasser Witterung mit
Hilfe eines
Scheibenwischers gereinigt werden. Dazu wurde an einem
einfachen Arm eine Gummilippe gehalten.
Die linke Hälfte war als Türe
ausgebildet worden. Das in dieser eingelassene Fenster war von gleicher
Grösse. Es war von Aufbau her gleich, konnte jedoch nicht gereinigt
werden. So nahm die Türe nahezu den gesamten linken Bereich ein. Sie wurde
mit normalen Türfallen versehen. Wurden diese gedrückt, öffnete sich der
Durchgang gegen die
Plattform hin. So war gesichert, dass sich die
geschlossene Türe durch den Fahrtwind nicht öffnete.
Bisher waren die beiden
Fronten
identisch. Jedoch gab es beim
Führerstand eins an der rechten Kante zur
Eckpartie noch eine
Dachleiter. Diese konnte bei Bedarf ausgeklappt
werden. Damit war von der
Plattform aus der Zugang zum Dach möglich. Damit
auch sie sich nicht ungewollt öffnen konnte, wurde auch sie mit einfachen
Riegeln im geschlossenen Zustand gehalten. Wichtig war das, da im
geöffneten Zustand die Bügel gesenkt wurden.
Es wird nun Zeit, dass wir uns
den beiden Eckbereichen zuwenden. Diese waren identisch aufgebaut worden.
Sie wurden nach hinten gezogen und sollten so den Fahrtwind etwas besser
zur Seite ablenken. Unterschiedlich waren nur die darin eingelassenen
grossen Fenster. Das Fenster auf der rechten Seite hatte, wie das dortige
Frontfenster einen
Scheibenwischer erhalten. Aber sonst entsprachen sie
den anderen Fenstern.
Dort hatte man
erkannt, dass mit den zur Spitze gerichteten
Führerständen eine bessere
Sicht auf die Strecke möglich wurde. Das wollte man nicht mehr mit kleinen
Fenstern verhindern. Die beiden Seitenwände des Führerstandes bestanden aus der Einstiegstüre und nur einer schmalen Wand, die gegen die Front gerichtet wurde. Auch diese Türe besass ein grossen Fenster.
Im Gegensatz zu den anderen Fenstern der Kabine konnten hier die
Scheiben jedoch geöffnet werden. Dazu waren sie in Führungen eingebaut
worden. In diesen konnte die Scheibe nach unten gleiten. Damit es
geschlossen blieb, wurden Stellschrauben verwendet. Geöffnet werden konnte diese Türe mit einer unter dem Fenster montierten Klinke. Wurde diese gedrückt, konnte die Einstiegstüre nach innen geöffnet werden.
Dabei war das
Scharnier so aufgebaut worden, dass die Öffnung gegen die Mitte der
Lokomotive erfolgte. Der Zugang zum
Maschinenraum
war jedoch in diesem
Zustand verhindert. Doch dazu kommen wir später, denn das Personal musste
auch einsteigen können. Um die Höhe des Fussbodens vom Boden auch zu erreichen, wurde unterhalb der Türe eine Leiter mit drei Sprossen eingebaut. Diese war nicht senkrecht ausgeführt worden, sondern sie stand nach unten etwas vor.
Zudem war sie recht massiv ausgeführt
worden. Dieser Aufbau war jedoch nicht für den Komfort des Personals
gedacht, sondern um den Platz für das unter dem Kasten montierte
Drehgestell
zu bekommen.
Damit sich das Personal beim
Einstieg festhalten konnte, waren auf beiden Seiten der Leiter und der
Türe
Griffstangen montiert worden. Diese halfen auch, um die Lücke
zwischen Boden und unterster Sprosse besser zu bewältigen, denn diese war
recht hoch. Auch so musste der Aufstieg zweimal gemacht werden, denn bei
geschlossener
Einstiegstüre konnte die Türfalle zum öffnen vom Boden aus
nicht erreicht werden.
Abgeschlossen wurde die so
aufgebaute
Führerkabine mit einer einfachen gegen den
Maschinenraum
gerichteten Wand. In dieser waren lediglich die Türe für den Zugang
enthalten. Dieser war auf beiden Seiten möglich und er erlaubte nicht nur
den Wechsel des Arbeitsplatzes, sondern bot auch den Zugang zu dem in
diesem Bereich eingebauten elektrischen Bauteilen. Der Zugang zum
Maschinenraum war auch im eingeschalteten Zustand erlaubt.
In diesem Punkt, war die Reihe Fc 2 x 3/3 besser
aufgestellt, als das Modell für
Schnellzüge, das von der Firma AEG gebaut
wurde und das nur kleine Fenster erhalten hatte.
Damit zwischen den beiden
Führerständen überhaupt ein Raum entstehen konnte, wurden zwei Seitenwände
aufgebaut. Diese wurden identisch ausgeführt, so dass wir auch jetzt nur
eine Seite ansehen müssen. Dabei erübrigt sich sogar die Wahl. Im
allgemeinen Überblick erkannte man, dass die Seitenwände gegenüber der
Kabinen etwas weiter aussen montiert wurden. Daher war die Grenze am
Absatz sehr gut zu erkennen.
Die Seitenwand selber bestand
aus 13 Segmenten. Diese waren jeweils durch ein senkrechtes Nietenband
verbunden worden. Unter diesen Bändern waren
Portale vorhanden, die der
Seitenwand die notwenige Stabilität ermöglichten. Dieser Aufbau hatte den
Vorteil, dass er leicht war und dass die einzelnen Segmente mit lösen der
Nieten geöffnet werden konnten. So war im Unterhalt ein guter Zugang
vorhanden.
Es wurden zwei unterschiedliche
Segmenttypen verwendet. Dabei gab es solche, die eine geschlossene Wand
bildeten. Im Wechsel dazu waren dann die Elemente verbaut worden, die im
oberen Bereich zusätzlich ein grosses Fenster bekommen hatten. Es waren
sieben Segmente ohne und sechs Elemente mit Seitenfenster vorhanden. Dabei
begann die Wand immer mit einem geschlossenen Segment. Doch spannender
waren jene mit Fenster.
Unterschiede zwischen den sechs Fenstern gab es jedoch nur bei deren
Montage. Daher müssen wir auch hier genauer hin-sehen, und dabei beginne
ich mit dem einfacheren Einbau. Die unmittelbar in der Nachbarschaft der Führerstände einge-bauten Fenster waren fest im Segment eingebaut worden. Im Gegensatz zur Lokomotive der AEG waren sie von innen mon-tiert worden.
Daher war bei diesem Fahrzeug der dazu benötigte
Messing-rahmen nicht zu erkennen. Eine Auswirkung hatte diese Änder-ung
jedoch erst beim Anstrich. Doch noch fehlen uns die vier mittleren
identischen Fenster der beiden Seitenwände. Hier wurde die Scheibe in einer Führung gehalten. Dadurch konnten sie, nach lösen der Stellschraube, wie die Fenster des Führerstandes geöffnet werden. Dabei konnten die Senkfenster komplett offen stehen.
Eine Lösung, die bei heissen Tagen eine
verbesserte Belüftung erlaubte, die aber auch als Fluchtweg für das
Personal gedacht war. Konnten zum Verlassen nicht die normalem Türen
genutzt werden, konnte das Personal durch die Lücke dieser Fenster
schlüpfen.
Bis jetzt sind sowohl die
Führerstände, als auch der
Maschinenraum nach oben offen. Das konnte so
nicht belassen werden, da das Personal bei der Arbeit nicht gerne im Regen
stand. Jedoch hätte dieser für die elektrischen Baugruppen einen
wesentlich grösseres Problem ergeben. Es war daher wichtig, dass der
Kasten mit einem Dach abgedeckt wurde. Diese müssen wir und daher auch
noch ansehen, und das bot sogar optisch viel.
Das komplette Dach war leicht
gewölbt und wurde lediglich auf die Breite der
Führerkabinen beschränkt.
Wobei das nicht ganz stimmt, denn seitlich stand es im Bereich der Türen
etwas vor. So wurde verhindert, dass das Dachwasser, das seitlich abfloss,
der Wand entlang lief und so in den
Führerstand gelangen konnte. Besonders
bei offenem Fenster war das eine grosse Gefahr. Eine einfache aber gut
durchdachte Lösung.
Es entstand so die Bauweise, wie sie noch bei
vielen anderen
Lokomotiven angewendet werden sollte. Somit war auch der
Maschinenraum optimal abgedeckt worden. Wir können uns nun den Auf-bauten
zuwenden. Mittig auf dem Dach war ein flacher Aufbau vorhanden. Dieser besass die gleiche Wölbung wie das Dach, jedoch seitliche Lüftungsschlitze. Da darunter das Dach geöffnet wurde, konnte über diesen Dachaufbau die im Maschinenraum erwärm-te Luft nach oben entweichen.
Durch die thermischen Effekte unterstützt, entstand so eine
einfache
Kühlung für diesen Raum. Da der Boden offen war, funktionierte
das auch bei ge-schlossenen Fenstern.
Wichtig für den Unterhalt waren
die auf dem Dach montierten seitlichen Stege. Diese verliefen entlang der
Dachkante über das ganze Fahrzeug. Bei den Stegen wurden in den Fassungen
aus Stahl einfache Holzbalken eingelegt und mit Schrauben befestigt. Auch
diese Lösung sollte das Erscheinungsbild von vielen Schweizer
Triebfahrzeugen prägen. Das Personal fand auf dem Dach einen sicheren
Stand und drohte weniger abzustürzen.
Noch können wir das Dach nicht
abschliessen. Über der
Frontwand wurde noch ein Schutzgestell montiert.
Dieses bestand aus einfachen Stäben und wirke fast wie ein Geländer. Wie
bei diesem war auch hier der Schutz sehr wichtig. Wurde der
Stromabnehmer
während der Fahrt beschädigt, konnten so die Teile nicht in den Bereich
zwischen
Lokomotive und Wagen fallen. Allenfalls sich dort befindliches
Personal war so etwas vor den schweren Teilen geschützt.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2022 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 So
lange starre
So
lange starre 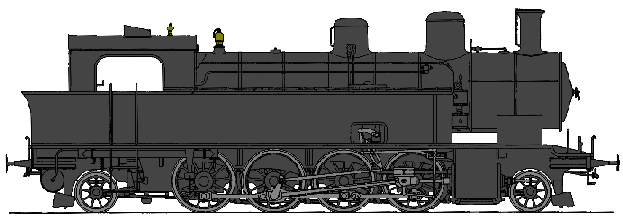 Mit
geringen Abweichungen waren die beiden
Mit
geringen Abweichungen waren die beiden
 Das Blech selber wurde an der
Das Blech selber wurde an der
 Auch wenn zwischen den vier
Fenstern breite Säulen vorhanden waren, konnte die Strecke vom Personal
überraschend gut beobachtet werden. Hier spielten die mit den
Auch wenn zwischen den vier
Fenstern breite Säulen vorhanden waren, konnte die Strecke vom Personal
überraschend gut beobachtet werden. Hier spielten die mit den
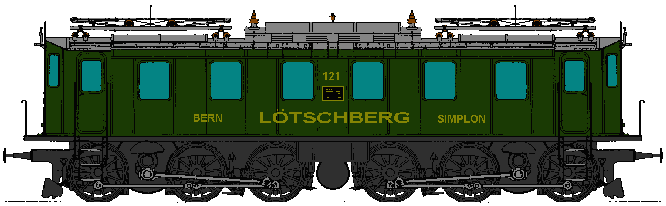 Wir können nun die beiden
Wir können nun die beiden
 Es wurden auch hier Scheiben
aus gehärtetem Glas verwendet. Jedoch war hier deren Belastung nicht so
gross, wie bei den
Es wurden auch hier Scheiben
aus gehärtetem Glas verwendet. Jedoch war hier deren Belastung nicht so
gross, wie bei den
