|
Pimärstromkreis Ee 6/6 II |
|||||||||||
| Navigation durch das Thema | |||||||||||
|
Wir kommen nun zu den grössten Unterschieden zwischen den
Baureihen.
Es ist die Bereitstellung der für den Betrieb erforderlichen Energie. Bei
der Baureihe Am 6/6 wurde ein
Dieselmotor
verwendet. Für die
Rangierlokomotive
Ee 6/6 II kam jedoch ein
Primärstromkreis
dazu. Sollten Sie sich für eine dieser beiden Varianten speziell
interessieren, dann können Sie in der nun folgenden Tabelle auf die andere
Variante wechseln. |
|||||||||||
|
Thermische Ausrüstung Am 6/6 |
Primärstromkreis Ee 6/6 II |
||||||||||
|
Wir kommen nun zur elektrischen Versorgung der
Rangierlokomotive
Ee 6/6 II und diese erfolgte über die
Fahrleitung.
Für diese galt, dass sie nach den Normen der Schweizerischen Bundesbahnen
SBB aufgebaut sein musste und dass daher mit einer
Spannung
von 15 000
Volt
und 16 2/3
Hertz
gearbeitet wurde. Andere Werte bei der
Fahrleitungsspannung
waren jedoch weder vorgesehen, noch wurden diese vom Besteller verlangt.
Daher wurde das Dach weit über die
Frontwände
hinaus verlängert. Der nun vorhandene Platz war für die Bauteile der
elektrischen Ausrüstung aus-reichend vorhanden und so konnten die
einzelnen Elemente aufgebaut wer-den. Beim verwendeten Stromabnehmer suchte man nicht nach einem neuen Mo-dell. Auch hier galt, dass diese in einem Depot viel Platz wegnahmen und daher sollten so wenige unterschiedliche Modelle, wie nur möglich verwendet werden.
Wegen dem Platz auf dem Dach und weil man moderne Modelle
verwenden wollte, war klar, dass kein alter
Scherenstromabnehmer
aufgebaut wurde. Daher entschied man sich für das Modell der
Baureihe
Re 4/4 II. Dieser Einholmstromabnehmer wurde auf der hinteren Seite des Daches über dem Vorbau zwei aufgebaut. Wegen den erforderlichen Anschlüssen musste dieser so platziert werden, dass sich der Knick über dem Führerhaus befand. Er
öffnete sich gegen das Ende des Daches. Bei einer umgekehrten Montage
hätten die Leitungen über das Vordach geführt werden müssen und das wollte
man wegen einem möglichst einfachen Aufbau vermeiden.
Gehoben wurde das Modell mit der Hilfe von
Federn. Mit
Druckluft
wurde dabei die Kraft der
Senkfeder
aufgehoben. Dadurch konnte die
Hubfeder
ihre Kraft entfalten und der Bügel hob sich. Traf dieser auf ein
Hindernis, wie dem
Fahrdraht,
drückte die Feder den Kontaktbereich mit dem einstellbaren
Anpressdruck
dagegen. Eine
Höhenbegrenzung
verhinderte, dass sich der
Stromabnehmer
bei einer fehlenden
Fahrleitung
durchstrecken konnte.
Diese Abschlüsse waren isoliert ausgeführt worden und so konnte
die Breite des
Schleifstückes
von 1 320 mm auf 1 450 mm erhöht werden. Es war somit das aktuell übliche
Modell, das in grosser Stückzahl vorhanden war. Gesenkt wurde dieser Einholmstromabnehmer mit der Druckluft. Diese wurde über ein Ventil mit grosser Geschwindigkeit aus dem Zylinder gelassen. Der dabei auftretende kurze Unterdruck riss das Schleifstück vom Fahrdraht weg. Die
Senkfeder
sorgte nun dafür, dass der Bügel sanft auf die
Lager
abgesenkt wurde. Dort blieb er, weil die
Feder
verhinderte, dass er durch den Fahrtwind angehoben werden konnte. Die nun auf das Fahrzeug übertragene Spannung der Fahrleitung wurde in eine Leitung übertragen und diese anschliessend zum ebenfalls auf dem Dach mon-tierten Spannungswandler geführt.
Dieser war für die Anzeige der
Fahrleitungsspannung
vorgesehen und so konnte diese hier vor dem Einschalten der
Lokomotive
erkannt werden. Eine Funktion die damals noch neu war, denn bisher musste
immer ein Versuch unternommen werden.
Mit dieser vor dem
Hauptschalter
befindlichen Anzeige der
Fahrleitungsspannung
sollten die immer wieder vorkommenden fehlerhaften Einschaltversuche
vermieden werden. Das Problem bei diesen Versuchen war, dass es zu einem
Lichtbogen
zwischen dem
Fahrdraht
und dem
Schleifstück
kommen konnte. Bis das
Relais
den Schalter wieder öffnete, konnte die
Kohle
durchaus in Brand geraten und das war nicht gut.
Da dieser über Bedienelemente unter dem Dach verfügte, musste man
ihn so platzieren, dass er im
Führerhaus
nicht in den Bereich des Lokführers reichte. Mit den
Dachleitungen
war das möglich und daher verteilten sich die Bauteile. Auch beim Hauptschalter setzte man auf ein bewährtes Modell, das ebenfalls von der Baureihe Re 4/4 II stammte. Es war ein Drucklufthauptschalter vom Typ DBTF, der auf dem Dach eigentlich nur die Schaltkontakte hatte.
Die benötigte Versorgung und die für die Schaltung benötigten
Bauteile befanden sich in einem Gehäuse, das in den
Führerstand
ragte. Hier befanden sich die Bedienelemente, die für die Schaltung per
Hand benötigt wurden. Mit Druckluft wurde ein Trennmesser geschlossen und so der Kontakt herge-stellt. Die Fahrleitungsspannung gelangte danach in die weiteren Bauteile. Jedoch war nicht der Vorgang zum einschalten das Problem, sondern der umgekehrte Fall.
Bei der hohen
Spannung
in der
Fahrleitung
hätte der beim Öffnen des
Hauptschalters
entstehende
Lichtbogen
zur Zerstörung des
Trennmessers
geführt. Daher wurde in zwei Schritten ausgeschaltet.
Das Problem dabei war, dass der Kontakt bei zu geringer
Druckluft
zerstört werden konnte. Der Grund war die zu geringe Kraft um den
Lichtbogen
zu löschen. Damit es damit zu keinen Problemen kommen konnte, war eine
Niederdruckblockierung
vorhanden. Diese verhinderte, dass bei zu geringem Wert bei der Druckluft
der
Hauptschalter
geöffnet werden konnte. Ein Umstand, der aber bei den bisherigen
Anwendungen kaum für Probleme sorgte.
Während der
Hauptschalter
auch von Hand eingeschaltet werden konnte, musste für den
Stromabnehmer
Druckluft
benutzt werden. Für diesen war eine
Handluftpumpe
vorhanden. Dabei wurde vorgängig der Haupt-schalter von Hand
eingeschaltet. Jetzt wurde die
Niederdruckblockierung
aktiv und verhinderte, dass der Schalter geöffnet wurde. Berührten die
Schleifleisten
den
Fahrdraht,
schaltete die
Lokomotive
ein und die Druckluft wurde ergänzt.
Um gefahrlos an der elektrischen Ausrüstung arbeiten zu können,
konnte die Anlage mit der Erde verbunden werden. Dieser zusätzliche
Erdungsschalter
war parallel zum
Hauptschalter
aufgebaut worden. Er konnte jedoch nur bedient werden, wenn der
Stromabnehmer
gesenkt worden war. Ein System mit Schlüsseln sorgte dafür, dass das
sicher erfolgte. Auch hier befanden sich die Bedienelemente im
Führerhaus
und auf dem Dach nur die Kontakte.
Mit dem
Hauptschalter
endete die Ausrüstung auf dem Dach der
Lokomotive.
Die nun geschaltete
Hoch-spannung
wurde in einem Kabel entlang der
Frontwand
in den
Vorbau
geführt. Dazu wurde ein spezielles und zudem auch mehrfach isoliertes
Hochspannungskabel
verwendet. Das Kabel endete bei den Anschlüssen des sich im Vorbau
befindlichen
Transformators.
Eine weitere Möglichkeit eine Schaltung vorzunehmen, gab es jedoch nicht.
Damit sind wir bei der
Primärspule
des
Transformators
angekommen. Diese war auf der anderen Seite mit dem Rahmen verbunden
worden. In der
Wicklung
gab es keine
Anzapfungen,
so dass wir eine einfache Lösung haben. Wichtig war diese
Spule,
weil sie einen
Widerstand
bot und so den
Strom
in der Zuleitung beschränkte. Das war wichtig, weil die
Lokomotivbrücke
gegen die Erde geschaltet sein musste, damit man gefahrlos in die
Lokomotive
kam.
Die
Lokomotivbrücke
war wiederum über die
Erdungsbürsten
mit den
Schienen
im Kontakt. Dabei waren diese Kontakte bei allen
Achsen
vorhanden und die Elemente waren unterschiedlich lang. Es entstand so ein
geschlossener
Stromkreis
und es konnte vom
Kraftwerk
elektrische Energie auf das Fahrzeug übertragen werden. Das einzige was
man damit machte, ist ein Magnetfeld im
Transformator,
denn dieses wurde benötigt.
Ebenfalls ein Teil des
Transformators
waren die sekundären
Spulen.
Es gab mehrere davon, die nicht mit einer
Anzapfung
versehen worden waren. Durch das von der
Primärspule
erzeugte Magnetfeld wurde in diesen
Wicklungen
wieder eine elektrische
Spannung
erzeugt. Es war daher eine galvanische Trennung der beiden
Stromkreise
vorhanden. Eine Bauweise von Transformatoren, die sich damals längst
durchgesetzt hatte.
Die
Sekundärwicklungen
wurden mit dem
Stromrichter
verbunden. In der Leitung war jedoch kein Schalter eingebaut worden. Es
gab keinen Schalter in dieser Zuführung, denn ein Defekt an diesen
Bauteilen hätte zu einem Totalausfall geführt. Eine
Redundanz,
wie sie heute üblich ist, gab es damals oft nur bei
Triebfahrzeugen,
die im
Streckendienst
eingesetzt wurden.
Rangierlokomotiven
hatten immer eine einfache Ausrüstung.
Es wurde dabei eine
Spannung
von 1500
Volt
Gleichstrom
abgegeben, der dann direkt an den
Zwischenkreis
abge-leitet wurde. Damit haben wir eigentlich den Teil bereits
abgeschlossen.
Der
Stromrichter
war jedoch nicht mit
Dioden
aufgebaut worden. Hier wurden dazu
Thyristoren
verbaut. Diese Schaltelemente waren als 4 Quadraten Steller aufgebaut
worden. Eine Schaltung, die heute durchaus üblich ist, wobei nun
Transistoren
benutzt werden. Die Thyristoren mussten gleich geschaltet werden, da es
die
GTO
mit einer einfacheren Schaltung noch nicht gab. Der Aufbau hatte auf die
Lokomotive
jedoch Auswirkungen.
Sowohl
Transformator,
als auch der Eingangsstromrichter waren massive Bauteile. Damit man diese
in dem
Vorbau
unterbringen konnte, musste deren Baugrösse verringert werden. In der
Folge konnte die elektrische
Rangierlokomotive
Ee 6/6 II nicht die gleiche
Leistung
abgeben, als das bei der
Diesellokomotive
Am 6/6 der Fall war. Erst die schon erwähnten
GTO,
oder die heute üblichen
IGBT,
hätten bei gleichem Platz mehr Leistung erlaubt.
Damit können wir den
Primärstromkreis
der
Rangierlokomotive
Ee 6/6 II bereits abschliessen. Sollten Sie sich noch nicht mit der
Baureihe
Am 6/6 befasst haben, können Sie
hier klicken und sich den thermischen Teil dieser Maschine ansehen. Ab
dem
Zwischenkreis
gab es zwischen den Maschinen keine grossen Unterschiede mehr, auch wenn
wir später noch schnell in diesen Bereich zurück kehren müssen, denn es
fehlt noch der Grund für den
Stromrichter.
|
|||||||||||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |||||||||
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | ||||||||
|
Copyright 2025 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||||||||||
 Um
die
Um
die
 Auf
dem Bügel wurde das
Auf
dem Bügel wurde das  Es
war nun eine weitere
Es
war nun eine weitere

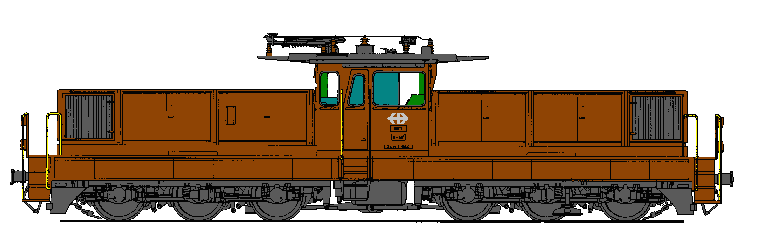 Wenn
wir nun beim
Wenn
wir nun beim