|
Druckluft und Bremsen |
|||||||||||
| Navigation durch das Thema | |||||||||||
|
Wie bei jeder
Lokomotive
mit modernen
Bremsen
wurde
Druckluft
benötigt. Diese wurde auf dem Fahrzeug hergestellt und dabei nutzte man
die komprimierte Luft längst auch für andere Aufgaben. Wir sollten daher
einen genaueren Blick auf den Aufbau werfen und dabei kommen wir zur
Erzeugung der Druckluft und die war bei beiden
Baureihen
identisch ausgeführt worden. Das ging, weil elektrisch gearbeitet wurde.
Es handelte sich dabei um einen ganz normalen Kolben-kompressor, wie er damals bei den Schweizerischen Bundesbahnen SBB auch bei anderen Baureihen verbaut wurde.
Genauer ansehen müssen wir uns nur die beiden zu-sätzlichen
Buchstaben am Schluss der technischen Be-zeichnung. Das bekannte Modell wurde hier mit einem Zusatz ver-sehen. Bei der Herstellung von Druckluft wird diese er-wärmt. Während der Abkühlung wird dann Feuchtigkeit ausgeschieden.
Um diese nicht im gesamten System zu haben, wurde nach dem
Kompressor
ein
Kühler
eingebaut. Die Luft schied so die Feuchtigkeit sofort wieder aus und
konnte im folge-nden
Wasserabscheider
aus dieser entfernt werden. So kam weniger Wasser in die Leitungen.
Gerade der Luftkühler und der
Wasserabscheider
zeigten, dass durchaus neue Wege beschritten wurden. Noch standen die
optimal arbeitenden
Lufttrockner
nicht zur Verfügung. Mit der
Kühlung
und dem Abscheider konnten nahezu gleiche Effekte erzielt werden. Wir
haben somit eine Erzeugung der
Druckluft
erhalten, die auf den neusten Stand der Technik war, auch wenn man das
anhand des
Kompressors
nicht erwarten konnte.
Wenn wir noch bei der Zuleitung zu den
Hauptluftbehältern
bleiben, dann muss das hier verbaute Rückschlagventil und natürlich auch
die Begrenzung des maximalen Druckes erwähnt werden. Während das
Rückschlagventil verhinderte, dass die Luft über den
Kompressor
entweichen konnte, öffnete das
Überdruckventil,
wenn der Wert in der Leitung den eingestellten Wert von zehn
bar
überschritt. Das
Ventil
schloss bei tieferem Druck wieder.
Bei den Lokomotiven waren davon zwei Stück eingebaut worden und jeder davon konnte einen Luftvorrat von 500 Liter aufnehmen.
Bei der
Baureihe
Am 6/6 gab es je-doch wegen dem
Dieselmotor
noch weitere
Luftbehälter.
Auch sonst gab es bei den
Hauptluftbehältern
einen wichtigen Unterschied. Es waren Absperrhähne vorhanden, die dafür sorgten, dass die Druckluft in den Behältern gefangen wurde.
Diese waren bei beiden
Baureihen
vor-handen, weil mit diesen Hähnen auch die Steuerung und damit die
Sicherheitseinrichtungen
aktiviert wurden. Besonders wichtig war der Erhalt des Vorrates aber nur
bei der Baureihe Ee 6/6 II, weil diese
Druckluft
benötigte um in Betrieb genommen zu werden, denn es war ja die elektrische
Lösung.
Weil der Vorrat bei der
Baureihe
Ee 6/6 II so wichtig war, wurde sie mit einer üblichen
Handluftpumpe
versehen. Mit dieser konnte bei einem zu geringen Vorrat, die für den
Stromabnehmer
benötigte
Druckluft
hergestellt werden. Bei der Reihe Am 6/6 war das nicht erforderlich, da
der
Dieselmotor
durchaus auch ohne Druckluft gestartet werden konnte. Es war als nur ein
der Technik geschuldeter Unterschied bei der Druckluft.
Die primäre Leitung wurde jedoch nicht direkt zu den Verbrauchern
geführt. Wie bei
Lokomotiven
in der Schweiz üblich, endete diese Leitung in einem
Luftgerüst
mit den Bedienelementen. In diesem zentralen Luftgerüst wurden sämtliche Absperrhähne zusammengefasst. Hier befanden sich aber auch die Ventile für die Anpassung der Luftdrücke, aber auch für Schaltungen.
Der Vorteil dieser
Luftapparategerüste
war, dass durch die hier vorhandene Anordnung sehr leicht erkannt werden
konnte, dass eine Absperrung vorgenommen wurde. Um-gekehrt waren die
Bedienelemente so deutlich schneller zu finden. Mit dem Luftgerüst sind wir nun an einem Punkt angelangt, an dem sämtliche an der Druckluft angeschlossenen Verbraucher abgenommen wurden. Das galt zum Beispiel auch für die elektrischen Komponenten der Reihe Ee 6/6 II, die mit Druckluft betrieben wurden.
Das waren in erster Linie der
Stromabnehmer
und der ebenfalls benötigte
Haupt-schalter.
Baugruppen, die natürlich bei der
Diesellokomotive
nicht vorhanden waren. Längst wurden auch andere Baugruppen mit Druckluft betrieben. Bereits kennen gelernt haben wir die Sandstreueinrichtung und die Spurkranzschmierung. Das hier benutzt spezielle Öl wurde mit Hilfe der Druckluft an die richtige Stelle geblasen.
Bei der
Baureihe
Am 6/6 kamen noch die Klappen für die
Bremswiderstände
dazu. Mit Hilfe der
Druckluft
wurden diese Bauteile bei Bedarf geöffnet und auch wieder ge-schlossen.
Durchaus auch von anderen
Baureihen
her bekannt, ist die
Lokpfeife.
Die auf diesen Maschinen eingebauten Lösungen entsprachen den Normen der
Staatsbahnen.
Diese
Pfeife
konnte mit zwei
Luftdrücken
betrieben werden. Die in der Schweiz bekannten akustischen Signalbilder
wurden mit der Abfolge dieser beiden Luftdrücke durch das Personal
erzeugt. Daher waren diese Signale je nach Besatzung unterschiedlich zu
hören.
Wir beginnen die Betrachtung dieser Baugruppen mit der einfachsten
Bremse,
die hier sogar noch wichtiger wurde als das bei anderen
Baureihen
der Fall war. Mit der
Schleuderbremse
konnte wirklich mehr angestellt werden, als das sonst üblich war. Die Schleuderbremse war dazu da, mit einem geringen Luftdruck von 0.8 bar eine durchdrehende Achse aufzufangen. Dabei konnte durch die Steuerung jede Achse einzeln geregelt werden. Wurde diese Bremse jedoch vom Personal betätigt wirkte die Bremse auf das ganze Fahrzeug.
In jedem Fall war es jedoch nur möglich den erwähnten
Luftdruck
zu er-zeugen. Die
Schleuderbremse
war angezogen oder gelöst, andere Stellungen gab es nicht. Hier wurde die Schleuderbremse jedoch weitaus öfters genutzt. Mit Hilfe dieser Bremse wurde ein Luftdruck in den Zylindern erzeugt, wenn die Lokomotive still stand.
Daher war hier eine automatische Stillstandsbremse vorhanden.
Nötigt wurde diese, weil durch den Aufbau des
Antriebes
die
Lokomotive
sehr leicht ins rollen geraten konnte. Damit das nicht unbeaufsichtigt
erfolgte, war die Stillstandsbremse verbaut worden.
Wenn wir zum zweiten
Bremssystem kommen, dann ist das die
direkte Bremse,
die oft auch als
Rangierbremse bezeichnet wurde. Speziell war hier, dass
diese nicht in jedem Fall aktiviert wurde. Wurde eine
Bremsung mit dieser
Lösung verlangt, aktivierte sich zuerst die
elektrische
Bremse der
Lokomotive. Erst wenn diese nicht ausreichte oder die Geschwindigkeit auf
einen Wert von unter acht Kilometer in der Stunde sank, wirkte die
Rangierbremse.
Speziell war, dass damit die normalen Bremskräfte erzeugt werden konnten. Da diese Bremse jedoch nur auf das Fahrzeug wirkte, konnte sie bei der Berechnung der Bremse nicht ange-rechnet werden.
Im Notfall war aber die gleiche Kraft
vorhanden, was jedoch sehr selten an-gewendet werden sollte. Weitaus mehr angewendet werden konnte die Möglichkeit diese Rangier-bremse mit EP-Ventilen auch über ein Funksignal zu aktivieren.
So war es dem
Rechner für den Ablaufbetrieb möglich die
Verschublokomotive zu
regulieren. Speziell war, dass diese Lösung jedoch nur bei der
Baureihe Am
6/6 genutzt wurde, denn nur im RBL wird mit dieser Möglichkeit gearbeitet.
Die Reihe Ee 6/6 II war aber auch damit versehen worden.
Mit der
Schleuderbremse, der Stillhaltebremse und der
Rangierbremse haben
wir
Bremssysteme erhalten, die nur auf die bediente
Lokomotive wirkten.
Wurde diese nicht direkt mit Personal besetzt, oder musste auch die
Anhängelast gebremst werden, nutzte man das dritte verbaute Bremssystem.
Diese arbeitete nach einen anderen Prinzip, bei dem die
Bremsung durch den
Druckabfall in einer Leitung eingeleitet wurde. Es lohnt sich ein genauer
Blick.
Bei dieser als
automatische Bremse bezeichneten Lösung wurde mit dem
Bremsventil eine als
Hauptleitung bezeichnete Leitung mit
Druckluft
gefüllt. Dabei musste in dieser ein Druck von fünf
bar erreicht werden.
Diese Leitung wurde zudem zu den beiden
Stossbalken geführt und stand dort
jeweils in zwei
Luftschläuchen mit der genormten
Kupplung und einem am
Stossbalken selber montierten
Absperrhahn anderen Fahrzeugen zur
Verfügung.
Sowohl eine geöffnete Leitung, als auch eine der verbauten Sicherheits-einrichtungen führten unweigerlich dazu, dass die Hauptleitung komplett entleert wird.
Dies erfolgte jedoch immer gegen das
Bremsventil,
dass in dem Fall versuch-te den Druck in der Leitung wieder herzustellen. Durch den Druckabfall reagierte das auf der Lokomotive verbaute Steuer-ventil. Diese wurde von der Firma Oer-likon Bremsen geliefert.
Daher wurde hier oft auch von einer Oerlikon
Bremse gesprochen. Das hier
verwendete
Steuerventil war mehrlösig und es konnte sowohl die normale
Personenzugsbremse, als die
G-Bremse erzeugen. Eine Möglichkeit, auch die
R-Bremse zu aktivieren gab es jedoch nicht, da dazu zu langsam gefahren
wurde.
Bedingt durch den Aufbau dieses
Steuerventils, konnten bei beiden
Bremsarten die gleichen Kräfte erzeugt werden. Der Unterschied befand sich
daher nur bei der Zeit, die benötigt wurde, bis der maximale
Luftdruck im
Bremszylinder von 3.9
bar erreicht wurde. Auch bei den Lösezeiten ergaben
sich Unterschiede. Wir werden später noch einmal zu diesem Steuerventil
und den damit vorhandenen
Bremsen zurückkehren.
Auch wenn ich bisher vom
Bremszylinder gesprochen habe, es waren mehrere
davon vorhanden. Die Vorschriften zum befahren von
starken Gefällen sah
neben der verschleisslosen
Bremse auch ein geteiltes
Bremsgestänge vor.
Hier ging man sogar noch einen Schritt weiter und so hatte jedes
Rad
seinen eigenen Bremszylinder erhalten. Die jeweils gegen die Mitte der
Lokomotive gerichteten Räder hatten sogar zwei erhalten.
Eine
Rückholfeder sorgte dafür, dass beim Entweichen der
Druckluft der
Kolben
wieder in seine ursprüngliche Position verbracht wurde. Es war der gleiche
Aufbau, der nun wirklich bei jedem
Rad vorhanden war. Das Bremsgestänge konnte mit Hilfe des Bremsge-stängestellers an die Abnützung der Beläge angepasst werden. Diese automatischen Gestängesteller waren er-forderlich, da hier eine übliche Klotzbremse verbaut worden war.
Dabei wurden für jedes
Rad zwei
Bremssohlen vorge-sehen, die durch die
Kraft gegen die
Lauffläche ge-drückt wurden und so das Rad an der freien
Drehung behinderten. In der Folge wurde die
Lokomotive ver-zögert.
Damit bleibt uns eigentlich nur noch der zweite
Bremszylinder bei der
dritten und vierten
Achse der
Lokomotiven. Dieser wirkte auf das gleiche
Bremsgestänge, jedoch hatte er einen anderen Aufbau. Hier wurde mit einer
Feder der
Kolben ausgestossen und so die
Bremse angelegt. Wegen dieser
Wirkweise, sprach man bei diesem
Zylinder auch von der
Federspeicherbremse, denn die Kraft dieser Feder wurde im gelösten Zustand
gespeichert.
Um diese
Federspeicherbremse zu lösen, musste
Druckluft in den
Zylinder
geführt werden. Dazu war ein minimaler
Luftdruck von 4.5
bar erforderlich
und somit war dieser höher als bei der normalen
Bremsung. Dank der Kraft
der
Feder konnte damit auch die
Feststellbremse verwirklicht werden. Eine
klassische
Handbremse war daher bei diesen
Lokomotiven nicht mehr
vorhanden. Es wird nun Zeit, dass wir mit den
Bremsen rechnen.
Das war leicht
unterschiedlich und erreichte bei der
Bau-reihe Am 6/6 einen Wert von 111
Tonnen. Die elektrische Ee 6/6 II war mit 107 Tonnen nur unwesentlich
leichter. Wir rechnen daher anhand der
Diesellokomotive. Sowohl die P-Bremse, als auch die Güterzugsbremse, er-reichten ein Bremsgewicht von 105 Tonnen. Damit wurde ein Bremsverhältnis von 95% erreicht, was ohne die R-Bremse durchaus ein üblicher Wert war.
Die etwas
leichtere elektrische Variante war nur unwe-sentlich höher. Speziell bei
dieser Rechnung war, dass bei der geschleppten
Lokomotiven lediglich ein
Bremsgewicht von 68 Tonnen galt. In dem Fall sank das Verhältnis auf 61%. In diesem Zusammenhang gilt zu sagen, dass bei ge-schleppten Triebfahrzeugen oft geringere Werte vorhan-den waren. Es gab selbst Modelle, bei denen in dem Fall die Bremse gar nicht vorhanden war.
Speziell war hier die
Federspeicherbremse, denn diese wurde mit der
Hauptleitung gefüllt und zog daher an, wenn diese entleert wurde. Da in
dem Fall aber die normale
Bremse nicht wirksam sein durfte, ergab sich
eine Reduktion.
Somit müssen wir nur noch mit der
Federspeicherbremse rechnen. Dieser
wurde ein
Bremsgewicht zugestanden, das bei 17 Tonnen lag. Wenn wir nun
rechnen würden, bekämen wir ein
Bremsverhältnis von gerade einmal 15%.
Damit konnten die beiden
Baureihen nicht mehr an jeder Stelle abgestellt
werden. Damit das jedoch ging, wurden noch
Hemmschuhe mitgeführt. Auch
hier zeigte sich, dass es sich nicht um
Streckenlokomotiven handelte.
|
|||||||||||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |||||||||
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | ||||||||
|
Copyright 2025 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||||||||||
 Beim
Beim
 Um
den
Um
den

 Damit
wird es Zeit, dass wir zu den pneumatischen
Damit
wird es Zeit, dass wir zu den pneumatischen
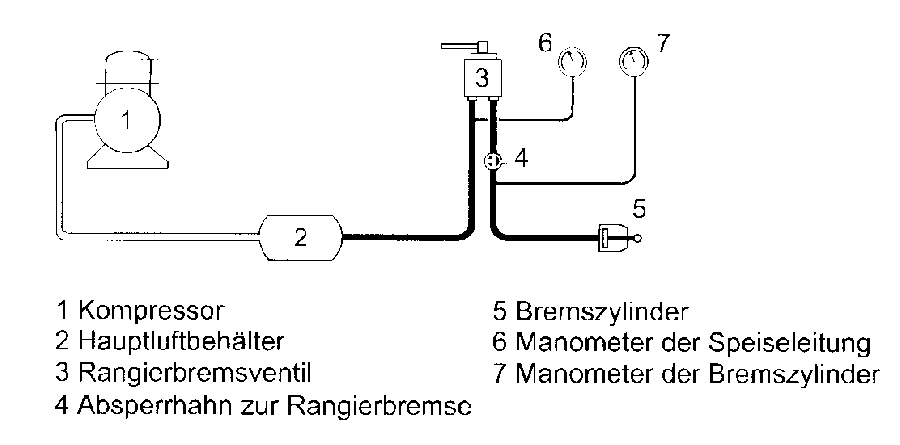 Mit der
Mit der
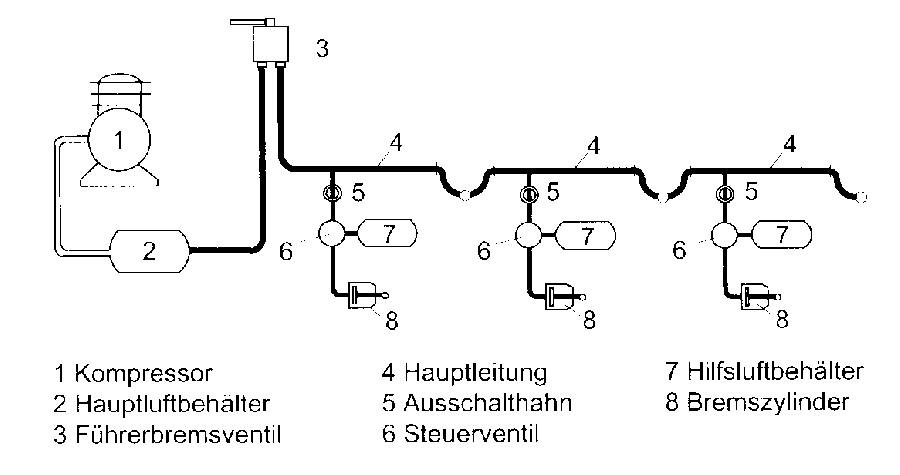 Eine
Eine
 In jedem
In jedem
 Gerechnet wird bei den
Gerechnet wird bei den