|
Thermische Ausrüstung Am 6/6 |
|||||||||||
| Navigation durch das Thema | |||||||||||
|
Wir kommen nun zu den grössten Unterschieden zwischen den
Baureihen.
Es ist die Bereitstellung der für den Betrieb erforderlichen Energie. Bei
der Baureihe Am 6/6 wurde ein
Dieselmotor
verwendet. Für die
Rangierlokomotive
Ee 6/6 II kam jedoch ein
Primärstromkreis
dazu. Sollten Sie sich für eine dieser beiden Varianten speziell
interessieren, dann können Sie in der nun folgenden Tabelle auf die andere
Variante wechseln. |
|||||||||||
|
Thermische Ausrüstung Am 6/6 |
Primärstromkreis Ee 6/6
II |
||||||||||
|
Mit dem thermischen Teil der
Baureihe
Am 6/6 kommen wir zum Herzstück jeder
Diesellokomotive.
Hier wird die Energie aus der Verbrennung des
Treibstoffes
in Form eines
Drehmoments
gewonnen. Erbaut wurde der hier verbaute Motor von der Firma Motor
Chantiers de l’ Atlantique SA in Saint-Denis. Bei der Ortschaft handelt es
sich um einen Stadtteil von Paris. Wir haben daher ein französische
Aggregat für diese Reihe erhalten.
Es kann nur so viel bereits erwähnt werden, die
Baureihe
Am 6/6 sollte den grössten bisher in einer
Lokomotive
eingebauten Motor erhalten. Bei den Schweizerischen Bundesbahnen SBB
sollte dieser Wert nicht mehr erreicht werden. Vom Aufbau her handelte es sich um einen Motor, der mit vier Takten arbeitete. Es wurden dabei 16 Zylinder verbaut. Um die Länge des Bauwerks und damit von der Kurbelwelle zu verringern, wurden die Zylinder in zwei Reihen angeordnet.
Bei dieser Variante wird von einem V-Motor ge-sprochen und auch so
sollten die Abmessungen da-für sorgen, dass das
Führerhaus
gegen den vor-deren
Vorbau
verschoben werden musste. Jeder Zylinder hatte eine Bohrung von 210 mm er-halten. Dabei war ein Kolbenhub von ebenfalls 210 mm vorhanden.
Damit konnte ein
Hubraum
von 5.65 Liter berechnet werden. Wohl verstanden, diese Daten galten für
einen
Zylinder
und davon waren 16 Stück vorhanden. Es war also ein grosser
Dieselmotor,
der für den Betrieb jedoch zwei wichtige Teile benötigte. Das war der
Treibstoff
und der für die Verbrennung wichtige
Sauerstoff.
Speziell war nur, dass der hier verbaute Motor über eine
gemeinsame
Nockenwelle
verfügte. So konnte die
Zündfolge
leicht eingestellt werden, denn bei so einem grossen Motor liefen immer
einige
Zylinder
parallel. Hier waren es vier Stück und diese mussten so angeordnet werden,
dass die
Kurbelwelle
gleichmässig belastet wurde. Sie sehen, beim Aufbau eines solchen Motors
musste genau gearbeitet werden und das ging mit einer Nockenwelle
einfacher.
Lokomotiven
der
Staatsbahnen
arbeiteten daher immer mit
Dieselöl,
der an in den
Unterhaltsanlagen
vorhandenen Tankstel-len bezogen werden konnte. Da es nicht praktikabel ist, die Lokomotive direkt an der Leitung anzuschliessen, musste ein gewisser Vorrat mitgeführt werden. Dazu war der auf der Maschine verbaute Treibstoffbehälter vor-handen.
Wie bei anderen
Baureihen
war der Platz dazu nur zwischen den beiden
Drehgestellen
vorhanden, denn es musste möglich sein, den
Treibstoffbehälter
vom Boden aus und von beiden Seiten des Fahrzeuges zu füllen. Dieser Tank konnte über normale Einfüllstutzen gefüllt werden. Eine Lokomotive tankt auch den Treibstoff und das unterschied sich in keiner Weise von der Strasse. Einziger Unterschied war, der Lokführer musste nach dem tanken nicht bezahlen. Er
musste auch nicht die richtige Seite suchen. Wann nachgefüllt werden
musste, war an Anzeigen zu erkennen. Seitlich waren dazu auf
unterschiedlichen Höhen einfache Schaugläser montiert worden.
Es wäre durchaus eine teure Rechnung geworden, denn der
Tank
fasste rund 3000 Liter
Dieselöl.
Auch wenn das viel erscheinen mag, für eine
Diesellokomotive
mit hoher
Leistung
war das eher gering. Je mehr Treibstoff mitgeführt wurde, desto weiter
konnte gefahren werden. In dem Punkt unterschieden sich Diesellokomotiven
nicht von den alten Dampflokomotiven, wo der
Brennstoff
auch nach einer Zeit verbraucht war.
In einem beschränkten Bereich, wie einem
Rangierbahn-hof
ging das jedoch. Der Grund war simpel, denn solche Anlagen beinhalten auch
einen Bereich für den Unterhalt der Fahrzeuge. Mit anderen Worten, es war
ein übliches
Depot
vorhanden, wo man tanken konnte. Eine weitere Aufbereitung des Treibstoffes war nicht mehr erforderlich. Er wurde mit einer Förderpumpe zur Einspritzanlage und somit zum Motor gefördert. Damit keine Schwebeteile in die Leitung gelangten, war ein Filter vorhanden.
Gerade durch die bei der Betankung offenen
Einfüllstutzen
konnten auch grössere Objekte, wie Blätter oder Insekten in den
Tank
gelangen. Daher war die Reinigung eine wich-tige Angelegenheit. Damit kommen wir zum zweiten Teil der für die Ver-brennung wichtigen Stoffe. Der Sauerstoff wird aus der normalen Luft bezogen.
Zwar hätte der
Dieselmotor
mit reinem
Sauerstoff
optimal betrieben werden können, aber der Transport war nicht möglich. Es
handelt sich dabei um einen nicht brennbaren Stoff, der aber als
Gas
sehr leicht flüchtig war und der als Brandbeschleuniger angesehen werden
kann. Auf einer
Lokomotive
ist das nicht sinnvoll.
Diese Aussenluft gelangte über die beim
Führerhaus
vorhandenen
Lüftungsgitter
in die
Lokomotive.
Auch hier waren
Filter
vorhanden die für eine Reinigung sorgten. In die
Zylinder
sollte wirklich nur Luft und
Treibstoff
gelangen. Wobei hier die Probleme nicht so gross gewesen wären, denn es
wurde viel Luft benötigt und daher waren die Öffnungen gross genug.
Trotzdem sorgten die
Filtermatten
dafür, dass saubere Luft in den Motor gelangte.
Im
Abgasturbolader
wurde die Luft verdichtet, so dass davor ein Unterdruck entstand und mehr
Luft in das System gelangte. Jedoch hatte diese Verdichtung und der
Turbolader
ein Problem. Komprimierte Luft wir heiss. Wird sie jedoch zu heiss, kann es bei der Zündung zu Problemen kommen. Die nun als Ladeluft bezeichnete Luft wurde daher in einem Ladeluftkühler abgekühlt.
Dadurch sank zwar der
Ladedruck
etwas. Das konnte man jedoch mit dem
Turbo einstellen und so gelangte optimal aufbereitete Luft in den
Zylinder.
In diesem wurde sie dann erneut durch Komprimierung sehr stark erhitzt und
dann kam der
Diesel
dazu. Der eingespritzte Diesel verbrannte an der heissen Luft sofort explosionsartig. Dadurch entstand eine Vergrösserung beim benötigten Raum und dieser entstand, in dem der Kolben nach unten gedrückt wurde.
Die
Kurbelwelle
und damit der Motor begann sich zu drehen. Speziell war hier, dass die
eigentliche Zündung in einer Vorkammer erfolgte. Dadurch konnte die
Zündung besser ablaufen, was eine optimale Ausnutzung erlaubte. Die minimale Drehzahl, also der Leerlauf wurde mit 620 Umdrehungen in der Mi-nute angegeben. Der Arbeitsbereich erstrecke sich von 750 bis 1500 Umdrehungen. Dabei stand eine Leistung von 1 840 kW zur Verfügung.
Das war ein recht hoher Wert für den verfügbaren Raum und das
Gewicht. Wobei hier nicht sonderlich darauf geachtet werden musste. Das
bei einem Motor sehr wichtige
Drehmoment
wurde mit 1 241 Newtonmeter angegeben. Um immer eine optimale Verbrennung bei den unterschiedlichen Drehzahlen zu erhalten, musste der Motor geregelt werden. Diese Aufgabe übernahm der auch hier vorhandene Woodwardregler.
Diese Motorregelung hatte sich bereits bei den vorhandenen
Diesellokomotiven
bewährt und kam auch hier zur Anwendung, es war also nicht in jedem Punkt
eine Neuerung vorhanden und dieser Motorregler arbeitete sehr zuverlässig.
Wollte man den
Dieselmotor
starten, musste er einfach in Bewegung gesetzt werden. Wurde bei den
älteren Maschinen dazu noch der
Generator
benutzt, kam hier ein normaler Anlasser zur Anwendung. Diese Motoren
wurden ab den
Batterien
versorgt und das war der Grund, warum die Reihe Am 6/6 deutlich mehr davon
hatte, als das bei der Reihe Ee 6/6 II der Fall war. Auch so wurden beim
Start die Batterien sehr stark belastet.
Ein Problem gab es, denn bei diesem Startvorgang musste der Motor
eine bestimmte Temperatur haben. Lag diese deutlich darunter, konnten
Dieselmotoren
nicht mehr gestartet werden. Der Grund dazu lag bei der recht hohen
Zündtemperatur von
Dieselöl.
Bei einem kalten Motor setzte daher die Verbrennung nicht sofort ein.
Daher werden solche Motoren in der Regel vor dem Start erwärmt. Man nennt
das auch vorglühen.
Hier verzichtete man auf die gängige Lösung mit vorglühen, denn
solche
Kaltstarts
waren wirklich selten. Wir werden später noch erfahren, warum das bei den
Schweizerischen Bundesbahnen SBB so war. Trotzdem musste auch diese
Möglichkeit angeboten werden und der Start war eine Belastung für das
Fahrzeug, aber insbesondere für den grossen Motor. Kaltstarts führen immer
wieder zu Schäden und daher sind sie unbeliebt.
Nach einigen Umdrehungen war der Motor warm genug, dass der
Diesel
von alleine verbrannte. Sie sehen, dass es brachiale Lösungen waren, denn
auf die Reaktion des Äthers war der Motor schlicht nicht ausgelegt worden. Diese Kaltstartvorrichtung der Baureihe Am 6/6 war jedoch eine sehr grosse Belastung für den Dieselmotor. In diesem Fall entstanden die grössten Schäden und daher sollte diese Methode verhindert werden.
Selbst bei kleineren Motoren sollte auf die Anwendung verzichtet
wer-den. So grosse Motoren sollten daher vor dem Start aufgewärmt werden
und damit das ging, kam gerade die
Kühlung
des Aggregates ins Spiel. Gekühlt wurde der Dieselmotor mit einer Flüssigkeitskühlung. Dazu wur-de Wasser benutzt. Dieses lief in Leitungen durch den Motor und nahm dort die Wärme auf.
Mit einer Pumpe gelangte das Wasser in den
Kühler,
der sich auf der Seite der
Puffer
befand. Ein
Ventilator
bezog die Luft für die
Kühlung
über die grossen
Lüftungsgitter
und stiess diese auf dem
Vorbau
wieder in die Umwelt. So wurde das Personal von der heissen Luft nicht
belästigt.
Dabei war spannend, dass bei den Schweizerischen Bundesbahnen SBB
diesem
Kühlwasser
kein
Frostschutzmittel
beigemengt wurde. Daher musste wirksam verhindert werden, dass das Wasser
gefrieren konnte. Es durfte auf keinen Fall gefrieren und daher musste ein
Gebäude aufgesucht werden. Da die
Lokomotiven
aber auch im Freien abgestellt werden mussten, kam man nicht darum herum
das Kühlwasser zu heizen und das war immer der Fall.
An diese konnte die
Lokomotive
mit einem Kabel an-geschlossen worden. Spannend dabei war, dass diese
Anlage auch in Betrieb genommen wurde, wenn die Maschine in einem Gebäude
abgestellt wurde. Der Grund lag bei den erreichten Temperaturen. Mit einer Pumpe wurde das Kühlwasser in Bewegung versetzt und dieses zusätzlich mit elektrischen Heizkörpern erwärmt. Die hier erreichten Werte bei der Temperatur waren so eingestellt worden, dass der Dieselmotor auf nor-male Weise gestartet werden konnte.
Die vorhandene Kaltstartvorrichtung war wirklich nur im absoluten
Notfall anzuwenden. In den Vorschriften war deren Anwendung klar
umschrieben worden. Bedingt durch die schnellen Bewegungen mussten die Bauteile und damit der Motor auch geschmiert werden.
Dazu wurde handelsübliches für Motoren geeignetes
Schmieröl
verwendet. Das
Schmiermittel
lagerte in einer
Ölwanne
und mit einer
Ölpumpe
wurde dieses an die entsprechenden Stellen im Motor gepresst. Danach
tropfte es wieder in die Wanne. Ein
Kühler
sorgte dafür, dass das
Öl
nicht zu heiss werden konnte.
Angetrieben wurden diese Pumpen und auch der
Ventilator
auf hydrostatische Weise und damit direkt vom
Dieselmotor.
So war gesichert, dass der Motor unabhängig von der elektrischen
Ausrüstung der
Lokomotive
gekühlt wurde. Das war besonders bei Störungen wichtig, da diese auch nach
einer Fahrt mit Volllast auftreten konnten und so ein Ausfall zu schweren
Schäden am Motor geführt hätte, so lange sich die
Kurbelwelle
bewegte, wurde gekühlt.
Da dies
Abgase
durch die Explosionen sehr stark angeregt wurden, waren sie sehr laut und
konnten wegen dem
Pflichtenheft
nicht einfach ins Freie entlassen werden. Zur Beruhigung der
Gase
war der auf dem
Vorbau
montierte
Schalldämpfer
vorhanden. Mit diesem Abgasschalldämpfer konnten die Vorgaben von 85 dB (A) eingehalten werden. Der Aufbau sorgte zudem dafür, dass die heissen Abgase etwas gekühlt wurden. Danach gelangten sie über der Lokomotive ins Freie.
Es gab jedoch keine weitere Aufbereitung mehr. Die heute übliche
Reinigung der
Abgase
waren damals noch nicht bekannt. Der
Woodwardregler
war jedoch so gut, dass selten Rauch ausgestossen wurde. Damit haben wir den Motor abgeschlossen. Damit dessen Energie jedoch für die elektrischen Fahrmotoren genutzt werden konnte, war an der Kurbelwelle einfach ein Generator vorhanden.
Dieser war räumlich vom
Dieselmotor
getrennt worden. So konnte verhindert werden, dass ein allenfalls
vorhandener Brand beim Dieselmotor nicht auch den
Generator
betraf. Eine aktive Löschanlage war hier jedoch nicht vorhanden.
Auch wenn ich vom
Generator
gesprochen habe, es war ein Hauptgenerator und auch noch Hilfsgeneratoren
vorhanden. Diese lassen wir sein, denn wichtig für uns ist der Generator,
der die
Spannung
für die
Fahrmotoren
lieferte. Dieser arbeitete mit den schon beim
Dieselmotor
erwähnten Drehzahlen und er verfügte über insgesamt acht Pole. Bei der in
ihm hergestellten Spannung handelte es sich aber nicht um
Gleichstrom,
sondern um einen
Drehstrom.
Beim abgegebenen
Strom
konnten maximal 816
Ampère
abgerufen werden. Wir haben daher eine veränderliche
Leistung
von bis zu 1 725 kVA erhalten. Dabei war speziell, dass sich auch die
Frequenz
veränderte und das war für die
Fahrmotoren
sehr wichtig. Da diese Frequenzen jedoch zu ungenau für den Betrieb der Fahrmotoren waren, musste zwingend eine Umwandlung vorgenommen werden. Daher wurde nach dem Generator ein einfacher Gleichrichter eingebaut.
So wurde aus dem
Drehstrom
eine
Gleichspannung
die bei einem Wert von 1 500
Volt
lag. Diese wurde nun dem
Zwischenkreis
zugeführt und konnte dort schliesslich von den
Fahrmotoren
genutzt werden.
Wir haben nun die Bereitstellung der elektrischen Energie bei der
Lokomotive
Am 6/6 abgeschlossen. Zusammenfassend kann erwähnt werden, dass der
Dieselmotor
autonom war und sich so unabhängig kühlte und schmierte. Das war wichtig,
weil die aus dem
Drehmoment
im
Generator
erzeugte elektrische Energie nicht immer zur Verfügung stand. Mit den bei
einem
Umrichter
wichtigen
Zwischenkreis
unterbrechen wir die Betrachtung.
Sollten Sie sich nun auch für die elektrische
Rangierlokomotive
der
Baureihe
Ee 6/6 II interessieren, dann können Sie
hier
klicken und kommen zum
Primärstromkreis.
Wenn Sie unten jedoch auf weiter klicken, dann können sie der weiteren
Umwandlung bei der Baureihe Am 6/6 folgen. Keine Angst, auch nach dem
Abstecher zur elektrischen Version werden Sie wieder an diesen Punkt
zurückkehren, denn der war gleich.
|
|||||||||||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |||||||||
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | ||||||||
|
Copyright 2025 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||||||||||
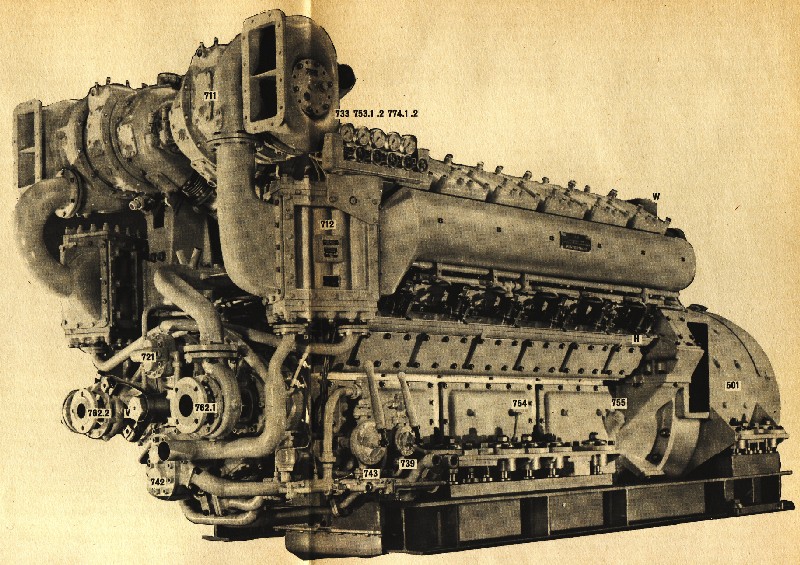 Das
auf den
Das
auf den
 Als
Als
 Gerade
der mitgeführte Vorrat beim
Gerade
der mitgeführte Vorrat beim
 Um
mehr
Um
mehr
 Um
die Zündtemperatur zu verringern, wurde neben
Um
die Zündtemperatur zu verringern, wurde neben
 Es
war eine elektrische
Es
war eine elektrische
 Uns
fehlen noch die bei der Verbrennung entstehenden
Uns
fehlen noch die bei der Verbrennung entstehenden
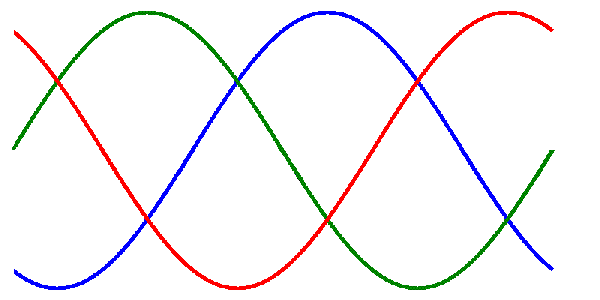 Bedingt
durch den Aufbau des
Bedingt
durch den Aufbau des