|
Traktionsstromkreis |
|||||||||||
| Navigation durch das Thema | |||||||||||
|
Diesen Bereich beginnen wir beim
Zwischenkreis.
Dieser war nötig um aus den bei der Versorgung vorhandenen
Spannungen,
jene für die
Fahrmotoren
zu erzeugen. Betrieben werden solche Zwischenkreise ausschliesslich mit
Gleichspannung.
Bei beiden hier vorgestellten
Lokomotiven
wurde die
Spannung
auf 1 500
Volt
festgelegt. Mit der damals verfügbaren Technik war das die höchste
mögliche Sperrspannung der
Stromrichter.
Am
Zwischenkreis
angeschlossen wurden die
Wechselrichter.
Dabei gab es zwischen den
Baureihen
einen Unterschied. Die
Diesellokomotive
Am 6/6 hatte zwei
Kreise,
die sich auf beide
Drehgestelle
aufteilten. Bei der
Rangierlokomotive
Ee 6/6 II waren sämtliche
Fahrmotoren
an einem Wechselrichter angeschlossen worden. Das erfolgte jedoch auf den
Erfahrungen, die man mit der leicht älteren Baureihe Am 6/6 gemacht hatte.
Der
Wechselrichter
war ein normaler
Stromrichter,
der auch hier mit
Thyristoren
aufgebaut wurde. Sie wurden als Vierquadrantensteller geschaltet und sie
konnten von der Steuerung geregelt werden. Als Ausgangsspannung war nun
Drehstrom
vorhanden, der sowohl in der
Spannung,
als auch im Bereich der
Frequenz
verändert werden konnten. Dabei waren Spannung von null bis 1 350
Volt
möglich und die Frequenz lag bei null bis 100
Hertz.
Mit dieser Schaltung arbeiteten die
Thyristoren
in einer Richtung des
Stromes
als Schalter und in der entgegengesetzten Richtung als Sperre. Beim
Wechselrichter
werden die vier benötigten Thyristoren teilweise so eingeschaltet, dass
sie leitend wurden. Erst wenn sich der Stromfluss änderte sperrten diese
wieder. In dem Fall übernahm ein andere Teil, der umgekehrt gepolt
angeschlossen wurde. Es entstand so ein
Wechselstrom.
So entstand der für die Motoren benötigte
Drehstrom.
Wenn wir nun auf-rechnen würden, dann kommen wir auf eine hohe Zahl bei
den
Thyristoren
und diese gab es bei der Reihe Ee 6/6 II auch im primären
Stromkreis. Der Platzbedarf war daher so gross, dass diese Wechselrichter alleine einen Vorbau beanspruchten. Es war also nicht das Gewicht, sondern der verfüg-bare Platz, der auch bei der Baureihe Am 6/6 verhinderte, dass eine feinere Aufteilung der Bauteile möglich wurde.
Im Vergleich zu
Streckenlokomotive
war jedoch eine geringe
Leistung
vor-handen und so wurde die Technik dort durch das Gewicht verhindert. Die
Lösung sollten die
GTO
sein.
Somit haben wir den
Wechselrichter
aufgebaut. Die Schaltelemente in Form der
Thyristoren
waren so ausgelegt worden, dass sie nicht so schnell Schaden nehmen
konnten. Der
Umformer
arbeitete so zuverlässig, dass man bei der
Baureihe
Ee 6/6 II sogar auf die Aufteilung verzichten konnte. Wurde ein Thyristor
zerstört, beschädigte das oft auch die anderen
Stromrichter,
was so oder so in der Werkstatt endete.
Wir haben damit eine geregelte
Spannung
erhalten, die in beiden Bereichen sehr genau eingestellt und verändert
werden konnte. Diese war nötig, dass an den Motoren unterschiedliche
Drehzahlen und
Zugkräfte
möglich waren. Eine weitere Aufbereitung war nicht mehr nötig und die
Fahrrichtung wurde auch nicht mehr mit einem
Wendeschalter
geändert, denn in dem Fall wurde einfach im
Stromrichter
die Ansteuerung verändert.
Bei der
Rangierlokomotive
war hingegen die ganze Ma-schine von dieser Störung betroffen. Ein
Nachteil, der aber einer besseren Ausnutzung der
Zugkraft
geopfert wurde. Da jede Achse über einen eigenen Fahrmotor verfügte, waren davon sechs Stück vorhanden. Jeder war nach dem gleichen Muster aufgebaut worden und daher können wir uns vorerst auf einen davon konzentrieren.
Eine durchaus übliche Fertigung, denn niemand macht sich die Mühe,
jeder
Achse
einen anderen
Fahrmotor
zu ver-passen. Es waren sogar die genau gleichen Modelle, wenn wir die
beiden
Baureihen
dazu nehmen würden. Es handelte sich um vierpolige Drehstrommotoren. Diese Asynchronmotoren besassen einen Kurzschlussläufer und sie waren sehr robust.
Auch bei geringen Drehzahlen konnten die vollen
Leistung-en
abgerufen werden. Gerade dieser Punkt war bei den hier vorgestellten
Baureihen
sehr wichtig, wurde doch im
Verschub
vor
Ablaufbergen
sehr langsam und mit hohen
Zugkräften
gefahren. Die
Fahrmotoren
waren für diesen Einsatz ideal geeignet.
Wenn wir uns nun den technischen Daten dieser
Asynchronmotoren
zuwenden, dann kann erwähnt werden, dass jeder Motor eine
Leistung
von 250 kW besass und so ein theoretischer Wert von 1500 kW verfügbar war.
Da die Leistung jedoch durch die
Stromrichter
beschränkt wurde, waren die Motoren nicht sonderlich stark ausgelastet
worden. Insbesondere galt das für die elektrische
Rangierlokomotive
der
Baureihe
Ee 6/6 II.
Diese entstanden jedoch erst im
Rad,
so dass wir dort nachsehen müssen. Daher wird in Fachbüchern oft er-wähnt,
dass es sich um die Werte am Rad handle. Wir rechnen nun auf und
betrachten die ganze
Lokomotive
und da gab es Differenzen.
Wichtig war die maximal mögliche
Zugkraft.
Diese
Anfahrzugkraft lag bei der
Baureihe
Am 6/6 bei 400 kN. Bei der elektrischen Variante Ee 6/6 II konnten aber
lediglich 360 kN abgerufen werden. Das mag überraschend sein, denn beide
Modelle hatten die gleichen
Fahrmotoren
und zum Zeitpunkt, wo die Anfahrzugkraft wichtig war, spielte auch die
Leistung
eine untergeordnete Rolle. Es musste einen anderen Punkt geben.
Die Ursache für diese Differenz lag beim Gewicht der
Lokomotive.
Die
Baureihe
Ee 6/6 II war etwas leichter ausgefallen, als das bei der
Diesellokomotive
der Fall war. Die Reduktion um vier Tonnen wirkte sich bei der möglichen
Anfahrzugkraft aus, denn diese war auch den physikalischen
Gesetzen unterworfen. Bei rund 107 Tonnen ergab das eine Reduktion bei der
Zugkraft
um 40 kN und das mag mit den Zahlen viel sein.
Somit haben wir hier ausgesprochen gute
Zugkräfte
und das galt für beide
Baureihen,
denn bei der
Anfahrzugkraft konnten sie locker mit der grossen
Streckenlokomotive
mithalten.
Wenn wir nun bei diesem Vergleich bleiben, dann erkennen wir, dass
die Maschine der Strecke eine deutlich höhere
Leistung
und damit auch eine
Leistungsgrenze
hatte, die sehr hoch angesetzt wurde. Bei den hier vorgestellten
Lokomotiven
wurde die Grenze für die Leistung sehr weit nach unten verschoben, denn
diese lag hier bei einer Geschwindigkeit von 21.5 km/h. Damit war der
Einsatz für die Maschinen klar definiert worden.
Bei langsamer Fahrt, wie das zum Beispiel beim Einsatz vor einem
Ablaufberg
der Fall war, konnten sehr hohe
Zugkräfte
abgerufen werden. Wichtig war das bei den schweren
Verschüben.
Wurden bereits andere Rangieraufgaben ausgeführt, sank die Zugkraft mit
zunehmender Geschwindigkeit. Auf der Strecke war ein Einsatz kaum mit
normalen Zügen möglich. Es waren schwere
Verschublokomotiven
und dabei bestehen keine Zweifel.
Da die
Baureihe
Am 6/6 mit 1 440 kW, oder 1 960 PS deutlich mehr
Leistung
als die elektrische
Rangierlokomotive
hatte, war sie sogar etwas besser aufgestellt worden. Mit den Werten von
730 kW und 1000 PS konnte die Reihe Ee 6/6 II nur im Einsatz am
Ablaufberg
die volle
Zugkraft
abrufen. Das waren aber die schweren Arbeiten, denn oft mussten die Lasten
vor dem eigentlichen Ablaufbetrieb über den Berg gezogen werden.
Diese wurde aktiviert, wenn die
Fahrmotoren
kipp-ten und statt Energie bezogen, solche erzeugten. Der so entstehende
Strom
wurde über den
Stromrichter
geleitet und so in einen einfachen
Gleichstrom
umge-wandelt. Dieser Gleichstrom im Zwischenkreis musste jedoch abgebaut werden. Da hier kaum Nutzer vorhanden waren, wurde die Bremskraft der Motoren in Brems-widerständen in Wärme umgewandelt.
Diese direkt im Bereich des
Zwischenkreises
ange-ordneten
Widerstände
konnten dank dem vorhanden-en
Gleichstrom
optimal arbeiten und das wirkte sich auf die
elektrische
Bremse der
Lokomotive
aus, denn es konnte eine
Bremskraft
von 140 kN erzeugt wer-den.
Auch wenn die
Widerstände
künstlich gekühlt wurden, bei der
Leistung
konnte keine längere Zeit mit der
Bremse
gearbeitet werden. Es war daher eine
elektrische
Bremse vorhanden, die auf den
Rangierbetrieb ausgelegt worden war und die für die Verzögerung
der
Lokomotive
genutzt wurden. Selbst hier war klar zu erkennen, dass es eine
Rangierlokomotive
war, denn lange Talfahrten waren mit dieser Bremse kaum möglich.
Sie sehen, bei
dieselelektrischen
Lokomotiven
wurden
Widerstandsbremsen
möglich, diese mussten aber so ausgelegt werden, dass sie nur kurze Zeit
arbeiten konnte. Für einen längeren Betrieb hätten mehr
Bremswiderstände
verbaut werden müssen. Vom Gewicht her, wäre das kein Problem gewesen,
aber auf der Lokomotive fehlte schlicht der Platz. Was möglich gewesen
wäre, zeigt uns aber die
Baureihe
Ee 6/6 II mit ihrer
elektrischen
Bremse.
Die Vorteile dabei waren, dass kaum
Widerstände
benötigt wurden, die Wärme erzeugten und das wurde hier wirk-lich sehr
deutlich aufgezeigt. Auch hier mussten dazu die Motoren kippen. Der nun von diesen abgegebene Strom wurde in den Stromrichtern zu einem Gleichstrom, der dem Zwischenkreis zugeführt wurde.
Da dort noch ein paar weitere Verbraucher vorhanden waren, konnten
diese sogar mit der
elektrischen
Bremse der
Lokomotive
versorgt werden. Jedoch ging der grösste Teil der
Leistung
an den Eingangsstromrichter, der nun als
Wechselrichter
geschaltet wurde. Genau hier lag der Grund, warum dieser als Vierquad-rantensteller mit Thyristoren aufgebaut wurde, denn nun konnte aus dem Gleichstrom ein Wechselstrom erzeugt werden. Dieser wurde
mit dem
Transformator
an die
Spannung
der
Fahrleitung
angepasst. So wurde die Bremsenergie an diese übertragen und konnte so von
einem anderen Fahrzeug genutzt werden. Was uns hier noch fehlt, sind die
Daten dieser
Bremse.
Bei der Reihe Ee 6/6 II konnte mit der elektrischen
Nutzstrombremse
eine
Bremskraft
von 200 kN erzeugt werden. Das lag über der
Diesellokomotive
und nun kam der besondere Effekt. Diese Bremskraft konnte nahezu im
gesamten Bereich der erlaubten Geschwindigkeit genutzt werden. Die
Reduktion ergab sich nur auf Grund der
Leistung
der
Stromrichter
und des
Transformatorss.
Es war damals schlicht die höchste mögliche Bremskraft.
|
|||||||||||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |||||||||
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | ||||||||
|
Copyright 2025 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||||||||||
 Die
Sperrspannung ist der Wert, der bei den
Die
Sperrspannung ist der Wert, der bei den
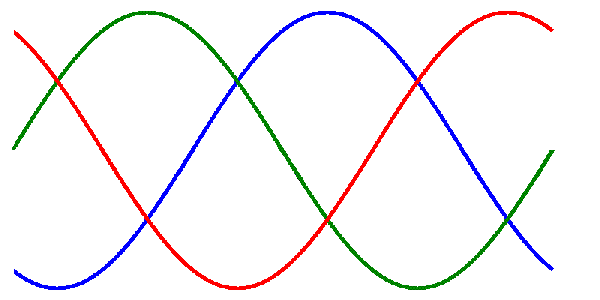 Sie
haben richtig gelesen, ein
Sie
haben richtig gelesen, ein
 Die
Die
 Bei
den sechs
Bei
den sechs
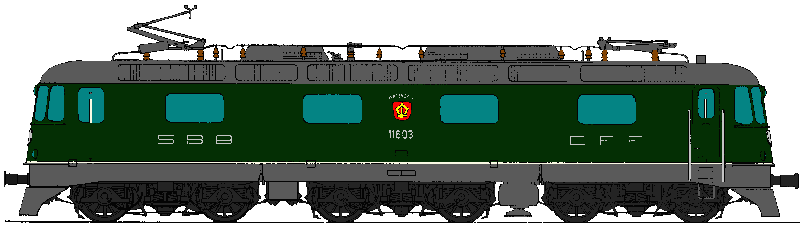 Wenn
wir eine
Wenn
wir eine
 Speziell
war, dass beide
Speziell
war, dass beide
 Die
elektrisch betriebene
Die
elektrisch betriebene