|
Neben- und Hilfsbetriebe |
|||||||||||
| Navigation durch das Thema | |||||||||||
|
Wir kommen nun zu den Neben- und
Hilfsbetrieben. Wie bei den anderen
Baureihen beginne ich mit den
Nebenbetrieben. Diese waren hier schlicht
nicht vorhanden und das führt automatisch zu Fragen. So klar war diese
Lösung wegen der Baureihe Ee 6/6 II auch wieder nicht. Daher müssen wir
uns wirklich mit den nicht vorhandenen Nebenbetrieben befassen und diese
bestanden damals in der Schweiz ausschliesslich aus der
Zugsheizung.
Bei den verbliebenen Strecken war der
Personenverkehr eingestellt worden.
Daher mussten auch keine
Personenwagen mehr geheizt werden. Das betraf nun
wirklich alle Stecken und daher machte der Einbau bei der
Baureihe Am 6/6
schlicht keinen Sinn. Jedoch haben wir hier noch die
Rangierlokomotive Ee
6/6 II und da sah die Angelegenheit deutlich anders aus, denn bisher
hatten diese Modelle immer eine
Zugs-heizung bekommen.
Technisch wäre der Einbau kein Problem gewesen. Für die
Zugsheizung mit
1000
Volt wäre im
Transformator nur eine
Anzapfung in der
Primärwicklung
erforderlich gewesen. Auch der Platz für einen
Heizhüpfer wäre noch
vorhanden gewesen. Damit blieben lediglich die Leitungen zu den
Stoss-balken und die wären leicht zu ziehen gewesen. Sie sehen, der Einbau
benötigte kaum Platz und das Gewicht spielte nun wirklich keine Rolle
mehr.
Die
Baureihe Ee 6/6 II war als schwere
Verschublokomotive konzipiert
worden. Diese wurden an
Ablaufbergen eingesetzt und dort fanden sich keine
Reisezugwagen und schon gar nicht mussten sie geheizt werden. Für die
entsprechenden Aufgaben gab es in den
Bahnhöfen oft auch ein Modell der
Reihe Ee 3/3 und so konnte man diese nehmen. Selbst stationäre Anlagen
waren vorhanden. So war der Verzicht wirklich kein Problem.
Die Anzeige der
Spannung in der
Fahrleitung war nur bei der Reihe Ee 6/6 II vorhanden und
diese wurde hier nicht mehr über die
Hilfsbetriebe bereit gestellt. Wir
haben den
Spannungswandler dazu bereits beim
Primärstromkreis kennen
gelernt. Auch wenn durch den Aufbau bei beiden Baureihen die gleiche Lösung für die Versorgung der Hilfsbe-triebe möglich gewesen wäre, gab es Unterschiede und daher müssen wir uns mit diesem Teil etwas genauer befassen.
Als die
Baureihe Am 6/6 entwickelt wurde, war noch nicht klar, dass es auch eine
elektrische Version geben wird. Daher verbaute man hier eine von den
anderen
Diesellokomotiven her bekannte Lösung. Bereits bei der Kühlung und Schmierung des Dieselmotors haben wir erfahren, dass auf der Loko-motive Am 6/6 ein hydrostatisches System verbaut worden war.
Dieses wurde auch für die Versorgung der
Hilfsbetriebe
benutzt. Eine einfache Lösung, denn man konnte so eine bereits vorhandene
Lösung nutzen. Jedoch sollten einige Teile elektrisch betrieben werden und
das ist auch der Grund, warum wir diesen Bereich hier ansehen.
Mit der Strömung und der Kraft des hydrostatischen Systems wurde ein
Generator angetrieben. Dieser Hilfsbetriebegenerator war so ausgelegt
worden, dass die elektrische Energie in Form von
Drehstrom zur Verfügung
stand und so von den dafür geeigneten Motoren genutzt. Damit haben wir die
wichtigen
Hilfsbetriebe und deren Versorgung bei der
Baureihe Am 6/6
erhalten. Noch können wir aber das System nicht abschliessen.
Auch jetzt nutzte man einfach das, was man schon
kannte und nun wird es Zeit, wenn wir auch die Versorgung der
Hilfsbetriebe bei der
Baureihe Ee 6/6 II ansehen. Spannend wird dies, weil
dort das hydrostatische System schlicht fehlte und so andere Lösungen her
mussten. Für die Versorgung der Hilfsbetriebe müssen wir wieder zum Zwischenkreis gehen. Ab diesem konnte die Energie nicht nur für die Fahrmotoren entnommen werden. Ein weiterer Stromrichter wurde für die Hilfsbetriebe vorge-sehen.
Auch hier kamen die schon erwähnten
Thyristoren mit dem
Vierquadrantensteller zur Anwendung. Weil
Dreh-strom erzeugt werden sollte,
mussten auch jetzt wieder drei
Stromrichter verwendet werden. Daher sprach man hier auch von einem Hilfsbetriebe-stromrichter und an diesem waren, wie das bei den elektrischen Lokomotiven schon immer üblich war, die vielen Verbraucher angeschlossen worden.
Da wir bei der
Baureihe
Am 6/6 den
Kompressor und dessen
Antrieb schon kennen, sehen wir uns
diesen bei der
Rangierlokomotive Ee 6/6 II auch zuerst an, denn danach ist
der Aufbau bei beiden Modellen identisch ausgeführt worden.
Bevor wir uns den
Kompressor genau ansehen können, müssen wir noch
ansehen, mit welcher
Spannung denn gearbeitet wurde. Für die elektrischen
Hilfsbetriebe wurde mit einem Wert von 380
Volt und mit einer
Frequenz von
50
Hertz gearbeitet. Diese Werte entsprachen dem damals vorhandenen
Ortsnetz für
Drehstrom und so konnten ab diesem auch die Hilfsbetriebe mit
einem Kabel und einer Steckdose versorgt werden.
Dank dem
Schütz konnte
die Schaltung auch erfolgen, wenn keine
Druckluft vorhanden war. Diese
wurde je-doch bei geschlossenem Schalter in dem Moment er-zeugt, wenn der
Zwischenkreis mit
Spannung versorgt wurde. Damit haben wir die Drucklufterzeugung auch bei der Baureihe Ee 6/6 II kennen gelernt und können uns nun den anderen Hilfsbetrieben zuwenden. Diese umfassten die Kühlung der elektrischen Bauteile und die Ladung der Batterien.
Beginnen wir mit den zu kühlenden Bauteilen. Das musste bei den
Stromrichtern, den
Fahrmotoren und bei der elektrischen
Rangierlokomotive
auch beim
Transformator vorgenommen werden.
Da der
Transformator auf die gleiche Weise gekühlt wurde, wie das auch bei
den
Stromrichtern der Fall war, können wir diesen ausblenden. Wichtig war
hier, dass die
Kühlung auch die
Isolation verbesserte und dazu war das
Transformatoröl ideal geeignet. Es war ein spezielles
Öl, das die
Isolation verbesserte und die Wärme gut aufnehmen konnte. Auch wenn der
Name etwas verwirrend erscheint, das Öl kam auch bei den Stromrichtern zur
Anwendung.
Eingebaut wurden die Bauteile in einem Gehäuse und dieses wurde mit dem
Öl
gefüllt. Wurden die Teile von
Strom durchflossen nahm das
Kühlöl die
entstehende Wärme auf und durch die veränderte Dichte, wurde es verdrängt
und kühlere Flüssigkeit floss nach. Dieser natürliche Effekt reichte
jedoch nicht aus um die
Kühlung sicher zu stellen, denn dank einer
optimierten Kühlung konnten die Teile auch verkleinert werden.
Das so erhitzte
Öl musste wiederum
gekühlt werden und so wur-de es durch einen
Ölkühler geleitet. Dieser
vermochte die Wärme im Stillstand abzuführen. Flossen jedoch höhere
Ströme
musste die
Kühlung des Öls verbessert werden. Daher wurde die Luft durch den Ölkühler mit einem Ventilator beschleunigt. Dessen Leistung konnte so reguliert werden, dass die Kühlung angepasst werden konnte.
Von den anderen
Baureihen her wissen wir, dass in solchen
Fällen viel Lärm entsteht und die Schaltung in Abhängigkeit der
Geschwindigkeit ging hier nicht, da die grösste Wärme entstand, wenn sehr
langsam gefahren wurde. Daher lief der
Ventilator nach Bedarf. Speziell war, dass die Stromrichter immer autonom gekühlt wur-den. Während sich das wegen der Verteilung auf zwei Vorbauten bei der Reihe Ee 6/6 II anbot, galt das bei der Reihe Am 6/6 auch für die beiden Traktionsstromrichter.
Doch das war nur der Fall, weil die Baugruppen
komplett mit der
Kühlung aufgebaut und dann in der Maschine eingesetzt
wurden. Der
Transformator wurde jedoch zusammen mit dem
Eingangsstromrichter gekühlt.
Damit wird es nun Zeit, dass wir auch die
Fahrmotoren kühlen. Diese waren
in den
Drehgestellen eingebaut worden und sie wurden mit Luft gekühlt.
Dabei wurde die vom
Ventilator im
Vorbau angezogene Luft durch Kanäle
gepresst, wo sie die Motoren durchströmen konnte. Dabei wurde die Wärme
aufgenommen und unter der
Lokomotive wieder ins Freie entlassen. Dadurch
wurden die Fahrmotoren mit der
Ventilation sauber gehalten.
Uns fehlt eigentlich nur
noch ein Bauteil und das gab es nur bei der
Diesellokomotive Am 6/6. Es
war der
Bremswiderstand, der ebenfalls gekühlt werden musste. Weil er am
Zwischenkreis hing, musste eine
Kühlung verbaut werden. Ein Ventilator kühlte die Bremswiderstände und dabei war spannend, dass dieser unabhängig von der Aktivierung der elektrischen Bremse lief. So konnten die Widerstände nach dem Einsatz gekühlt werden.
Sie standen dann
bei der nächsten
Bremsung wieder zur Verfügung. Man ging daher davon aus,
das sehr oft mit dieser
Bremse gearbeitet werden sollte. Dass das nicht
immer so war, werden wir später noch er-fahren.
Wie bei anderen
Baureihen waren auch hier kleinere Verbraucher vorhanden.
Dazu gehörte die
Heizung des
Führerstandes und das war bei beiden
Baureihen so. Auch die
Fensterheizung war nicht mehr über die
Batterie
versorgt worden und sie war als eine aufgedampfte Folie ausgeführt worden.
So konnten die Scheiben deutlich besser erwärmt werden. Sie sehen, dass
man hier sehr viele Punkte gegenüber den alten Baureihen veränderte.
Die grösste Veränderung betraf die überall auf den Fahrzeugen verbauten
Steckdosen für 220
Volt. Diese wurden für Lampen benötigt und hier konnten
auch andere Verbraucher angeschlossen werden. Der Grund dafür war, dass
hier mit 50
Hertz gearbeitet wurde. Bisher war dazu immer die tiefere
Frequenz der
Spannung in der
Fahrleitung benutzt worden. Eine
Verbesserung, die wegen der neuen Versorgung möglich war.
An den
Hilfsbetrieben wurde ein
Batterieladegerät angeschlossen, das die
Batterien mit 36
Volt laden
konnte. Gleichzeitig reichte die Leistung jedoch dazu aus, dass die
Steuerung darüber lief. So einfach konnte man sich die Sache bei der Baureihe Am 6/6 nicht machen. Wie wir schon er-fahren haben, wurden die verbauten Batterien be-nötigt um den Dieselmotor zu starten.
Das war ein Vorgang, der die
Bleibatterien
sehr stark belastete und daher mussten diese so schnell es ging wieder
geladen werden, denn bei einer Störung am Motor schaltete der aus und der
Start musste erneut ausgeführt werden.
Daher wurde bei der
Baureihe Am 6/6 eine andere Lösung für die
Batterieladung gewählt. Diese sollte sofort einsetzen, wenn der
Dieselmotor lief. Wegen dem Aufbau war das mit den
Stromrichtern nicht
gesichert. Daher musste eine andere Lösung her und die arbeitete sogar auf
mechanische Weise und müsste daher an anderen Stelle eingebaut werden.
Damit alles an der gleichen Stelle zu finden ist, habe ich diesen Weg
gewählt.
Direkt ab dem
Dieselmotor über einen von der
Kurbelwelle abgenommenen
Antrieb wurde ein
Generator benutzt. Dieser erzeugte die für die
Batterien
erforderliche
Spannung von 120
Volt. Dabei war gesichert, dass die Ladung
einsetzte, wenn sich die Kurbelwelle zu drehen begann. Eine bei
Diesellokomotiven durchaus übliche Lösung, denn der Start des
Dieselmotors
war wirklich für die Batterien nicht leicht zu verkraften.
|
|||||||||||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |||||||||
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | ||||||||
|
Copyright 2025 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||||||||||
 Beginnen wir mit der etwas älteren
Beginnen wir mit der etwas älteren
 Damit können wir bereits zu den
Damit können wir bereits zu den
 So wurde auch der
So wurde auch der
 Es wurde ein normaler
Es wurde ein normaler
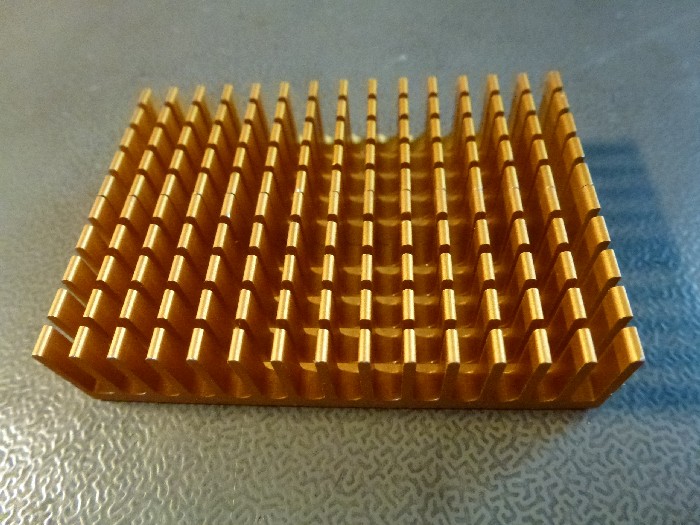 Das
Das
 Auch hier erfolgte die
Auch hier erfolgte die
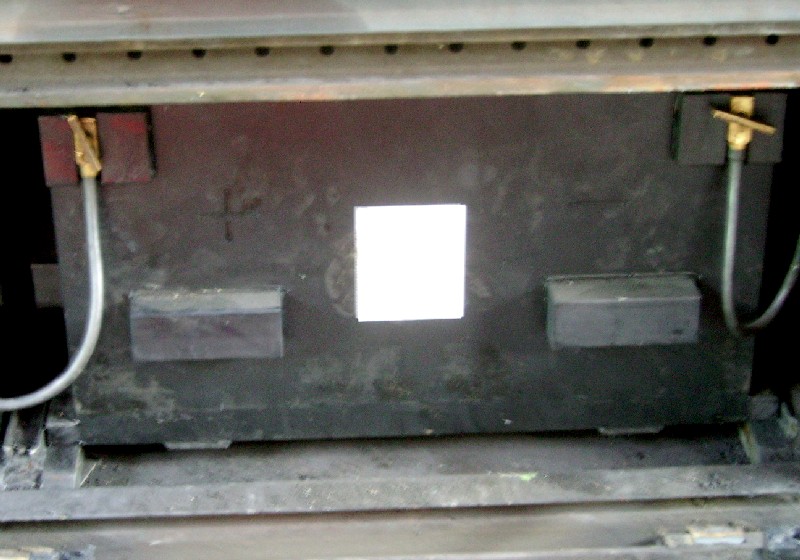 Was uns noch fehlt ist die Ladung der
Was uns noch fehlt ist die Ladung der