|
Beleuchtung und Steuerung |
|||||||||||
| Navigation durch das Thema | |||||||||||
|
Wie bei jedem
Triebfahrzeug
gab es hier ein
Steuerstromnetz. Genannt wurde es als
Bordnetz
niederer
Spannung.
Dieses Netz wurde für alle Funktionen benutzt, die auch zur Verfügung
stehen mussten, wenn die Versorgung ausgefallen war. Dazu gehörten die
Lichter, denn mit einer
Beleuchtung
kann besser gearbeitet werden. Aber auch die Steuerung war ein wichtiger
Teil, denn ohne diese konnte keine
Lokomotive
in Betrieb genommen werden.
Deren Vorteil war, dass sie leicht geladen werden konnten und sie
in der Lage waren auch hohe
Ströme
abzugeben. Das passte Perfekt, jedoch gab es auch Nachteile, die nicht
ver-nachlässigt werden durften, denn es konnte gefährlich werden. Bleibatterien benötigen Wartung, daher müssen sie zugänglich sein. Das ist auch wichtig, weil sie nach einigen Jahren ersetzt werden müssen. Das grösste Problem war jedoch, dass bei der Ladung Wasserstoff abgesondert wurde.
Das
Gas
war hoch explosiv und musste daher abgeführt werden. Aus diesem Grund
wurden diese Bauteile aussen an den Fahrzeugen in belüfteten Behältern
eingebaut. So konnten sie ohne Gefahr betrieben werden. In einer Zelle, die aus Bleiplatten und einer verdünnten Säure bestand, konnte eine Spannung von zwei Volt abgerufen werden. Das war möglich, weil die Platten aus Blei und Bleioxyd nicht die gleiche Eigenspannung haben.
Die Zellen luden sich in dem Moment, wo eine
Spannung
an den Klemmen vorhanden war, die über jener der
Batterie
lag. Das war wichtig, aber mit einer Zelle konnte nicht gear-beitet
werden, denn die Spannung war zu gering.
Aus diesem Grund wurden
Bleibatterien
von den entsprechenden Firmen in Behältern geliefert. In diesen waren
mehrere Zellen vorhanden und über die Grösse der Platten wurde die
Kapazität
bestimmt. Bei den Bahnen in Europa waren Behälter mit neun Zellen und
einer
Spannung
von 18
Volt
üblich. Zwei davon ergaben das übliche
Bordnetz
von 36 Volt. Bei der
Baureihe
Ee 6/6 II wurden diese so geschaltet auch verwendet.
Das war nicht neu, denn schon bei den
Baureihen
Em 3/3,
Bm 4/4 und
Bm 6/6 musste man mit anderen
Werten bei der Steuerung arbeiten. Hier war das jedoch gar nicht so
einfach zu verstehen.
Die bei der Reihe Am 6/6 verwendeten Behälter hatten drei Zellen
und waren daher für sechs
Volt
ausgelegt worden. Diese wurden ebenfalls in Reihe geschaltet und dabei gab
es zwei
Gruppen.
In einer davon waren sechs solcher Behälter vorhanden in der anderen Zone
waren es dann 14 Stück. Die
Spannungen
der beiden Gruppen lagen bei 36 und 120
Volt
und das wirft nun Fragen auf, denn zwei Spannungen waren sehr selten.
Die
Batterie,
die über eine
Kapazität
von 240 Ah verfügte, bot eine
Spannung
von 120
Volt
für die Anlasser und die
Beleuchtung
an. Mit der geringen Spannung von nur 36 Volt wurde die Steuerung
betrieben. Damit haben wir hier eigentlich zwei
Kreise
bekommen, die gerade im Bereich der Beleuchtung viele Fragen aufwerfen,
denn bei einer
Baureihe
arbeitete man mit 120 Volt und bei der andern mit lediglich 36 Volt. Dies
obwohl die Spannung überall vorhanden war.
Wenn wir den Grund für diese Differenz suchen, dann sind das die
älteren
Baureihen.
Für diese waren auch Lampen für 120
Volt
vorhanden. Mit der neuen Maschine sollten diese beibehalten werden. Mit
anderen Worten, bei sämtlichen
Diesellokomotiven
wurden die gleichen
Glühbirnen
verwendet und das war in den
Depots
und für das Personal sehr praktisch. Wirklich neu war daher der Abgriff
für die Steuerung, denn den gab es noch nie.
Zwei davon wurden am unteren Rand über den
Puffern
montiert. Die dritte Lampe dann noch mittig am oberen Rand des Bleches. Es
entstand so ein dreieckiges Bild, bei dem jede Lampe einzeln geschaltet
wurde. In der Schweiz gab es für Rangierlokomotiven spezielle Signalbilder. Gerade diese Ausstattung zeigte, dass es kaum auf der Strecke verkehrende Maschinen waren. Trotzdem konnten die Bilder der Strecke gezeigt werden.
Dabei wurde für das Signal des Zugsschlusses einfach eine rote
Farbscheibe in die Führungen vor der Lampe gesteckt. So entstand das rote
Licht. Für das Warnsignal
musste bei allen Lampen so verfahren werden.
Spannend waren nun die Bilder des
Rangierdienstes.
In dem Fall wurden die beiden unteren Lampen beleuchtet und mit einem
milchigen Glas abgedeckt. So sollte der Blendeffekt vermindert werden. Das
bisher vorhandene blaue Licht konnte zwar erstellt werden, es musste
jedoch bereits nicht mehr auf allen Anlagen gezeigt werden. Da die Seite
des Lokführer klar war, denn diese wurde mit der Ausrichtung bestimmt.
Jede
Rangierlokomotive
der Schweiz signalisiert die Ausrichtung. Dazu wird auf der vorderen Seite
in der oberen Lampe ein weisses V auf schwarzem Grund gezeigt. Dieses
zeigte an, dass es sich da um die vordere Seite handelte und diese war
meistens mit der Ausrichtung der
Lokomotive
identisch. Das V musste aber bei Streckenfahrten entfernt werden. Weitere
Lampen aussen gab es nicht und wir können uns den inneren Werten zuwenden.
Die
Anzeigen und
Instrumente
mussten vom Personal während der Nacht erkannt werden. Hier wurden sie
zusammen mit den Lampen aussen eingeschaltet, denn am Tag sollten die
Lampen bekanntlich dunkel sein. Wobei das die Instrumente oft
verhinderten. Mit dem Licht können wir uns auch der Steuerung zuwenden. Bei beiden Baureihen wurde diese mit einer Spannung von 36 Volt Gleichstrom betrieben. Zu sehr in die Details der Steuerung können wir nicht gehen, denn diese arbeitete nach einem neuen Prinzip. Daher
sehen wir uns die Angelegenheit genauer an. Gesteuert wurden die
Stromrichter
und bei der Am 6/6 der
Dieselmotor.
Dabei waren diese in abhängig von ein-ander.
Für den
Dieselmotor
wurden
Relais
als Schaltelemente verbaut. Diese übernahmen die Aufgaben. Wurde vom
Lokomotivpersonal
der Start des Motors verlangt, reagierte die Steuerung. Dabei wurde zuerst
die Vorschmierung aktiviert. Mit dieser Vorrichtung sollten die Bauteile
vor dem Start ausreichend geschmiert werden. Wie lange diese Vorschmierung
aktiv war, hing von der Steuerung ab, denn wenn diese abgeschlossen war,
startete der Motor.
Die korrekten Drehzahlen in Abhängigkeit des Bedarfs an
Leistung,
wurden mit Hilfe des
Woodwardreglers
eingestellt. Nach dem Start verbrachte dieser den Motor in den
Leerlauf
und wegen der geringen Drehzahl wurde vom
Generator
noch keine
Spannung
abgegeben. Wurde vom Personal ein Fahrauftrag erteilt, erhöhte der
Woodwardregler die Drehzahl entsprechend und der Generator gab Energie in
Form eines
Drehstromes
ab.
Eine Regelung gab es schlicht nicht und die
Zugkraft
wurde bei beiden
Baureihen
mit dem
Traktionsstrom-richter
eingestellt. So lange keine Zugkraft verlangt wurde, sperrten die
Thyristoren
und es gelangte keine
Spannung
zu den Motoren.
Auch bei entsprechend geschultem Personal, war es diesem nicht
möglich die in einem
Stromrichter
erforderlichen Schaltungen vorzunehmen. Es waren zu viele, die zudem in
schneller Folge anfielen. Daher forderte das
Lokomotivpersonal
bei der Steuerung nur noch eine bestimmte
Zugkraft
an. Die dazu erforderlichen Schaltungen wurden von der Steuerung des
Stromrichters vorgenommen und so die entsprechende Zugkraft eingestellt.
Gesteuert wurden die
Stromrichter
über CMOS-Prozessoren. Es handelte sich dabei um eine
speicherprogrammierbare Steuerung. Die für die Stromrichter wichtigen
Schaltungen waren in diesen programmiert worden. In diese Steuerungen
hinein zu sehen ist nicht nötig. Es reicht, wenn wir wissen, dass hier
geregelt wurde, welcher
Thyristor
zu welcher Zeit und wie lange eingestellt werden muss. Dabei konnten sich
diese Werte laufend ändern.
Mit den CMOS-Prozessoren konnten die Schritte eingehalten werden.
Sie bildeten zudem eine Vorstufe zu den Lösungen mit Rechnern. Einfach
gesagt, im Rechner selber arbeiten solche Prozessoren und das Ergebnis
wird der Steuerung vermittelt. Der grosse Vorteil dabei ist, dass einem
Rechner die geänderten Protokolle leichter vermittelt werden konnten. Hier
musste wirklich jeder Prozessor einzeln neu bespielt werden, was Zeit
brauchte.
Mit diesen konnte das Personal dann die Störung ein-grenzen. Die
Möglichkeit eine umfassende Reparatur auf dem Fahrzeug vorzunehmen waren
nicht mehr gegeben, den je nach Problem waren auch neue Programmierungen
erforderlich. Eine wirklich neue Aufgabe war für die Steuerung, dass sie die Anforderungen vom Lokomotivpersonal auch aus-führen konnte, wenn diese über ein Funksignal von aussen übermittelt wurden.
Diese Übermittlung nennt sich
Funk und
wir haben nun auch eine
Fernsteuerung
bekommen. Damit waren die
Lo-komotiven
der beiden
Baureihen
mit der
Funkfernsteuer-ung
ausgerüstet worden. Da die Maschinen das Signal nicht senden konnten, gab
es keine
Vielfachsteuerung.
Auch wenn wir eine
Funkfernsteuerung
haben, diese konnte nicht alle Bereiche ansteuern. Die Signale kamen in
dieser speziellen Betriebsform vom Rechner für den
Ablaufberg.
Damit konnte von diesem die
Lokomotive
so genau geregelt werden, dass sie während dem
Verschub
kaum angehalten werden musste. Aktiv war das System mit dem automatischen
Ablaufbetrieb nur im
Rangierbahnhof
Limmattal. Ausser im erwähnten
Bahnhof
war die Anlage inaktiv.
Im Betrieb mit der
Funkfernsteuerung
konnte die Geschwindigkeit der
Lokomotive
nur im Wert von null bis 6.35 km/h eingestellt werden. Dazu konnte die
Zugkraft
aufgebaut werden und die Lokomotive wurde bei Bedarf mit der
direkten Bremse
verzögert. Der dabei sich auf der Lokomotive befindliche Lokführer wird
somit nur noch zum Fahrgast. Da man auf ihn jedoch weiterhin nicht
verzichten konnte, wurde das Prinzip nicht weiter verfolgt.
Es konnten so auch wieder die normalen Werte bei der
Geschwindigkeit erreicht werden. Wie die Maschine gesteuert wurde, hing
von der eingestellten Betriebsart ab. Damit musste der Lokführer die
Funkfernsteuerung
aktivieren und er konnte sie auch jederzeit ausschalten. Da die Maschinen auch vom Ablaufberg geregelt werden konnten, mussten sie mit einem Schutz versehen werden. Die Fernsteuerung erkannte nicht, wenn Lokomotive ins rutschen geraten war. Es
war auch nicht möglich, die
Sander
zu aktivieren. Da-her war hier ein Schleuder- und
Gleitschutz
verbaut wor-den. Aktiv war dieser Schutz immer und daher auch, wenn der
Lokführer mit der Bedienung der
Lokomotive
betraut wurde. Gerade beim Gleitschutz gab es Unterschiede. So arbei-tete die Baureihe Ee 6/6 II und auch einige Am 6/6 mit Messwerten, die von Achsgebern übermittelt wurden.
Diese waren auch bei anderen
Baureihen
im Einsatz und dort gab es immer wieder Probleme mit diesen Gebern. Daher
wurde bei einigen Modellen der Baureihe Am 6/6 mit Detektoren gearbeitet.
Wie gut diese waren, zeigte gerade die Baureihe Ee 6/6 II mit den Gebern.
Da die
Lokomotiven
auch auf die Strecke übergehen sollten, musste auch das darauf eingesetzte
Personal überwacht werden. Dazu war eine
Sicherheitssteuerung
der
Bauart
ASEGA eingebaut worden. Diese war hingegen auf den Rangierbetrieb
ausgelegt worden, denn während diesem Einsatz musste das Personal auf den
Fahrzeug beweglich sein. Da wäre ein
Pedal
am Boden eher hinderlich gewesen und so kam es zur Änderung.
Um diesen zu aktivieren, musste ein Knopf gedrückt werden und das
er-folgte nur bei der Prüfung. In der Regel war der
Langsamgang
aktiv und daher mussten die Distanzen geändert werden. Nach einer Distanz
von 720 Metern wurde der Langsamgang aktiviert und musste bestätigt
werden. Diese Bestätigung erfolgte in der Regel mit dem Fahrschalter, es konnte aber auch die automatische Bremse genutzt werden. Wenn die Distanz ohne eine definierte Handlung verstrichen war, wurde der Schnellgang aktiviert.
Nach weiteren 80 Metern kam es zur
Zwangsbremsung.
Der
Dieselmotor
wechselte in den
Leerlauf
und bei der Ee 6/6 II wurde der
Hauptschalter
geöffnet. Somit wurde die Zufuhr der Energie unterbrochen. Während dem Rangierdienst wurde die Einrichtung nicht bemerkt. Sie wurde auch nur auf der Strecke benötigt. Jedoch ergab sich ein Problem mit der schon erwähnten Funkfernsteuerung. In
dem Fall war ja kein Bediener vor Ort. Daher war die
Sicherheits-steuerung
in dieser Betriebsart nicht aktiviert. So ergaben sich keine Pro-bleme mit
dem Rechner. Mit der Wahl in die normale Betriebsart aktivierte sich die
Einrichtung. Immer aktiv war hingegen die Zugsicherung. Das galt auch, wenn im Ablaufbetrieb mit der Funkfernsteuerung gearbeitet wurde. Das ist speziell, denn man würde das nicht erwarten. Wir
haben hier bekanntlich keine echte
Fernsteuerung
und man konnte mit entsprechenden Vorrichtung im Boden auch den
Einsatzbereich der
Funk-fernsteuerung
beschränken. Kam es zur Störung, verhinderte diese eine Fahrt ins
Verderben.
Wir müssen nun genau ansehen, wie diese Lösung funktionierte, denn
ohne Probleme ging es nicht. Bei der Funktion der
Zugsicherung
gab es keinen Unterschied. So wurde der normale Impuls für die
Warnung
empfangen. Jedoch war mittlerweile auch die
Haltauswertung
zum Standard geworden und diese war hier auch vorhanden und so konnten die
entsprechenden
Hauptsignale
in der Haltstellung nicht mehr befahren werden.
Das war im Rangierbetrieb hinderlich, damit man ungehindert
rangieren konnte. Wurde die Einrichtung mit der
Manövertaste
überbrückt. Jetzt konnten auch die
Hauptsignale
befahren werden. Der von den Streckengeräten übermittelte Impuls wurde
angezeigt, jedoch musste dieser nicht bestätigt werden, noch kam es zur
normalen
Zwangsbremsung.
Die Taste war im Rangierbetrieb immer aktiv und sie wurde für die Strecke
gelöst.
Während der
Funkfernsteuerung
konnte die Taste durchaus deaktiviert werden. Damit war es möglich, den
Einsatzbereich mit der normalen
Haltauswertung
zu beschränken. Die
Zwangsbremsung
hätte auf jeden Fall die Steuersignale der
Fernsteuerung
überbrückt und so die
Lokomotive
zum Stillstand gebracht. Eine einfache Lösung, die aber auch ein Problem
hatte und das fand sich nicht auf der Lokomotive.
Die
Hauptsignale
vor dem
Ablaufberg
waren notwendig, damit die Züge einfahren können. Damit die
Verschublokomotive
diese befahren konnte, durften diese nicht mit den Einrichtungen der
Zugsicherung
versehen werden, denn diese hätten sonst die Verschublokomotive behindert.
Da davon jedoch nur ein
Bahnhof
betroffen war, war das Problem nicht so gross. Wir erinnern uns, die
Funkfernsteuerung
kam nur im RBL zur Anwendung.
|
|||||||||||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |||||||||
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | ||||||||
|
Copyright 2025 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||||||||||
 Für
diese Bereich musste eine Quelle her, die elektrische Energie speichern
konnte. Das ging nur mit
Für
diese Bereich musste eine Quelle her, die elektrische Energie speichern
konnte. Das ging nur mit
 Anders
sah die Sache bei der
Anders
sah die Sache bei der
 Licht
gab es auf den
Licht
gab es auf den
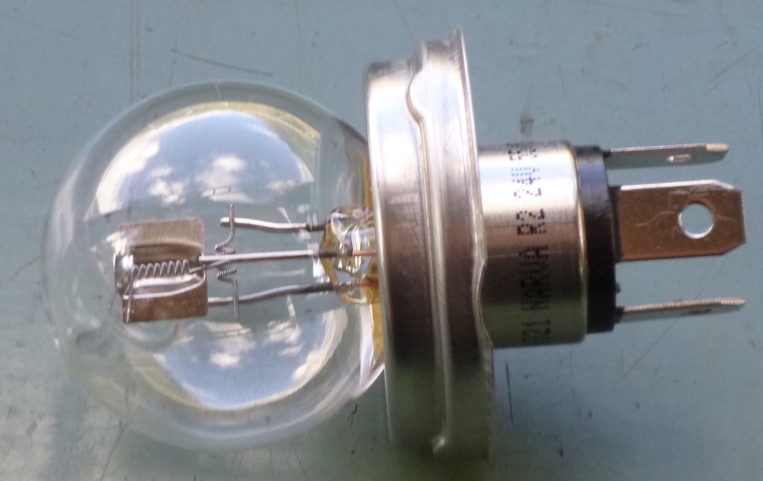 Innen
wurden Lampen in den
Innen
wurden Lampen in den
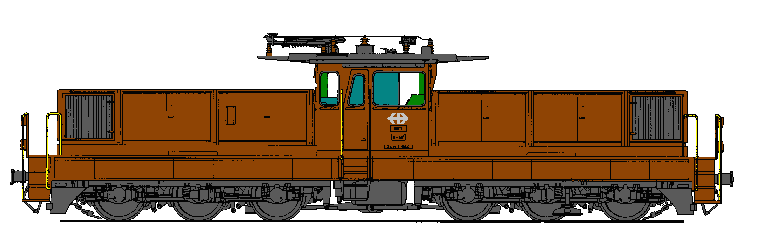 Bei
der Baureihe Ee 6/6 II wurde anders gearbeitet. Hier wurde die
Bei
der Baureihe Ee 6/6 II wurde anders gearbeitet. Hier wurde die
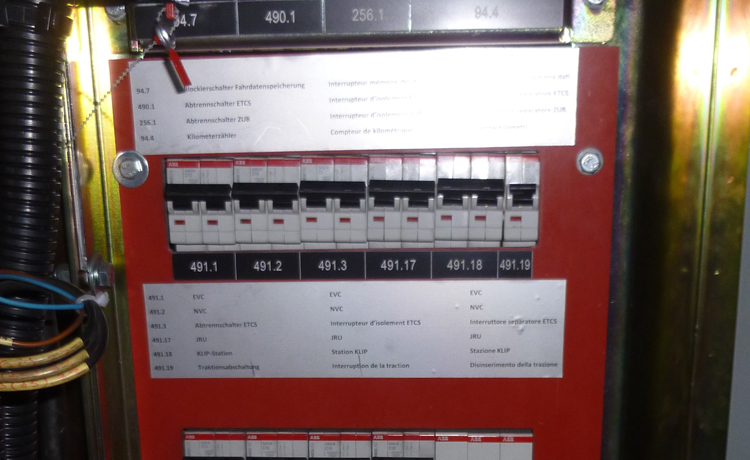 Da
wir noch keinen Rechner haben, konnte auch kein
Da
wir noch keinen Rechner haben, konnte auch kein
 Wurde
die
Wurde
die
 Wie
bei den anderen
Wie
bei den anderen