|
Bedienung der Lokomotive |
|||||||||||
| Navigation durch das Thema | |||||||||||
|
Wenn wir nun zur Bedienung der
Lokomotiven
kommen, dann versteht es sich, dass die von anderen
Baureihen
her bekannten Kontrollen vorgenommen werden mussten. Um die Lokomotive in
Betrieb nehmen zu können, musste man in das
Führerhaus
gelangen. Speziell war, was der Lokführer dort antraf, denn es gab
zwischen der Reihe Am 6/6 und Ee 6/6 II kaum grosse Unterschiede. Die
betrafen wirklich nur die
Inbetriebnahme.
Der Boden war mit Holzplatten belegt worden. Sowohl von der
farblichen Gestaltung als auch vom Bedienkon-zept her, wurden die Ideen
übernommen, die mit den
Baureihen
Em 3/3 und
Bm 4/4 eingeführt wurden.
Bedient werden konnten die
Lokomotiven
sowohl steh-end, als auch sitzend. Dazu waren einfache
Hocker
aufgestellt worden. Je nach Bedarf konnten die verschoben werden. Dabei
gab es durchaus Unterschiede zwischen dem
Rangierdienst
und den Fahrten auf der Strecke. Die hier verwendete Lösung war ebenfalls
schon lange erprobt und sie wurde vom Personal gut angenommen. Viel
Komfort durfte auf einer Lokomotive nicht erwartet werden.
Es sollte eine Bedienung mit nur einem Mann Besatzung möglich
sein. Da hier sehr oft Rangierlokführer mit einer geringeren Ausbildung
verwendet wurden, war klar, dass eine einfache Schulung möglich sein
musste. Daher war der Korpus und die Bedienung mit den vorhandenen
Baureihen
identisch und die Lösung der ersten
Diesellokomotive
passte gut zur Technik. Das ist auch der Grund, warum die Ee 6/6 II gleich
aufgebaut wurde.
Der
Führertisch
war zentral angeordnet worden und an der Wand befand sich eine Konsole.
Dort wurden Schalter für die
Heizungen
angebracht, aber auch die für den Betrieb wichtigen
Manometer
und
Instrumente
waren hier. Bei der Ausführung derselben gab es zu anderen
Baureihen
keinen Unterschied. Neben dem Vorteil, dass diese bekannt waren, konnten
so auch die vorhandenen Ersatzteile in den
Depots
und Werkstätten benutzt werden.
Wurde der Griff gegen «Ein» gedrückt, setzte die Vorschmierung ein
und anschliessend wurde der Motor gestartet. Der Griff konnte nun
losgelassen werden und er wechselte in den neu-tralen Zustand. Mit «Aus»
konnte der Motor abgestellt werden. Diese Prinzip konnte auf der Reihe Ee 6/6 II nicht umgesetzt werden, da es hier den Dieselmotor nicht gab. Der Schalter war jedoch auch vorhanden. Mit
ihm konnte der
Stromabnehmer
gehoben und anschliessend der
Hauptschalter
eingeschaltet werden. Auch hier gab es eine neutrale Stellung und nur auf
der Position «0» waren wirklich beide Modelle komplett ausgeschaltet
worden. Es waren über-schaubare Unterschiede.
Auch hier war die Prüfung der pneumatischen
Bremsen
vor der Fahrt wichtig. Für die
automatische Bremse
war auf dem Korpus ein
Führerbremsventil
der
Bauart
FV4a
verbaut worden. Dieses konnte auf die bekannte Weise bedient werden und es
zeigt, dass in der Regel rangiert wurde, denn es war auf der rechten Seite
in der Richtung vorwärts platziert worden. Im
Rangierdienst
musste es selten angewendet werden und so reichte diese Lösung.
Um die
Rangierbremse
zu prüfen musste der am Korpus montierte und senkt nach oben stehende
Fahrschalter
in die Richtung «Bremsen» verschoben werden. Da in unserem Fall die
Lokomotive
noch steht, wurde die Rangierbremse aktiviert. Ein im Fahrschalter
eingebauter roter Knopf war für die Bedienung der
Schleuderbremse
vorgesehen. Es waren die Bedienschritte, die auch bei den
Lokomotiven
der Reihe
Bm 4/4 erforderlich waren.
Um auch die
elektrische
Bremse zu nutzen war die Betriebsart «Normal» einzustellen.
Jetzt regelte die Steuerung sowohl die
Zugkraft,
als auch die elektrische Bremse, was in der Regel genutzt wurde. Wurde der Fahrschalter in die Richtung für die Zugkraft verschoben, begann die Steuerung mit dem Aufbau der Zugkraft. Wie hoch diese war, konnte mit dem Hebel eingestellt werden.
Wurde dieser ganz gegen den Boden gedrückt, stand die volle
Zugkraft
zur Verfügung. Die Steuerung regelte dabei diese anhand der
Leistung
und so musste sich der Lokführer nicht um die Einhaltung der maximalen
Ströme
kümmern. Zog man den Griff zurück bis zur senkrechten Stellung wechselte die Lokomotive in den Leerlauf. Die Zugkraft fiel aus. Ob nun weiter beschleu-nigt wurde, oder ob es zu einer Verzögerung kam, war von der Strecke abhängig.
Es war die Grundstellung, die es auch erlaubte den
Hauptschalter,
oder die Dieselsteuerschalter zu bedienen. In den anderen ging das zwar
auch, aber bei der Reihe Am 6/6 konnte das zu Problemen mit dem
Woodwardregler
führen. Wurde der Griff in die Richtung für die Verzögerung verschoben, aktivierte die Steuerung zuerst die elektrische Bremse. War deren Leistung für die verlangte Verzögerung nicht ausreichend, wurde die Rangierbremse akti-viert.
Dabei war die Steuerung auf die maximale Ausnutzung ausgelegt
worden. Im Falle eines schlechten Zustandes der
Schiene
arbeitet der
Gleitschutz
und reduzierte die
Bremskraft
entsprechend.
Sofern die
Anhängelast
an der
automatischen Bremse
angeschlossen wurde, konnte diese mit dem
Führerbremsventil
gebremst werden. Ohne eine entsprechende Massnahme aktiviert dieses auch
die pneumatischen
Bremsen
der
Lokomotive.
Die
elektrische
Bremse wurde ausgeschaltet. Jedoch konnte der
Lokführer diese Bremse auch auslösen. In dem Fall blieb die elektrische
Bremskraft
erhalten, was bei Talfahrten wichtig war.
Sprach eine
Sicherheitseinrichtung
an, oder wurde mit dem
Führerbremsventil
die
Schnellbremse
aktiviert, konnte die
Lokomotive
nicht mehr ausgelöst werden. In dem Fall wirkten also immer die
Druckluftbremsen.
Diese wurden bei
elektrischer
Bremse auch aktiviert, wenn diese aus einem Grund
ausfiel. Es war ein sehr einfaches Konzept vorhanden, das auf den Einsatz
im
Rangierdienst
ausgelegt worden war und das bekannt war.
Diese musste durch den Lokführer vor dem
Verschub
und auch nur mit
Rangierbahnhof
Limmattal aktiviert werden. Mit der Wahl der Betriebsart, verloren die
Bedienelemente im
Führerstand
die Funktion und der Ablaufrechner über-nahm den Betrieb der
Lokomotive
und diesen sehen wir uns an. Es wurde die Rangierbremse aktiviert, damit der Verschub stehen blieb. Dabei war es über Funk jedoch nur möglich diese zu aktivieren. Die elektrische Bremse war inaktiv geschaltet worden.
Zudem wurde nun der Geschwindigkeitsregler aktiviert. Die
Lokomotive
war damit für den
Verschub
bereit und der Lokführer konnte es sich gemütlich machen, denn in dieser
Betriebsart konnte er nur die
automatische Bremse
aktivieren. Begann der Verschub, löste der Ablaufrechner die Bremse und es wurde Zugkraft aufgebaut. Dabei regelte der Ablauf die Geschwindigkeit mit der Rangierbremse und dem Reg-ler.
Das erfolgte so lange, bis die
Lokomotive
den
Ablaufberg
erreicht hatte. Dort wurde sie durch den Ablaufrechner angehalten. Der
Lokführer änderte die Betriebsart und konnte mit der Lokomotive wieder
andere Aufgaben im
Rangierdienst
übernehmen.
Wurde der
Verschub
manuell ausgeführt, regelte der Lokführer die Geschwindigkeit und es wurde
in der normalen Betriebsart gearbeitet. Da wir nun wieder mit dem
Lokführer arbeiten, musste dieser Anzeigen für die Geschwindigkeit haben.
Dazu waren zahlreiche
V-Messer
verbaut worden. Im Bereich des Konsole war auch einer für den Verschub
vorhanden. Bei diesem konnten die geringen Geschwindigkeiten sehr genau
angezeigt werden.
Eine Anzeige war jedoch nur bis auf acht Kilometer in der Stunde
vorhanden. Bei schneller Fahrt auch im
Rangier-dienst,
mussten die anderen Anzeigen genutzt werden. Bei diesen war mit einer
roten Marke die
Höchstge-schwindigkeit
markiert worden. Die dabei verwendeten Modelle stammten von der Firma
Hasler in Bern und auch sie waren dem Personal bereits bekannt, was die
Bedienung derselben deutlich vereinfachte.
Montiert wurden diese
Geschwindigkeitsmesser
an den Säulen zwischen den beiden
Frontfenstern.
Dabei waren jetzt Anzeigen in beiden Fahrrichtungen vorhanden und
Unterschiede gab es nur beim Aufbau der beiden Anzeigen. Daher müssen wir
genauer hinsehen und dabei beginne mit der Vorwärtsrichtung der
Lokomotive
und hier war das Modell RT 9 montiert worden. Es verfügte über eine
einfache Uhr und den
Registrierstreifen.
In der Gegenrichtung, also an der
Frontwand
beim hinteren
Vorbau,
war das Modell R9 vorhanden. Dieses besass die für die Aufzeichnung des
Restweges notwendige
Farbscheibe.
Dank diesem zweiten
V-Messer
war bei normalen Fahrt immer in der Fahrrichtung eine Anzeige der
Geschwindigkeit vorhanden und so musste sich der Lokführer nicht
um-drehen, was den Blick auf den Fahrweg verhindert hätte, denn die
Signale mussten beachtet werden.
Im
Rangierdienst
wurden die
Lokomotiven
seit Jahren mit einem Sprechfunk versehen. Das dazu erforderliche Gerät
wurde im
Führerstand
in einer Halterung eingesetzt. Je nach
Bahnhof
konnten so andere Kanäle eingestellt werden. Das war besonders dann
wichtig, wenn in einer Anlage mehrere Lokomotiven eingesetzt wurden. Die
Antennen für den Empfang der Signale befanden sich auf dem Dach des
Führerhauses.
Die ankommenden Gespräche des
Funkes
wurden mit einem an der Decke über dem Bedienbereich montierten
Lautsprecher
ausgegeben. Damit waren diese auch bei Lärm leicht zu verstehen. Um selber
ein Gespräch zu führen, war ein Schwanenhals für das
Mikrophon
vorhanden. Dieses konnte so nahe an den Mund verschoben werden. Aktiviert
wurde das Mikrophon jedoch nur, wenn ein Druckknopf gedrückt wurde.
Auf der Strecke war kein
Funk
vorhanden. Diesen gab es bei Auslieferung der beiden
Baureihen
nur auf der Gotthardstrecke und er war dort auch nur bei
Güterzügen
vorgeschrieben worden. Obwohl das System im neuen
Rangierbahnhof
Limmattal vorhanden war, wurden die dort eingesetzten
Rangierlokomotiven
nicht damit ausgerüstet. Auch hier war klar zu erkennen, dass mit den
Modellen kaum auf der Strecke gefahren werden sollte.
Damit dem
Lokomotivpersonal
hier die Suche etwas er-leichtert werden konnte, waren die Schaltelemente
mit
Meldelampen
versehen worden. Leuchtete diese, war der betreffende Teil betroffen und
je nach Schaden, konnte dieser behoben werden.
Eine Hilfe in Form einer Diagnose gab es bekanntlich nicht. So
erfolgte oft die Suche nach dem Grund. Wenn diese ohne Erfolg war, oder
die Störung nach einer Behebung wieder vorhanden war, musste das Fahrzeug
notgedrungen abgeschleppt und einer Werkstatt zugeführt werden. Damit
kommen wir zum Schluss der Bedienung, die sich wirklich nicht so gross von
der
Baureihe
Bm 4/4 unterschied, wie man
das erwartet hätte.
Vor der Abstellung der
Lokomotive
wurde die
Druckluft
ergänzt und danach das Fahrzeug ausgeschaltet. Je nach Ausführung erfolgte
das leicht anders, aber danach war das Vorgehen identisch. Es wurden die
Absperrhähne
zu den
Hauptluftbehältern
verschlossen und danach die
Batterie
ausgeschaltet. Mit der Aussenkontrolle waren die Arbeiten bereits
abgeschlossen und das Personal konnte sich am
Feierabend
erfreuten.
Klingt gut, aber wir haben die Rechnung ohne die
Baureihe
Am 6/6 gemacht. Diese musste an die
Vorheizanlage
angeschlossen werden, wenn sie längere Zeit abgestellt wurde. Nach dem das
Kabel verbunden wurde, musste geprüft werden ob die Pumpe lief. Danach
musste nur noch das Fahrzeug mit der Vorheiztafel gekennzeichnet werden.
Jetzt konnte man sich auch bei der
Diesellokomotive
entfernen und den Tag auf der Maschine beenden.
|
|||||||||||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |||||||||
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | ||||||||
|
Copyright 2025 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||||||||||
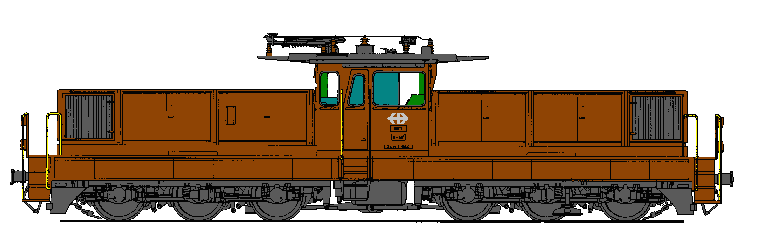 Nachdem
wir in das
Nachdem
wir in das
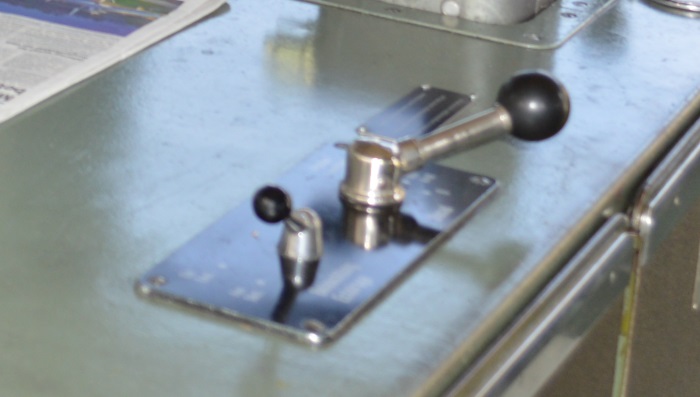 Wenn
wir nun die
Wenn
wir nun die
 Speziell
war hier der Schalter für die Betriebsart. Bei der
Speziell
war hier der Schalter für die Betriebsart. Bei der
 Bevor
wir uns die Fahrt und die Anzeige der Geschwin-digkeit ansehen, müssen wir
noch die Betriebsart mit der
Bevor
wir uns die Fahrt und die Anzeige der Geschwin-digkeit ansehen, müssen wir
noch die Betriebsart mit der 
 Ob
die
Ob
die