|
Umbauten und Änderungen |
|||||||||||
| Navigation durch das Thema | |||||||||||
|
Nun kommen wir zum Thema, das aufzeigt, wie gut die vorgestellte
Technik arbeitet. Gab es schnell umfangreiche Umbauten, kann angenommen
werden, dass es Probleme gab. Wurde kaum etwas verändert, ist zu erwarten,
dass man mit dem Produkt zufrieden war. Spannend wird dieses Kapitel hier,
weil beide
Baureihen
als
Prototypen
angesehen wurden und es zu keiner weiteren Bestellung kam. Das ist kein
gutes Zeichen.
In den bestehenden drängte sich kein Ersatz auf. Da gab es keine
weitere Arbeit für die
Diesellokomotive,
die wirklich gross ausgefallen war. So war sie für viele Hilfs-einsätze
schlicht zu gross geworden.
Die
Baureihe
Ee 6/6 II sollte die uralten
Krokodile im
Verschub
ablösen. Grundsätzlich hätte man dabei auch die Reihe Am 6/6 nehmen
können. Jedoch arbeiteten die alten Maschinen in Anlagen mit
Fahrleitung.
So drängte sich eine elektrische Lösung auf und die
Rangierlokomotive
mit den
Drehstrommotoren
war ein wichtiger Schritt, auch wenn es nicht zur Serie kommen sollte. Es
fehlte auch hier an der Arbeit für eine schwere
Verschublokomotive.
Auch wenn die Technik mit den
Stromrichtern
neu war, sie bewährte sich auf den hier vorgestellten
Lokomotiven.
Nur wenige Jahre später sollte dann eine Lokomotive für die Strecke
kommen. Diese hatte jedoch
GTO-Thyristoren
erhalten, die eine einfachere Schaltung ergaben und die nicht so viel
Platz benötigten. Dieser hatte bei der
Baureihe
Ee 6/6 II schlicht gefehlt und so musste man die
Leistung
notgedrungen reduzieren.
Als dann die Vierquadrantensteller kamen, arbeitete man nicht mehr
mit den schweren
Thyristoren,
sondern mit den
Transistoren
nach der
Bauart
IGBT.
Diese waren leicht und benötigten kaum Platz und so hätten sie zu den
Stromrichtern
hier gepasst. Jedoch benötigten die IGBT auch einen Rechner für die
umfangreichen Aufgaben. Diesen gab es hier nicht und er hätte mit samt der
Diagnose nachgerüstet werden müssen.
Sowohl die
Baureihe
Am 6/6, als auch die Reihe Ee 6/6 II, waren nach der ersten
Versuchslokomotive
Be 4/4 die logische Folge. Die statischen
Umrichter
waren so weit, dass man sie in einer kleinen Serie einbauen und so weitere
Erfahrungen damit sammeln konnten. So gesehen, passten die beiden
Baureihen wunderbar in die Entwicklung der Technik, die durchaus mit
einfachen
Thyristoren
aufgebaut werden konnte.
Die neuen
GTO-Thyristoren
benötigten die Vierquadrantensteller nicht mehr, also wurden diese
Schaltungen nicht mehr weiter verfolgt. Denn ein einfacher Aufbau war
wichtig und hier wurde einfach der Schritt auf die neuen GTO verpasst. Nun
war die gute Funktion der
Stromrichter
das Problem. Was funktioniert ersetzt man nicht. Die Technik mit der
veralteten Lösung blieb schlicht erhalten und das konnte nicht gut gehen.
Zu ersten grossen Problemen kam es mit den CMOS-Prozessoren. Diese
waren schon immer anfällig, da die verwendeten Baugruppen sehr anfällig
auf Störungen bei der
Spannung
reagierten. Davon mehr betroffen war die
Baureihe
Ee 6/6 II, aber auch bei der
Diesellokomotive
kam es zu Problemen und so mussten die CMOS-Prozessoren immer wieder
ersetzt werden. Arbeit für die
Depots,
die dazu auf die
Lager
zurück griffen, die immer leerer wurden.
Damit sollte die Sinuswelle nicht mehr so zackig werden. Eine
wirklich schöne Welle sollte aber mit den
Thyristoren
nicht erreicht werden, denn die Vierquadrantensteller waren noch im
ursprünglichen Zustand. Die Lokomotiven wurden anlässlich einer Revision mit den neuen Bauteilen von der Firma Intel versehen. Sie waren an der Türe anhand des Logos und des Schriftzuges der amerikanischen Firma zu erkennen.
Erst als alle umgerüstet waren, verschwand der Hinweis wieder. Wer
nun aber einen Rechner erwartet, liegt falsch, denn es wurden einfache
Prozessoren verwendet, die einfach nach einen verbesserten Prinzip gebaut
wur-den. Als es dann zu grösseren Problemen mit der Beschaffung der veralteten Thyristoren kam, mussten die ersten Loko-motiven als Ersatzteilspender ausrangiert werden.
Spätestens jetzt hätte ein Ersatz der
Stromrichter
her müssen. Eine Modernisierung die keine Unternehmung bei einer
Rangierlokomotive
vornehmen wird. Besonders dann nicht, wenn neue
Diesellokomotiven
bestellt worden waren. Doch wo lag das Problem?
Bei diesen gab es bei der Reihe Ee 6/6 II durchaus grössere
Problem. Der Grund dabei ist, dass es zwei
Stromrichter
gab und eine
Redundanz
fehlte. fiel nur ein
Thyristor
aus, konnte die Maschine nicht mehr benutzt werden. Die verwendete
Bauteile waren dieser Form auf dem Markt schlicht nicht erhältlich, denn
bei Stromrichtern wurden vermehrt
Transistoren
verwendet, da sie einfacher waren und schneller geschaltet werden konnten.
Man benötigte keine
Prototypen
für die Technik mehr, denn diese konnte sich durchsetzen. Neue
Umrichter
waren aber mit dem alten Aufbau nicht kompatibel.
Neben diesen grundlegenden Änderungen gab es noch Anpassungen, die
aber nur die
Baureihe
Am 6/6 betra-fen. Genau genommen war es der
Dieselmotor
und den gab es bei der elektrischen Lösung nicht. Auch wenn der
Woodwardregler
gut war, er konnte nicht verhindern, dass es bei der Verbrennung zu
ungünstigen Füllungen kam. Eine dunkel gefärbte Rauchwolke war die Folge
davon und es roch auch nach Diesel der nicht verbrannte.
Die vom Motor ausgestossenen
Abgase
enthielten viel Russ, der färbte diese immer wieder schwarz. Daher wurden
die Abgase vor dem Ausstoss gereinigt. Ein Verbrenner sorgte dafür, dass
der Russ verbrannt wurde. So rauchte es auf der
Lokomotive
nicht mehr so stark. Zu erkennen war diese neuen Anlage zur Verbrennung
von Russ am Rohr das seitlich vom
Schalldämpfer
montiert worden war und das sich durch die Wärme schnell verfärbte.
Ein Problem mit dem
Rangierpersonal
gab es bei schlechtem Wetter. Bei langen Perioden mit Regen hatte man in
den
Bahnhöfen
ein paar Güterzugbegleitwagen der
Bauart
«Sputnik» vorrätig. Diese wurden mitgeführt und so konnte das Personal im
Trockenen mitfahren. Im neuen
Rangierbahnhof
Limmattal gab es diese jedoch nicht und so musste die Situation auf der
Lokomotive
deutlich verbessert wurden und dazu wurde ein
Plattform
umgebaut.
Damit das sich hier aufgestellte Personal den Fahrweg überblicken
konnte, wurden in der
Front
zwei identische Fenster auf gleicher Höhe eingebaut. Seitliche Türen gab
es nicht und so war eine keine trockene Kabine vorhan-den, die nur der
Fahrwind abhielt. Auch wenn das Problem auch bei der Baureihe Ee 6/6 II bestand, kam es dort nicht zu diesem Umbau. Die Ma-schinen wurden in alten bestehenden Anlagen eingesetzt und in diesen war schon vor der Auslieferung für genü-gend Sputnik gesorgt worden.
So änderte sich an der Praxis nichts und nur der sehr spezielle
Einsatz der Reihe Am 6/6 war für diesen Umbau verantwortlich. Somit auch
hier kein grosser Fehler der
Lokomotive. Mit den Revisionen kam auch der Neuanstrich. Die beiden Baureihen wurden dabei nicht mit der neuen roten Farbe versehen.
Während die Modelle der Reihe Am 6/6 auch so nach wenigen Wochen
schwarz patiniert wurde, war der Anstrich bei der Reihe Ee 6/6 II noch
gut. Als es wirklich einen neuen Anstrich benötigte, stand bereits die
Ausrangierung
an. Der Betriebseinsatz wird dann zeigen, warum es zu einem so schnellen
Ende kam.
Verändert wurden jedoch die Anschriften. Das bisher gelbe Signet
an der Seitenwand der
Führerhäuser
wurde nun weiss. An der
Lokomotivbrücke
wurde dieses auf rotem Grund mit dem Schriftzug SBB CFF FFS angebracht.
Auch hier war die Schrift in weiss gehalten. Es war also eine Anpassung
vorhanden, auch wenn das nicht zu komplett neuen Farben geführt hatte.
Anhand der Anschriften konnte man erkennen, wenn die Maschine gehört.
Zwar konnte dank der neuen Spiegeln beide Seiten überblickt
werden, aber was unmittelbar vor der Maschine lag, konnte schlicht nicht
erkannt werden. Das konnte durchaus für das
Rangierpersonal
im
Gleisfeld
gefährlich werden. Um die Sicht zu verbessern und wegen den sehr guten Erfahrungen bei der Baureihe Am 843 montierte man an den Schutzblechen der Rangierplattform kleine Kamera, die den Bereich unmittelbar vor der Lokomotive über-wachten.
Das aufgenommene Bild wurde mit einem kleinen
Bild-schirm
im
Führerstand
angezeigt. So konnte nun auch auf die
Puffer
gesehen werden, war das Anfahren, an die oft nur schlecht gesicherten
Abläufe
vereinfachte.
Die Anlage stammte aus dem Ersatzteillager der
Baureihe
Am 843. Da diese neuen
Rangierlokomotive
nach den farblichen Vorgaben anhand der neuen Regel, gefärbt wurden kam es
zu den roten Farbtupfern bei den hier vorgestellten Baureihen. Letztlich
spielte es keine so gros-se Rolle, denn die Kamera waren wirklich eine
grosse Erleichterung, die gerade bei der extrem unübersichtlichen
Baureihe
Am 6/6 sehr hilfreich war.
Damit können wir die Umbauten und Änderungen bereits beschliessen.
Da es zu keinem grossen Umbau kam, kann festgestellt werden, dass die
Technik mit den neuen
Stromrichter
funktionierte. Als es mit diesen altersbedingt Probleme gab, war es
schlicht nicht mehr möglich die Bauteile zu beschaffen. Die entsprechenden
Thyristoren
wurden nicht mehr gebaut, weil sich die Version
GTO
durchsetzen konnte und so blieb nur ein Ersatzteilspender.
|
|||||||||||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |||||||||
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | ||||||||
|
Copyright 2025 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||||||||||
 Es
waren nicht die Probleme mit
Es
waren nicht die Probleme mit
 Ein
Umbau der
Ein
Umbau der
 Erste
Probleme gab es mit den CMOS-Prozessoren. Diese konnten nicht mehr bezogen
werden, daher mussten sie ersetzt werden. Die neu eingebauten Prozessoren
wurden von der Firma Intel bezogen und sie konnten deutlich besser
arbeiten.
Erste
Probleme gab es mit den CMOS-Prozessoren. Diese konnten nicht mehr bezogen
werden, daher mussten sie ersetzt werden. Die neu eingebauten Prozessoren
wurden von der Firma Intel bezogen und sie konnten deutlich besser
arbeiten.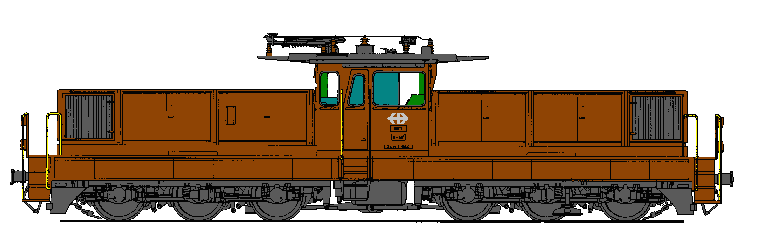 Wir
können den Bereich mit den
Wir
können den Bereich mit den
 Bei
der vorderen
Bei
der vorderen
 Als
man damit begann die
Als
man damit begann die