|
Betriebseinsatz |
|||||||||||
| Navigation durch das Thema |
|
||||||||||
|
Eigentlich hätten wir hier den kürzesten Betriebseinsatz aller
Zeiten. Gerade die
Lokomotiven
Am 6/6 können mit einem Satz erledigt werden. Nach der Auslieferung kamen
die Maschinen in den
Rangierbahnhof
Limmattal und sie blieben dort bis zur
Ausrangierung.
Damit können wir bereits zur
Baureihe
Ee 6/6 II wechseln, denn bei deren Karriere gab es mehr Bewegung. Es wurde
eine Lokomotiven an einen anderen Ort versetzt.
Die ersten Maschinen wurden im Jahre 1976 vom Her-steller an die
Schweizerischen Bundesbahnen SBB über-geben. Dabei gelangten die fertigen
Lokomotiven
über Basel in die Schweiz. Nach dem Zoll kam die Reise nach Zürich.
Auch wenn im neuen
Rangierbahnhof
im Limmattal bereits die ersten Züge rangiert wurden, ging es mit der
neuen
Lokomotive
an die
Inbetriebsetzung.
Auch wenn in der Regel
Diesellokomotiven
einfach waren, hier war es der neuartige
Antrieb,
der geprüft werden musste. Niemand wusste damals was die
Asynchronmotoren
wirklich leisten konnten. Der
Versuchsbetrieb
damit fand 1976 statt und an diesen konnte sich niemand erinnern.
Die umfangreichen
Versuchsfahrten
führten die
Lokomotiven
Am 6/6 auch vor Züge. Oft wurde eine elektrische Lokomotive als Last
mitgeführt und so die nagelneue
Diesellokomotive
richtig gefordert. Bei einer
Anfahrzugkraft von 400 kN musste man aber auch eine kräftige
Bremslokomotive
haben. Daher war oft auch ein ebenso neues Modell der Reihe
Re 6/6 mit von der Partie. Ein paar
Wagen dienten als zusätzliche Last für die Fahrt.
Viel wurde über diese Versuche nicht berichtet. Es war noch eine
Zeit, wo diese kaum auf grosses Interesse stiessen und da viele andere
neuen Modelle auf die Strecken kamen, fiel die knurrende
Diesellokomotive
nur wenigen Leuten auf. Als es dann wirklich bekannt wurde, was das Teil
leisten konnte, war es schon zu spät und die Maschinen der
Baureihe
Am 6/6 verschwanden im neuen
Rangierbahnhof
vor den Toren von Zürich.
Auch hier lief die
Funkfernsteuerung
nicht immer so, wie man dies erwartet hatte. Die Idee, dass der
Rangier-lokführer während dem Versuch andere Aufgaben über-nimmt, war
nicht so durchdacht, denn niemand hätte für den Stopp gesorgt. Zwei weitere Lokomotiven waren in der neuen Ausfahr-gruppe mit dem Auszug beschäftigt. Bei diesem Einsatz werden die formierten Züge aus der Richtungsgruppe in die Geleise für die Ausfahrt gezogen.
Durch die Änderung des Konzeptes im RBL kann es zu diesem
besonderen Einsatz. Damit waren jedoch bis zu fünf
Lokomotiven
eingeplant. Die verbliebende Maschine war als Reserve vorgesehen, oder sie
war gerade im Unterhalt. Kleinere Unterhaltsarbeiten an den Lokomotiven wurden im dazu vorgesehenen Depot des Rangierbahnhofes ausge-führt. Wie auch an anderen Orten, hatten diese Bahnhöfe eigene Depots erhalten.
Zumindest zu Beginn, waren aber nur die Lokführer für die
Rangierlokomotiven
hier zu Hause. Die geplanten Streckenlokführer sollten noch ein paar Jahre
auf sich warten lassen. Das
Depot
mit Werkstatt war daher nicht sonderlich ausgelastet.
Für den schweren Unterhalt mussten die
Lokomotiven
den neuen
Rangierbahnhof
im Limmattal verlassen. Dabei reisten die Maschinen geschleppt nach dem
Bahnhof
von Biel / Bienne und wurden dort der
Hauptwerkstätte
überstellt. Wie alle anderen
Diesellokomotiven
waren die neuen schweren
Verschublokomotiven
dort zugeteilt worden und das sollte auch für die bestellte Reihe Ee 6/6
II gelten, da sie sehr nahe verwandt sein sollte.
Dazu gehörte der neue Eingangsstromrichter. Bisher wurde noch
nicht mit dem umgekehrten Fluss des
Stro-mes
gearbeitet und die Maschine hatte die erste
Nutz-strombremse
mit statischen
Umrichter.
Daher kam es auch hier zu sehr intensiven
Versuchs-fahrten,
die auf unterschiedlichen Strecken ausgeführt wurden. Anlässlich dieser
Versuchsfahrten kam die
Lokomotive
auch an den Gotthard. Wollte man die Funktion der
elektrischen
Bremse auch während längerer Zeit testen, kam man nicht um
diese Strecke herum. Die hier verbaute Lösung konnte im Gegensatz zur
Baureihe
Am 6/6 dauerhaft betrieben werden.
Wie weit in den Süden die Maschine dabei vorstiess, ist mir nicht
bekannt. Jedoch kann gesagt werden, dass es viele Jahre dauern sollte, bis
wieder eine Ee 6/6 II so weit in den Süden reiste. Sie war als Ersatz für
einen Veteranen der Gotthardstrecke vorgesehen und auch sie sollte ihre
Erfahrungen mit der Strecke auch machen können. Das Problem war eher die
Auslastung der Strecke, die kaum mehr Versuche zuliess.
Mit dem Abschluss der Versuche wurden die zehn
Lokomotiven
der Reihe Ee 6/6 II in der Schweiz verteilt. So wurden in den
Bahnhöfen
Zürich-Altstetten, Buchs SG, RBL, Schaffhausen und Winterthur je eine
Maschine stationiert. Sie ersetzten dort mit einer Ausnahme die Modelle
der
Baureihe
Ce 6/8 II und die Ausnahme
war die Maschine im
Rangierbahnhof
Limmattal, wo sich die Lokomotiven der Reihe Am 6/6 eingenistet hatten.
Sie konnte als Ersatz eingesetzt werden, denn nicht alle Arbeiten
im
Rangierbahnhof
mussten mit
Diesel
gefahren werden. Dazu gehörte auch eine der bei-den im
Verschub
eingesetzten Maschinen. Schwerer war es jedoch im Auszug auf der östlichen
Seite. Die verbliebenen fünf Maschinen kamen in den Bahnhöfen Biel/Bienne, Lausanne und St. Triphon zum Einsatz. Dabei wurden die Modelle in Lausanne im dortigen Rangierbahnhof Triage eingesetzt . Jene
in St. Triphon war mit schweren
Ölzügen
beschäftigt. Als Ersatz gab es hier kam mehr Ma-schinen und wenn, dann zog
man eine der beiden in Biel RB stationierten Maschinen ab und schickte sie
als Ersatz an einen anderen Ort. Ausgeführt wurden die Fahrten immer wieder in eigener Kraft und so kam zumindest diese Baureihe auch auf der Strecke zum Einsatz. Selbst Güterzüge wurden mit der schweren Verschublokomotive ge-zogen.
So waren auch die Modelle der Reihe Ee 6/6 II sehr gut ausgelastet
und das konnte man riskieren, denn es gab zu Beginn kaum grössere Störung.
Die verbaute Technik zeigte, was sie leisten konnte und so wurde der Weg
für
Umrichter
geebnet.
Wenn man einen Punkt als negativ ansehen will, dann waren das die
im RBL eingesetzt Modelle der Reihe Am 6/6. Der
Dieselmotor
war nicht so gut abgedichtet worden, wie man das gerne gehabt hätte. So
trat
Schmieröl
aus, das sich an der
Lokomotive
verteilte. Den Verlust ergänzte man im Unterhalt, aber die Maschinen sahen
nach wenigen Jahren sehr verschmutzt aus. Das wurde durch den Russ in den
Abgasen
noch verstärkt.
Es wurde eine grössere
Rangierlokomotive
benötigt und daher wurde die im RBL eingesetzte Ee 6/6 II auf die Reise in
die Innerschweiz geschickt. Es war die einzige Ma-schine, die an einen
neuen Ort kommen sollte, denn sonst blieben sie dem Standort treu. Da es nun im RBL am Ersatz fehlte, wurden dort einige Modelle der Reihe Bm 4/4 stationiert. Diese konnten je-doch nicht im Verschub eingesetzt werden. Da sie nicht über Funk gesteuert werden konnten, wurde die ältere Maschine im Auszug im östlichen Teil einge-setzt.
Oft fand man die Reihe Am 6/6 nur noch am Berg, da die Prozessoren
immer wieder für Störungen sorgten und so oft zwei bis drei Maschinen in
der Werkstatt weilten.
Es zeigte sich nun, dass es von den schweren
Verschub-lokomotive
zu wenige Modelle gab. Eine weitere Be-schaffung wurde jedoch
ausgeschlossen, da man die Pro-bleme mit neuen Prozessoren beheben wollte.
Die in Rot-kreuz nach wenigen Jahren wieder abgezogene Maschine der
Baureihe
Ee 6/6 II kam nicht mehr in den RBL, sondern wurde als Ersatz für die
anderen neuen Maschinen genommen. So gab es dort eine leichte Entspannung.
Wenn Sie nun Änderungen in den
Dienstplänen
erwarten, dann muss ich Sie enttäuschen, denn es gab bei
Rangierlokomotiven
kaum Bewegung und hier sogar gar keine. Es waren zu spezielle Maschinen,
die kaum an anderen Stellen eingesetzt wurden. Jedoch sollte es immer
wieder Ausnahmen geben und diese betrafen die
Baureihe
Am 6/6. Die grösste
Diesellokomotive
der Schweiz war natürlich auch an Ausstellungen gerne gesehen.
Sei es, weil er wegen der steilen Rampe in der Zu-fahrt nicht mehr losfahren konnte, oder weil die Lokomotive einen Defekt hatte.
Dann wurde die Am 6/6 auch einmal ausserhalb der
Einfahrsignale
eingesetzt. Mit der unbändigen Kraft dieser Maschinen brachten sie jeden
Zug in den
Ran-gierbahnhof. Zu ersten grösseren Problemen kam es, als die alten Thyristoren nicht mehr so leicht beschafft werden konnten. Die Industrie hatte nun die besseren GTO und daher wurden die verwendeten Thyristoren nicht mehr verbaut.
Das wirkte sich auf die Ersatzteile negativ aus und daher mussten
diese auf sehr unkonventionelle Weise beschafft werden. Als erstes sollte
es die Maschinen der
Baureihe
Am 6/6 treffen, denn hier gab es Probleme. So wurde im Jahr 2004 mit der Nummer 18 524 die erste Lokomotive der Baureihe Am 6/6 der Ausran-gierung zugeführt.
Sie ging nicht sofort in den Abbruch, denn es wurden die
Ersatzteile entnommen. Erst als auch der Ersatzteilspender leer geräumt
war, ging er in den Abbruch. Damit fehlte aber eine der Maschinen im RBL
und so wurden dort die
Dienstpläne
geändert. Eine Anpassung, die nicht mehr rückgängig gemacht wurde.
Auf der östlichen Seite waren im Auszug immer wieder Modelle der
Reihe
Bm 4/4 zu sehen. Dieses Bild
sollte sich nicht mehr ändern, denn nun wurden sie planmässig eingesetzt.
Die grossen
Verschublokomotiven
waren daher oft nur am Berg zu sehen. Der dort durchgeführte automatische
Verschub
zwang dazu, auch wenn es immer wieder knapp mit den Maschinen wurde und
dann wechselte man in den Notbetrieb am
Ablaufberg.
So
ging es nur so. Die kleinere Maschine ver-schwand wieder, als man wieder
genug einsetzbare Modelle der Reihe Am 6/6 hatte. Hier zeigten sich die
Probleme mit so speziellen Lösungen sehr deut-lich. Das Problem mit den Thyristoren konnte nicht be-hoben werden, denn dazu hätten die Stromrichter ersetzt werden müssen.
Die damit verbundenen Kosten sollten nicht gedeckt werden, daher
kam es schlicht nicht zu einer Modernisierung und Schuld dabei waren die
neuen Modelle der
Baureihe
Am 843, denn diese konnten auch mit
dem Ablaufrechner gesteuert werden. Wobei dieser dafür jedoch leicht
angepasst werden musste.
Als die Ersatzteile wieder zum grossen Mangel wurden, musste ein
neuer Spender her. Da man die
Baureihe
Am 6/6 nicht noch weiter schwächen wollte, war nun eine Maschine der Reihe
Ee 6/6 II an der Reihe. Auf die Nummer 16 811 konnte man eher verzichten.
So kam bei dieser die
Ausrangierung
im Jahre 2012 und es sollte der letzte Ersatzteilspender sein, denn es
zeigte sich, dass diese Modelle von der Technik überholt wurden.
Es sollte nicht lange gut gehen. So kam es, dass die
Lokomotiven
der
Baureihe
Ee 6/6 II zwischen 2014 und 2020 ausrangiert wurden. Im Juli 2020
verschwand die Letzte und somit können wir die Bücher dieser besonderen
Rangierlokomotive
nach einem Einsatz von 40 Jahren beenden. Auch wenn das kurz erscheint,
für die neue Technik war das eine gute Karriere. Man darf nicht vergessen,
vorher gab es kaum viele Erfahrungen mit
Umrichter.
So gut geeignet waren sie jedoch nicht und so musste man auch in
diesem
Bahnhof
auf die Reihe
Am 843 setzen. So richtig
glücklich war man mit der
Diesellokomotive
unter der
Fahrleitung
auch wieder nicht. Das auch, weil man bei den
Staatsbahnen
immer weniger davon einsetzen wollte. Daher wurde eine neue schwere Verschublokomotive aus-geschrieben, die aber auch vor den schweren Bauzügen eingesetzt werden sollte. Speziell bei diesen Maschinen war, dass sie einen Betrieb ab Fahrleitung erlauben sollten, aber trotzdem auch von der Fahrleitung unabhängig sein sollten.
Daher wurde auch ein
Antrieb
mit einem
Dieselmotor
eingebaut. Die neuen
Lokomotiven
sollten als
Baureihe
Aem 940 geführt werden.
Als die
Prototypen
der neuen
Baureihe
zuverlässig genug waren, wurden sie in den RBL versetzt. So konnten dort
die Modelle der Baureihe Am 6/6 abgelöst werden. Die Baureihe verschwand
im Jahre 2021 und damit auch die letzten
Thyristoren,
denn nun hatten die
IGBT
mit den Vierquadrantensteller den Durchbruch geschafft und die veraltete
Technik war nach einem Einsatz von immerhin 45 Jahren am Ende der
Lebensdauer.
Zwar bemühte sich das Personal im RBL um den Erhalt einer
Lokomotive
der Reihe Am 6/6. Dazu kam es jedoch nicht und so kam es, dass die grösste
je in der Schweiz gebaute
Diesellokomotive
endgültig verschwand. Ein grosser Verlust, denn an die ersten Schritte mit
der
Umrichtertechnik
sollte nichts mehr erinnern. Wir können die Bücher der ersten beiden
grösseren Reihen mit statischem
Umrichter
schliessen. Sie ebneten den Weg zur heutigen Technik.
|
|||||||||||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
||||||||||
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | ||||||||
|
Copyright 2025 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||||||||||
 Es
kann jedoch durchaus spannend sein, genauer hinzu-sehen. Was war passiert,
dass es nicht mehr Bewegung gab? Damit müssen wir an den Anfang der
Geschichte gehen und kommen so zuerst zur älteren
Es
kann jedoch durchaus spannend sein, genauer hinzu-sehen. Was war passiert,
dass es nicht mehr Bewegung gab? Damit müssen wir an den Anfang der
Geschichte gehen und kommen so zuerst zur älteren
 Im
grossen
Im
grossen
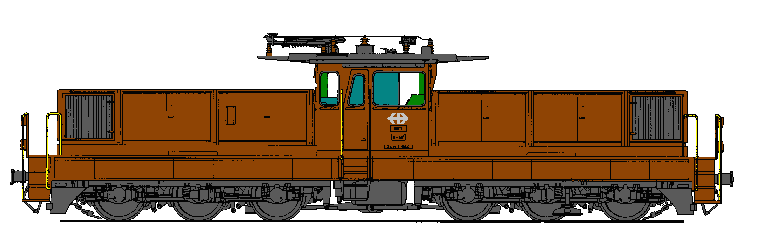 Vier
Jahre nach den Modellen der Reihe Am 6/6 kamen die elektrischen Maschinen
mit der Bezeichnung Ee 6/6 II. Auch wenn viele Punkte bereits bekannt
waren, gab es sehr viele neue Punkte, die vor dem Einsatz geprüft werden
mussten.
Vier
Jahre nach den Modellen der Reihe Am 6/6 kamen die elektrischen Maschinen
mit der Bezeichnung Ee 6/6 II. Auch wenn viele Punkte bereits bekannt
waren, gab es sehr viele neue Punkte, die vor dem Einsatz geprüft werden
mussten. Im
RBL waren die
Im
RBL waren die
 Erste
Bewegung in die
Erste
Bewegung in die
 Planmässig
kamen diese aber kaum aus dem RBL. Ausgenommen davon war, wenn ein
Planmässig
kamen diese aber kaum aus dem RBL. Ausgenommen davon war, wenn ein 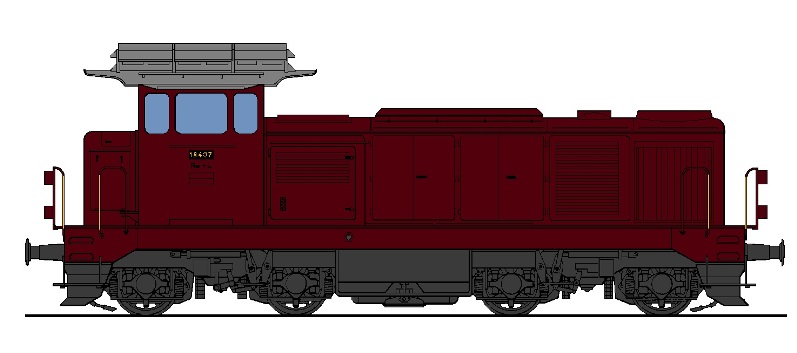 Dann
kamen auch Maschinen der Reihe
Dann
kamen auch Maschinen der Reihe
 Die
Lücke im
Die
Lücke im