|
Betriebseinsatz Teil 1 |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Eine regelrechte
Inbetriebsetzung
wurde mit den ersten Maschinen gar nicht mehr durchgeführt. Diese wurden
schliesslich aus dem Muster der
Schweizerischen
Centralbahn
SCB
abgeleitet. Dort hatte man seinerzeit die erforderlichen Arbeiten
durchgeführt. Eine neuerliche Überprüfung schied daher aus. Die Reihe E
3/3 sollte daher augenblicklich in den Verkehr kommen. Doch da gab es ganz
am Anfang noch ein Problem.
Genau genommen handelte es sich um die
Lokomotiven mit den Nummern 47 bis 49. Diese waren beim
Hersteller in der Montage, als die
SCB
verschwand. Durch die Verstaatlichung wurden diese drei Maschinen an die Schweizerischen Bundesbahnen SBB ausgeliefert. Da man im Werk nicht mehr reagieren konnte, hatten die Modelle die Nummern des Bestellers. Es sollten somit die ersten Modelle sein,
die an die
Staats-bahn
übergingen. Jedoch hatte diese gerade mit den noch laufenden Bestellungen
zu kämpfen, denn auch die erste
A3t,
wurde noch mit der Nummer der
JS
ausgeliefert. Die Schweizerischen Bundesbahnen SBB
teilten die drei
Lokomotiven dem
Kreis
II, also der ehemaligen
SCB
zu. Somit kamen diese drei Maschinen eigentlich auch dorthin, wo sie
ursprünglich bestellt wurden. Dort sollten mit den Lokomotiven aber die
Versuchsfahrten
und Leistungstests beginnen. Es waren die Modelle, die für die Serien der
Staatsbahnen
beschafft werden sollten. Daher lohnt es sich, wenn wir genauer hinsehen. Mit den
Lokomotiven sollten die wichtigsten Daten für die neue
Baureihe festgelegt werden. Solche Daten waren bei den Dampflokomotiven
deutlich wichtiger, als bei den später ausgelieferten elektrischen
Modellen. Die machten damals schlicht die ersten Gehversuche zwischen
Seebach und Regensdorf. So richtig an diese Technik glauben wollte damals
schlicht noch niemand. Daher auch die Erfassung dieser Daten bei der neuen
Baureihe.
Mit drei
Lokomotiven konnten Mittelwerte erfasst wer-den, was für die
Planung der
Lokomotivdienst
be-sonders wichtig war. Dort wurde bekanntlich auch der Besuch im
Depot
geplant. Die dabei für die Baureihe E 3/3 erfassten Verbrauchs-werte lagen bei rund 90 Kilogramm Kohle bei einer Stunde Rangierdienst. Damit konnte die Lokomotive mit dem mitgeführten Vorrat von 1,7 Tonnen Kohle während rund 18 Stunden eingesetzt werden. Wobei hier natürlich nicht nur der
Kessel
eine Rolle spielte, es war auch das in einem
Bahnhof
anfallende Volumen bei der Arbeit. Leichte Wagen brauchten weniger
Kohle,
als schwere Exemplare. Die neue
Lokomotive musste bei durchgehendem Be-trieb sicherlich
einmal am Tag ausgewechselt werden. Bei grösseren
Bahnhöfen
war das der Fall, in kleineren Orten wurde in dieser Zeit die Arbeit
jedoch erledigt. So wusste man, wo mehrere Maschinen stationiert werden
mussten und wo es bei einem Modell bleiben konnte. Wobei Dampflokomotiven
in der Regel täglich einem
Depot
für wichtige Arbeiten zugeführt wurden. Diese Zeit in einem
Depot
konnte dann gleich für den normalen Unterhalt genutzt werden. Letztlich
bedeute das, dass die
Lokomotive zwar ohne Feuer abgestellt werden konnte, dass
aber am nächsten Morgen sicherlich noch etwas Dampf für den
Hilfsbläser
zur Verfügung stand. So vermochte die
Rangierlokomotive
im Normalfall wohl nie ganz abzukühlen, was die Vorheizzeit reduzierte.
Eine für die Planung wichtiger Wert war damit vorhanden.
Stand die Maschine beim
Wasserkran,
konnte sie nicht bewegt werden. Deshalb müssen wir uns auch diese Werte
etwas genauer ansehen, denn sie waren für den
Dienstplan
ebenso wichtig, wie die
Kohlen. Der Verbrauch beim Wasser lag bei 720 Kilogramm bei einer Stunde Rangierdienst. Man rechnete beim Wasser nicht mit Litern, wobei das keine grosse Rechnung wäre, denn ein Kilogramm Wasser entspricht in der Regel einem Liter. Somit verbrauchte die Lokomotive während
einer Stunde Rangierdienst rund 720 Liter Wasser. Bei einem Vorrat von 4.2
Tonnen, konnte die
Lokomotive während knapp sechs Stunden ohne Ergänzung des
Vorrates eingesetzt werden. Es zeigte sich klar, dass in der Regel die Rangierlokomotive ihre Arbeit verrichten konnte und man in der Pause schnell mal Wasser fassen musste. Zwei übliche Schichten konnten zudem mit dem Vorrat der Kohlen gefahren werden. Das bedeutet, dass man rund 16 Stunden
rangierte und dabei die
Kohlen
im
Kohlenfach
gut aufbrauchte. Besonders in der zweiten Schicht bemerkt der
Heizer
wegen den fehlenden Kohlen, dass nun das Ende des Dienstes gekommen war. Ergänzt wurden die ersten drei Lokomotiven mit den Anfangs 1903 abgelieferten Rangierlokomotiven mit den Nummern 8454 und 8455. Es waren die ersten Maschinen dieser Baureihe, die mit einer Nummer der Schweizerischen Bundesbahnen SBB versehen wurden. An dieser Praxis sollte sich nicht mehr so
viel ändern, den nun kamen die Bestellungen der
Staatsbahnen
und die bekamen logischerweise auch deren Nummern verpasst.
Der Unterhalt dieser
Lokomotiven sollte in der
Hauptwerk-stätte
der
SCB,
also in Olten ausgeführt werden. Damit hätten wir die ersten fünf
Lokomotiven, die eigentlich als Vorserie gebaut wurden. Die gewünschten
Anpassungen beschränkten sich auf etwas grössere
Räder. Die Ablieferung der Maschinen, die in Serie gebaut wurden, begann dann im Jahre 1904. Dabei wurden nun die Lokomotiven mit den Betriebsnummern 8456 bis 8463 abgeliefert. Die Pause zu den ersten
Lokomotiven war Grund dafür, dass mit diesen noch Versuche
ausgeführt wurden. Wären diese nicht erfolgreich gewesen, hätte man den
Auftrag noch verbessern können. Jedoch war das hier nicht der Fall und so
waren diese Lokomotiven unverändert. Eine Erprobung dieser
Rangierlokomotiven
wurden auch nicht mehr ausgeführt, sondern sie wurden sofort einem
Kreis
zugeteilt und eingesetzt. Dabei gingen bis auf die Nummer 8463 alle
Maschinen in die Westschweiz und wurden dem Kreis I, also der ehemaligen
JS
zuteilt. Dort sollte der Unterhalt in der
Hauptwerkstätte
Yverdon erfolgen. Die nicht in den Kreis I abgegebene 8463 wurde wieder
dem Kreis II und somit der ehemaligen
SCB
zugeteilt. Noch teilte man die
Lokomotiven bei den Schweizerischen Bundesbahnen SBB nicht
den
Depots
zu, so dass darüber kaum Auskunft gegeben werden kann. Zur Kennzeichnung
wurden an den
Führerhäusern
die entsprechenden Plaketten angebracht. Eine Praxis, die noch viele Jahre
beibehalten werden sollte. Doch was auch sicher war, dass nun die
Auslieferung der Modelle nach dem Baumuster E 3/3 fortgesetzt werden
sollte.
Die anderen
Kreise
hatten bisher das Nachsehen. Dabei muss erwähnt wer-den, dass die
Gotthardbahn
damals noch nicht zu den Schweizerischen Bundesbahnen SBB gehörte und es
da-mit den
Kreis
V gar noch nicht gab. Das zeigte aber deutlich, dass man die ersten Lokomotiven dort stationierte, wo man schon Erfahrungen mit ähn-lichen Maschinen hatte. Schliesslich liefen dort ja die Lokomotiven, die als Muster galten und das galt auch für die ehemalige JS. Das war wichtig, weil man so mit erfahrenem
Personal arbeiten konnte. Die auf dieser Baureihe erforderlichen
Schulungen für das Personal der an-deren
Kreise
konnten so in aller Ruhe vorbereitet werden. Die Zuteilung änderte sich jedoch be-reits
ab 1905 mit den letzten drei in diesem Jahr abgelieferten Maschinen und
den Nummern 8471 bis 8473. Diese Exemplare wurden neu dem
Kreis
III und somit der ehemaligen
NOB
zugeteilt. Somit hatte man nun bereits drei Kreise mit diesen neuen
Rangierlokomotiven
versehen. Die Maschinen im Kreis III sollten in der
Hauptwerkstätte
Zürich unterhalten werden und sie kamen an den grösseren Orten zum
Einsatz. Nachdem im Jahre 1906 keine
Lokomotiven dieser Baureihe an die Schweizerischen
Bundesbahnen SBB abgeliefert wurden, begann im folgenden Jahr die
Lieferung mit weiteren
Rangierlokomotiven
wieder. Dabei wurde mit den ersten 1907 abgelieferten beiden Maschinen die
Lücke im
Kreis
III gefüllt. So wurden erst die Lokomotiven ab der Nummer 8476 an den
Kreis IV abgeliefert. Dort endete die Ablieferung aber im gleichen Jahr
mit der Nummer 8481.
Ein Punkt, der zeigt, wie wenig Unterhalt
von den genügsamen Maschinen erforderlich wurde. Das war leicht, da
während der Auslieferung noch keine grösseren
Revisionen
erforderlich wurden. Jeder der damals vorhandenen Kreise hatte nun seine Lokomotiven der Baureihe E 3/3 bekommen und setzte diese Maschinen hauptsächlich im Rangierdienst der grösseren Bahnhöfe ein. Dabei ersetzten sie ältere Maschinen, die
entweder ausrangiert wurden, oder in anderen
Bahnhöfen
eine neue Verwendung fanden. Es handelte sich dabei oft um kleinere
Modelle mit zwei
Achsen,
die in Anlagen geringer Grösse ausreichten. Letztlich gingen im Jahre 1907 noch die
Lokomotiven mit den Betriebsnummern 8482 bis 8485 an den
Kreis
II. Damit endete die Ablieferung der Baureihe E 3/3 jedoch wieder. Es kam
erneut zu einer Pause, die über ein Jahr dauerte. Es schien fast, als
würden die Schweizerischen Bundesbahnen SBB nur
Rangierlokomotiven
beschaffen, wenn es irgendwo eine Lücke gab. So abwegig war dies nicht,
denn die Arbeit wurde von alten Modellen erledigt. Dabei muss aber erwähnt werden, dass der
Kreis
V, der bisher keine Maschine der Reihe E 3/3 bekommen hatte, zu diesem
Zeitpunkt immer noch nicht bestand. Die
Gotthardbahn
war immer noch eine eigenständige
Bahngesellschaft,
auch wenn die neuesten Maschinen bereits mit den Nummern des späteren
Besitzers ausgeliefert wurden. Es sollte nicht mehr lange dauern und dann
war auch diese Bahn nur noch ein Hinweis in der Geschichte.
Im Kanton Bern fuhren die ersten Triebwagen mit elektrischer Energie. Jedoch setzte nun auch die Auslieferung der Baureihe E 3/3 wieder ein. Wobei man erwarten könnte, dass nun die
Modelle für die Strecke über den Gotthard kommen würden. Jedoch kam es
ganz anders. Die Ablieferung wurde wieder aufgenommen und sollte in den folgenden drei Jahren nicht mehr unterbrochen werden. Die noch 1909 abgelieferten Lokomotiven mit den Nummer 8486 bis 8488 wurden erneut dem Kreis II zugeteilt. Die zwei nachfolgenden
Lokomotiven 8489 und 8490 kamen jedoch in den
Kreis
III. Dort war der Bedarf nach neuen
Rangierlokomotiven
gegeben. Doch das waren nicht alle in diesem Jahr ausge-lieferten
Maschinen. Die
Lokomotiven mit den Nummern 8491 bis 8493 wurden im
Kreis
I stationiert. Die Auslieferung 1909 endete schliesslich mit den Nummern
8494 und 8495. Diese beiden Maschinen wurden in die Ostschweiz verschoben
und kamen im Kreis IV unter. Es gab sie bis auf den Kreis V überall.
Jedoch hatte die
Gotthardbahn
gute Maschinen im
Rangierdienst
im Einsatz. Diese konnten dort noch eingesetzt werden und mussten daher
nicht ersetzt werden. 1910 wurde die Ablieferung der
Lokomotiven fortgesetzt, dabei bekam erneut der
Kreis
II die ersten in diesem Jahr abgelieferten Maschinen. Das waren die
Betriebsnummern 8496 bis 8500. Die SBB hatten nun 50 Lokomotiven dieser
Baureihe erhalten. Die beiden nächsten
Rangierlokomotiven,
also die Nummern 8501 und 8502 kamen dann in den Kreis V und somit an den
Gotthard. Sie wurden dort der
Hauptwerkstätte
Bellinzona zugeteilt.
Dabei wurden die Betriebsnummern 8506 bis 8510 mit den 1911 abgelieferten Lokomotiven Nummern 8511 bis 8513 ergänzt. Somit endete aber in diesem Jahr die Abgabe
von E 3/3 an den
Kreis
II, wo mittlerweile 33
Lokomotiven dieses Typs stationiert wurden. Die Ablieferung 1911 enthielten noch die Nummern 8514 bis 8516, die in den Kreis II kamen. Nun begann man bei der Ablieferung der Lokomotiven die Wirt-schaftskrise zu spüren. Die Preise für die Rohstoffe stiegen markant an und die Vorräte wurden immer knapper. Insbesondere die Metalle waren Mangelware,
denn diese wurden in anderen Bereichen eingesetzt. Man spürte bei dieser
Baureihe, dass der Frieden nicht mehr lange halten sollte. Daher überrascht es eigentlich wenig, dass 1912 keine Lokomotiven dieser Bauart an die Schwei-zerischen Bundesbahnen SBB abgeliefert wurden. Vielmehr überraschten in diesem Jahr die neuen elektrischen Lokomotiven Fb 5/7, die an die BLS abgeliefert wurden. Diese verfügten über eine gigantische
Leistung
und sie waren Zeuge davon, dass die erste
Vollbahn
in der Schweiz mit
Wechselstrom
fuhr. Noch ahnte niemand was für Folgen das haben sollte. Die Ablieferung weiterer E 3/3 erfolgte
erst wieder 1913. Dabei kamen die
Lokomotiven mit den Nummer 8517 und 8518 noch in den
Kreis
III. Die restlichen 1913 abgelieferten Maschinen 8519 bis 8522 kamen dann
in den Kreis V und somit an den Gotthard. Die einzelnen Kreise hatten nun
annähernd den benötigten Bestand an
Rangierlokomotiven
erreicht. Die Krise verhinderte aber, dass auch die letzten Lokomotiven
abgeliefert werden konnten.
Letztlich endete die Ablieferung von
Rangierlokomotiven
E 3/3 im Jahre 1915. Dabei wurde die erste abgelieferte
Lokomotive, also die Nummer 8523, dem
Kreis
V übergeben. Somit hatte man im Kreis V sieben Lokomotiven dieser
Bauart
erhalten, was der geringste Wert aller Kreise sein sollte. Die beiden
folgenden Maschinen 8524 und 8525 beendeten die Ablieferung an den Kreis
I, wo 15 Lokomotiven stationiert wurden. Die
Lokomotiven 8526 und 8527 gingen an den
Kreis
III, wobei man dort noch nicht die letzten Maschinen bekommen hatte. Auch
der Kreis IV konnte noch einmal mit den Nummern 8528 bis 8530 drei
Lokomotiven dieser Bauart in Empfang nehmen. wobei hier nun mit 11
Lokomotiven die maximale Anzahl E 3/3 erreicht wurde. So blieben nur noch
die letzten drei Lokomotiven übrig. Diese wurden mit den Nummern 8531 bis
8533 an den Kreis III abgeliefert. Damit erreichte man beim
Kreis
III einen Bestand von 17
Lokomotiven. Für die Schweizerischen Bundesbahnen SBB
bedeutete das, dass nun alle 83 Maschinen der Reihe E 3/3 angeliefert
waren. Somit endete die Abgabe von neuen Modellen nach diesem Baumuster im
Jahre 1915. Nach einer Zeit von zwölf Jahren sollte der Bestand gedeckt
sein. Ob es später noch zu weiteren Anschaffungen kommen sollte war nicht
mehr sicher.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2022 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
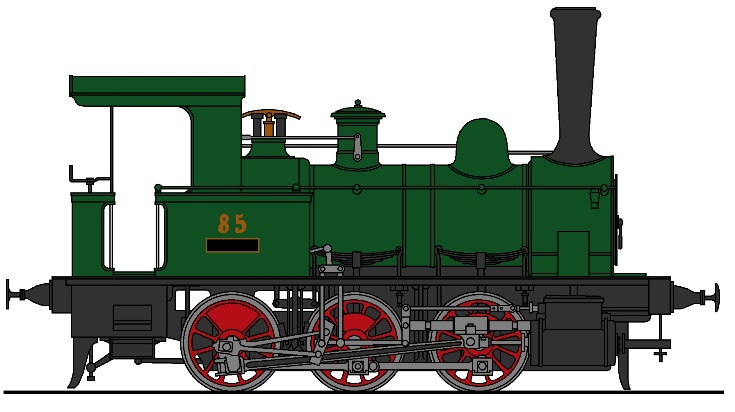 Die
Die
 Solche
Leistungsdaten waren bei Dampflokomotiven noch wichtig, da nicht jede die
exakt gleiche
Solche
Leistungsdaten waren bei Dampflokomotiven noch wichtig, da nicht jede die
exakt gleiche
 Ein
weiterer Wert war der Verbrauch beim Wasser. Hier war klar, dass dieser
auch während dem Betrieb aufgefüllt werden musste. Jedoch war es auch
wichtig, dass man wusste, wie oft eine solche Pause eingelegt werden
musste.
Ein
weiterer Wert war der Verbrauch beim Wasser. Hier war klar, dass dieser
auch während dem Betrieb aufgefüllt werden musste. Jedoch war es auch
wichtig, dass man wusste, wie oft eine solche Pause eingelegt werden
musste.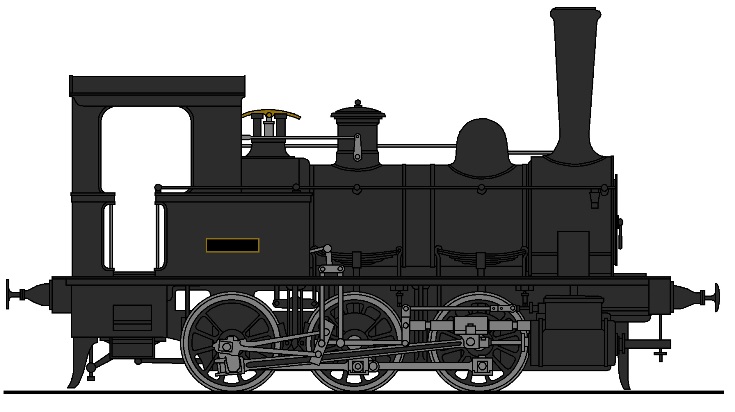 Die
beiden Maschinen kamen ebenfalls in den
Die
beiden Maschinen kamen ebenfalls in den
 Im
Im
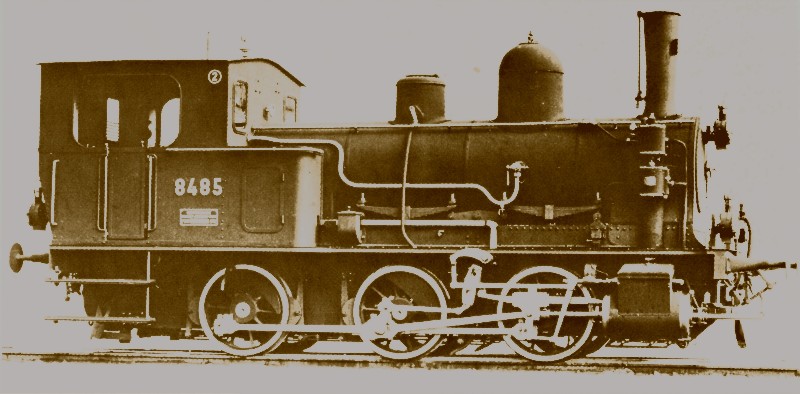 Der
Unterhalt der
Der
Unterhalt der
 1909
änderte sich bei den Bahnen einiges. Die Schweizerischen Bundesbahnen SBB
wurden mit der
1909
änderte sich bei den Bahnen einiges. Die Schweizerischen Bundesbahnen SBB
wurden mit der
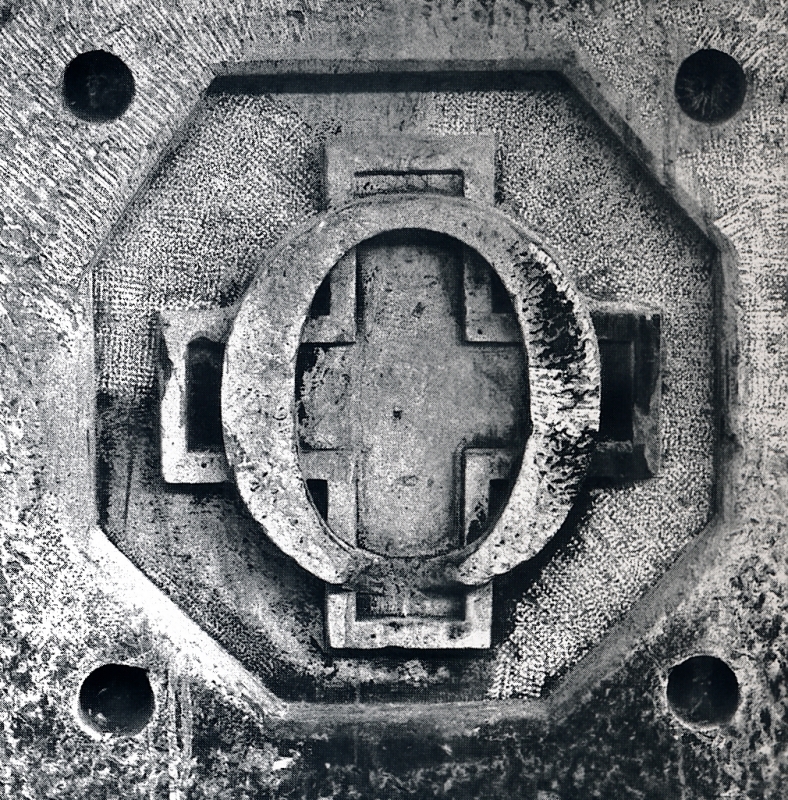 Die
Nummern 8503 bis 8505 fanden 1910 ihre Heimat in der Westschweiz und
wurden dem
Die
Nummern 8503 bis 8505 fanden 1910 ihre Heimat in der Westschweiz und
wurden dem
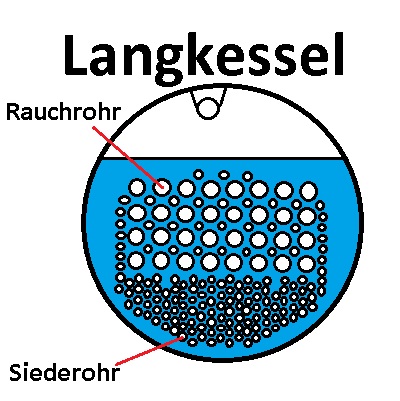 Der
Der