|
Druckluft und Bremsen |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Auch
Rangierlokomotiven
kamen längst nicht mehr ohne
Druckluft aus. Schwere Lasten mussten mit den pneumatischen
Bremsen
der Wagen abgebremst werden. Bei der Reihe Eea 3/3 kam noch hinzu, dass
sie auch auf der Strecke eingesetzt werden sollte. Aus diesem Grund waren
die Herstellung und Aufbereitung der Druckluft auch bei diesen Maschinen
von ausserordentlich wichtiger Bedeutung. Es lohnt sich daher, wenn wir
etwas genauer hinsehen.
Zur
Erzeugung der
Druckluft wurde im hinteren
Vorbau
ein
Kompressor
eingebaut. Dort fanden auch die anderen nicht an einen festen Einbauort
gebundenen Komponenten den Platz. Dabei wurde die zur Erzeugung der
Druckluft benötigte Luft über die seitlichen
Düsenlüftungsgitter
in den Vorbau gezogen. Im dort vorhandenen Leerraum konnte sich die Luft
wieder beruhigen, was die Herstellung der Druckluft vereinfachte.
Sein
maximaler Enddruck lag bei einem Wert von zehn
bar.
Auch von der Schöpfleistung war er für den Einsatz dieser
Lokomotiv-en
sehr gut geeignet. Die Luft wurde aus dem Innenraum über einen feinen Luftfilter in den Verdichter geleitet. Durch die Rotation einer sich veren-genden Schnecke wurde schliesslich die Luft komprimiert.
Der
so erzeugte
Luftdruck
verflüchtigte sich jedoch unmittelbar nach dem
Kompressor
wieder. Der Grund lag bei den in der Regel tieferen Werten in den
Leitungen. Das hatte jedoch zur Folge, dass in der Luft enthaltene
Feuchtigkeit ausgeschieden wurde. Die vom Kompressor geschöpfte Druckluft wurde daher in einem unmittelbar am Kompressor angebauten Lufttrockner aufbe-reitet.
In
einer geschlossenen Kammer wurde die ausgeschiedene Feuchtigkeit aus der
Luft entfernt und in einem Behälter gesammelt. Da es sich hier um eine
Emulsion handelte, durfte die Flüssigkeit nicht einfach in die Umwelt
entlassen werden. Daher musste der Behälter regelmässig geleert werden.
Es
gab bei den ersten
Lokomotiven
mit dieser
Lufttrocknung
jedoch ein Problem. Die so von der Feuchtigkeit befreite Luft musste diese
jedoch wegen den physikalischen Gesetzen wieder aufnehmen. Das erfolgte
bei den Dichtungen, die dadurch spröde wurden. Um das zu verhindern, wurde
die
Druckluft mit einem
Luftöler
wieder mit der notwendigen Feuchtigkeit versehen. Da diese nun aber nicht
auf Wasser basierte, konnte sie nicht gefrieren.
Das reichte gerade im Rangierdienst und vor kurzen Zügen aus, damit der Kompressor nicht dauernd arbeiten musste.
So
lange nun aber an den angeschlos-senen Leitungen keine Luft entnom-men
wurde, stieg der Wert immer höher. Daher war ein
Überdruckventil
vorhanden, das den maximalen Druck auf rund elf
bar
beschränkte. Die effektiv drei Luftbehälter konnten mit speziellen Hauptluftbehälterhahnen vom restlichen Leitungssystem abge-grenzt werden.
So
war es möglich, den Luftvorrat auch für eine längere Zeit zu speichern.
Das war wichtig, weil die
Lokomotive
ohne
Druckluft nicht in Betrieb genommen werden konnte.
Ohne diesen Schritt konnte jedoch auch keine Druckluft erzeugt werden.
Daher musste eine alternative Lösung gefunden werden.
Um
den zur Erzeugung von
Druckluft erforderlichen minimalen
Luftdruck
zu erreichen, war jedoch keine
Handluftpumpe
verbaut worden. An deren Stelle wurde ein
Hilfsluftkompressor
eingebaut. Dieser konnte mit der
Spannung
aus den
Batterien
einen Luftvorrat erzeugen, der so gross war, dass die
Lokomotive
eingeschaltet werden konnte. Sobald dies der Fall war, übernahm der
normale
Kompressor
die Arbeit.
An
den
Hauptluftbehältern
war schliesslich das System angeschlossen worden. Dazu wurde eine zentrale
Leitung durch das Fahrzeug geführt. Diese stand bei der Reihe Eea 3/3
sogar an den beiden
Stossbalken
in Form der
Speiseleitung
zur Verfügung. Dazu waren weiss eingefärbte
Absperrhähne
und
Luftschläuche
mit entsprechen gefärbten
Kupplungen
vorhanden. Daher war es auch möglich, den Vorrat bei der
Druckluft über diese Leitung zu ergänzen.
So
konnte das Gewicht der Leitungen reduziert werden, was zwar ein Vorteil
war, hier jedoch nicht so sehr zum Tragen konnten sollte. Trotzdem sollten
wir uns das Gewicht für den mechanischen Teil ansehen.
Die
mechanischen Bauteile hatten bei den
Lokomotiven
ein Gewicht von 35.5 Tonnen erhalten. Das war sowohl bei der Baureihe Ee
3/3, als auch bei der Reihe Eea 3/3 der Fall. Wobei es, wenn wir wirklich
genau sein wollen, im Bereich der Kommastelle leichte Unterschiede gab.
Diese können wir jedoch vernachlässigen und uns nun den
Druckluftbremsen
zuwenden, denn diese waren mit Abstand der grösste Verbraucher von
Druckluft.
Es
wurden auf diesen
Lokomotiven
nicht weniger als drei pneumatische
Bremsen
verbaut. Diese bezogen die erforderliche
Druckluft jedoch über unterschiedliche Wege aus der
Speiseleitung.
Dabei wirkte das sehr einfach aufgebaute
Bremssystem
so schwach, dass damit kaum eine
Bremsung
erreicht werden konnte. Trotzdem müssen wir uns diese Bremse etwas genauer
ansehen, denn sie war ein Bestandteil der
Druckluftbremsen.
Sehr einfach
aufgebaut war die
Schleuderbremse. Sie war entweder gelöst, oder sie wurde
mit einem
Luftdruck von 0.8
bar angezogen. Dadurch konnte eine leer
drehende
Achse jedoch abgefangen werden. Dabei gab es einen Unterschied
zwischen dem Personal und der Steuerung. Letztere konnte jede Achse
einzeln abbremsen. Dem
Lokomotivpersonal war es jedoch nur möglich alle drei
Triebachsen mit dieser
Bremse
zu beeinflussen.
Dieses unterschied sich von der Schleuderbremse soweit, dass hier ein grösserer maximaler Luftdruck mög-lich war und dass dieser durch das Personal leicht verändert werden konnte.
Daher handelte es sich auch hier um eine direkt
wirkende
Bremse. Sie wur-de, wie bei den anderen Baureihen, als
Rangierbremse bezeichnet und sie war wichtig. Die Rangierbremse wirkte im Brems-zylinder mit einem maximalen Druck von 2.8 bar.
Damit konnte sowohl die
Lokomotive, als auch die ungebremste
Anhängelast ausreichend abgebremst werden. Daher kam sie, wie es der Name
schon vermuten lässt, im
Rangierdienst zur Anwendung. Eine Möglichkeit
diese
Bremse auch auf den Wagen wirken zu lassen, war jedoch nicht
vorhanden. Daher musste dazu das dritte System vorgesehen werden.
Bei den
ersten vier gebauten und an die Post gelieferten Maschinen kam lediglich
eine Anhängerbremse zum Einbau. Bei dieser Ansteuerung der
Bremse wurde
die
Hauptleitung der
automatischen Bremse mit Hilfe eines Druckübersetzers
durch die
Rangierbremse angesteuert. Das war eine Lösung, wie sie bisher
lediglich bei kleineren
Traktoren verwendet wurde. Mit dieser Lösung
konnte die Hauptleitung jedoch nicht komplett entleert werden.
Da bei den
älteren Maschinen der Baureihe Ee 3/3 die
Bremse lediglich durch die
Rangierbremse gesteuert wurde, stand nur ein
Bremsgewicht von 48 Tonnen
zur Verfügung. Da bei der geschleppten
Lokomotive die Bremse auch wirken
musste, war das bei der normalen
automatischen Bremse erforderliche
Steuerventil vorhanden. Dieses wirkte in dem Fall mit der
P-Bremse. Daher
konnte deren Bremsgewicht für die
Bremsrechnung angerechnet werden.
Wie bei der Anhängerbremse wurde hier die Hauptleitung mit einem Druck von fünf bar betrieben. Der Unterschied lag dabei nur in der Tatsache, dass dazu bei diesen Loko-motiven ein Führerbremsventil benutzt wurde.
Diese
Druckluftbremse war damit un-abhängig von der
Rangierbremse wirk-sam.
Die
Hauptleitung wurde zu den beiden
Stossbalken geführt und stand dort in
jeweils zwei
Luftschäuchen mit rotem
Absperrhahn und identisch gefärbten
Kupplungen der
Anhängelast zur Verfügung. Eine
Bremsung erfolgte mit
dieser
automatischen Bremse, wenn der
Luftdruck in der Hauptleitung auf
unter 4.6
bar gesenkt wurde. Damit auf der
Lokomotive damit jedoch eine
Bremsung erzeugt werden konnte, musste ein
Steuerventil verbaut werden.
Dieses
Steuerventil für die
automatische Bremse war vom Typ ESH 140-005 und es
war mehrlösig ausgeführt worden. Mit diesem
Ventil konnte sowohl die
normale
Personenzugsbremse, als auch die Bremskraftverstärkung in Form der
R-Bremse
erzeugt werden. Eine Möglichkeit, die automatische Bremse auf die
langsamere
Güterzugsbremse umzustellen war jedoch nicht vorhanden. Das war
kein Problem, da nur die Eea 3/3 für Züge ausgelegt wurde.
Sämtliche
pneumatischen
Bremsen wirkten auf die an allen
Achsen vorhandenen
Bremszylinder. Diese wurde durch die Kraft der
Druckluft ausgestossen und
sie bewegten so das
Bremsgestänge. Dabei erzeugten die verbauten
Bremszylinder mit der
P-Bremse ein
Bremsgewicht von 48 Tonnen. Mit der
R-Bremse konnte dieses Gewicht jedoch auf 60 Tonnen gesteigert werden.
Damit hatte die
Lokomotive gute
Bremskräfte erhalten.
Somit konnte
mit dieser
Feststellbremse
die
Lokomotive nicht überall sicher abgestellt
werden. Damit das trotz-dem möglich war, wurden auf der Maschine zusätzlich
noch zwei
Hemmschuhe mitgeführt.
Am Bremsgestänge war schliesslich die mechanische Bremseinrichtung angeschlossen worden. Dabei war für jede Achse ein eigenes Bremsgestänge verbaut worden. Da hier eine normale Klotzbremse verbaut worden war, musste das Gestänge an die Abnützung angepasst wer-den.
Daher war in den
Bremsgestängen ein
automatisch wirkender
Bremsgestängesteller vorhanden. So war ge-sichert,
dass immer eine gleichbleibende
Bremskraft erzeugt wurde.
Diese
Klotzbremse
wirkte mit der Kraft der
Druckluft im
Bremszylinder
auf die
Bremsklötze
und presste diese gegen die
Laufflächen. Damit wurde das
Rad an der freien Drehung gehindert. Wie bei
den anderen damals ausgelieferten Modellen kamen jedoch keine direkt am
Gestänge montierte Bremsklötze zur Anwendung. Es wurden auch hier
Sohlenhalter und daher mehrerer
Bremssohlen pro Rad verendet. Bei den in
Sohlenhaltern gehaltenen Bremssohlen gab es jedoch einen Unterschied.
So wurden
bei allen Maschinen mit Ausnahme jener für die Gürbetalbahn Sohlen aus
Kunststoff verwendet. Diese hatten sich im
Rangierdienst seit Jahren
bewährt und wurden daher auch hier benutzt. Da die Baureihe Eea 3/3 jedoch
vermehrt auf der Strecke mit höherer Geschwindigkeit eingesetzt werden
sollte, wurden bei diesem Modell
Bremssohlen aus Grauguss verwendet. Das
hatte zur Folge, dass der maximale Druck der
Rangierbremse erhöht werden
musste.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2022 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Um
die normale Luft zu verdichten, musste diese in eine ge-schlossene Leitung
geschöpft werden. Dafür war der
Um
die normale Luft zu verdichten, musste diese in eine ge-schlossene Leitung
geschöpft werden. Dafür war der
 An
den
An
den 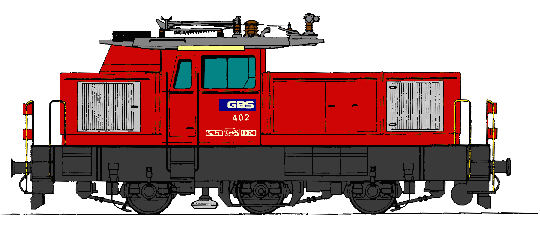 Alle
Verbraucher waren an dieser
Alle
Verbraucher waren an dieser
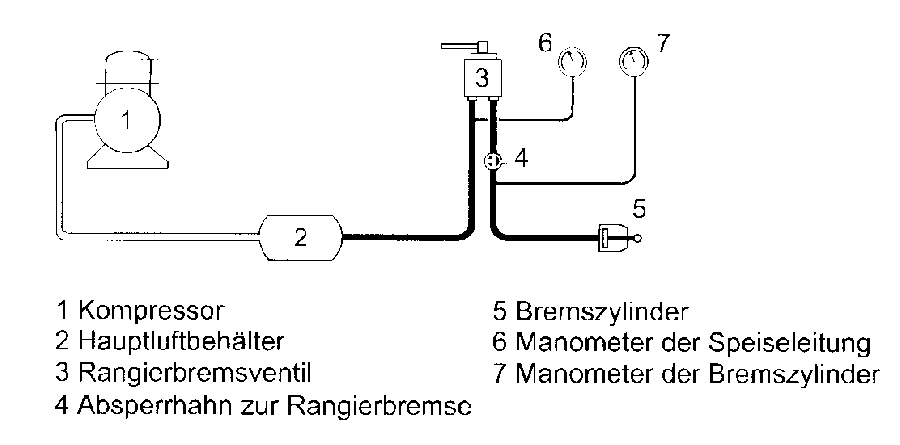 Damit können
wir jedoch bereits zum zweiten
Damit können
wir jedoch bereits zum zweiten 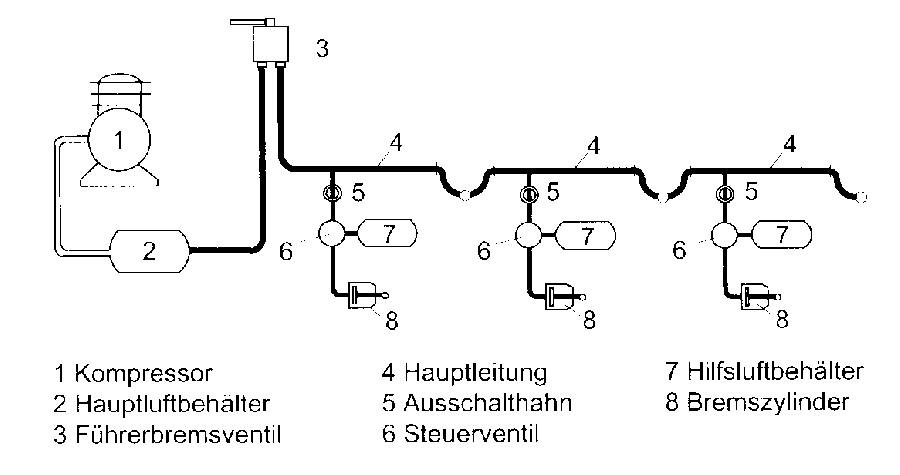 Beim
dritten
Beim
dritten  Ebenfalls
auf das
Ebenfalls
auf das