|
Hauptstromkreis |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Im Bereich
des Hauptstromkreises gab es zwischen den einzelnen Maschinen grosse
Unterschiede. Beginnen wir jedoch bei einem gemeinsamen Punkt. Alle
Lokomotiven wurden für einen Betrieb mit
Wechselstrom von 15 000
Volt und
16 2/3
Hertz
ausgelegt. Mit Ausnahme der Eea 3/3 erfolgte die
Stromversorgung über die in der Schweiz übliche
Bügelfahrleitung. Dazu
musste auf dem Dach des
Führerhauses ein
Stromabnehmer installiert werden.
Der Bügel war so ausgerichtet worden,
dass sich das Knie gegen den vorderen
Vorbau befand. Um diesen zu heben,
musste mit Hilfe von
Druckluft die Kraft der
Senkfeder aufgehoben werden.
Der Bügel wurde daher durch die Kraft der
Hubfeder gehoben. Speziell bei diesem Einholmstromabnehmer war, dass er sich nicht vollständig durchstrecken konnte. Eine Höhenbegrenzung verhinderte dies, so dass der Bügel auch wieder gesenkt werden konnte, wenn er versehentlich nicht unter dem Fahrdraht gehoben wurde.
Eine Gefahr, die insbesondere bei der
Baureihe Eea 3/3 in
Anschlussgleisen
ohne
Fahrleitung bestand. Bei den anderen Modellen der Reihe Ee 3/3 war so
lediglich ein zusätzlicher Schutz vorhanden. Auf dem Bügel wurde schliesslich die Wippe mit den beiden Schleifleisten montiert. Hier wurden Leisten mit Einlagen aus Kohle verwendet. Dank den beiden isolierten Notlaufhörnern konnte das Schleifstück auf eine Breite von 1 450 mm ausgelegt werden.
Diese
Notlaufhörner sorgten auch dafür, dass es im
gesenkten Zustand nicht zu Überschlägen auf das Dach kommen konnte. Eine
Gefahr, die jedoch nur bei einer defekten
Fahrleitung bestand.
Die mit
Hilfe des
Stromabnehmers auf das Dach übertragene
Fahrleitungsspannung
wurde einer kurzen
Dachleitung
zugeführt. An dieser auf
Isolatoren
stehenden Dachleitung war der
Spannungswandler zur Erfassung der
Spannung
in der
Fahrleitung angeschlossen worden. So konnte deren Wert bereits
kontrolliert werden, bevor die
Lokomotive eingeschaltet wurde. Wobei das
jedoch nicht für alle Maschinen gelten sollte.
Das führte zu einem kleinen
Lichtbogen zwischen dem
Schleifstück und dem
Fahrdraht.
Schlimmer war jedoch der beim senken des Bügels entstehende
Abreissfunke. Die
Leistung war jedoch für Schäden zu
gering. Die Sicherung löste jedoch nur aus, wenn der Strom zu hoch wurde. Dabei wurde ein Draht geschmolzen. Der nun entstehende Lichtbogen mit hoher Leistung wurde anschliessen in den Funkenhörnern schadlos gelöst.
Eine ausgelöste
Sicherung konnte jedoch nur in einer Werkstatt repariert werden. Das
beutete, dass die
Lokomotive in dem Fall defekt abgestellt werden musste.
Ein Umstand, der bei
Rangierlokomotiven nicht so schlimm, wie bei Zügen,
war. Mit der zweiten Lieferung, wurde jedoch wieder auf diese Sicherung ver-zichtet, daher wurde bei diesen Modellen an der Dachleitung ein Haupt-schalter mit einem integrierten Erdungsschalter angeschlossen.
Die Lösung mit einem
Hauptschalter
war jedoch nicht nur wegen der Eea 3/3 gewählt worden. So
war die Verfügbarkeit grösser, da der Schalter nach einem momentanen
Kurzschluss im Gegensatz zur
Sicherung wieder eingeschaltet werden konnte.
An der
Stelle der damals in grosser Stückzahl verbauten
Drucklufthauptschaltern
kam hier ein anderes Modell zur Anwendung. Es wurde ein neu entwickelter
Hauptschalter verwendet, der mit einem Vakuum verhinderte, dass der
Lichtbogen entstehen konnte. Dadurch wurde für den Hauptschalter deutlich
weniger
Druckluft benötigt, so dass er auch bei geringem Vorrat
eingeschaltet werden konnte. Ein Vorteil, da die Einschaltung von Hand
nicht möglich war.
Durch den
Einsatz waren die
Lokomotiven oft in dicht besiedeltem Gebiet unterwegs,
so dass sich die An-wohner eines
Anschlussgleises durch den Lärm beim Schalten schnell gestört
fühlen konnten. Zudem war auch der Verschleiss geringer. Nach dem Hauptschalter, beziehungsweise der Dach-sicherung, wurde die Spannung aus der Fahrleitung dem Transformator zugeführt. Durch sein hohes Ge-wicht, musste er in der Mitte der Lokomotive mon-tiert werden.
Das war daher der
Grund, dass das
Führerhaus ver-schoben werden musste. Nur so konnten die
gefor-derten maximalen
Achslasten von 16 Tonnen einge-halten werden. Die
Lokomotive konnte so auch bei schwachem
Oberbau eingesetzt werden. Über die Primärwicklung wurde der Transformator schliesslich mit der Erdung und dem mechanischen Aufbau verbunden.
Dazu wurden an den drei
Achsen die üblichen
Erdungsbürsten vorgesehen. Es entstand so ein geschlossener
Stromkreis und
es konnte
Leistung auf das Fahrzeug übertragen werden. Diese Leistung
wurde mit einem Magnetfeld auf die zweite
Wicklung im
Transformator
übertragen. Damit war der Teil für die
Fahrmotoren von der Erde getrennt
worden.
Jedoch war der nun folgende
Fahrmotorstromkreis galvanisch von der Hoch-spannung getrennt worden. Eine
defekte
Isolation stellte nicht gleich das ganze Fahrzeug unter die
gefährliche
Spannung. An der Sekundärwicklung wurde schliesslich der Stromrichter angeschlossen. Dieser war bei der Lieferung der ersten Maschinen 1985 noch neu und entsprach der damals aktuellen Technik.
Bei der zweiten Lieferung 1992, waren jedoch
bereits die ersten Modelle mit
Umrichter im Einsatz. Jedoch war die hier
verbaute Technik nicht schlecht und eine Lösung mit
Drehstrommotoren hätte
nur unnötig die Kosten in die Höhe getrieben. Im Stromrichter waren zwei halbgesteuerte Brücken mit Thyristoren verbaut worden. Diese erzeugten aus dem Wechselstrom vom Transformator einen in der Spannung veränderlichen Wellenstrom. Dieser Strom konnte schliesslich den Fahrmotoren zugeführt werden.
Bei der
Baureihe Eea 3/3 ermöglichte diese Lösung schliesslich auch den Betrieb ab
Akkumulatoren. Dazu kommen wir jedoch später, da dieses Modell beim
Betrieb unter
Wechselstrom gleich war, wie die anderen Maschinen.
Die
veränderliche
Spannung für die
Fahrmotoren wurde anschliessend nur noch
den
Wendeschaltern zugeführt. Diese stellten letztlich die notwendigen
Schaltung-en für den Betrieb unter
Wechselstrom und für die
elektrische
Bremse her. Bei der Baureihe Eea 3/3 wurden zusätzlich auch die
Schaltungen für den Betrieb ab den
Batterien ermöglicht. Das führte dazu,
dass der Wendeschalter bei dieser
Lokomotive etwas schwerer wurde.
Bei den
Fahrmotoren kamen
Seriemotoren der Firma BBC, beziehungsweise bei der
zweiten Serie ABB, zum Einbau. Diese waren für den Betrieb mit
Wellenstrom
ideal geeignet, konnten jedoch auch mit einem reinen
Gleichstrom betrieben
werden. Während dem Betrieb unter der
Spannung der
Fahrleitung wurden die
drei Motoren parallel angeschlossen. Nur in dieser Betriebsform konnte von
der
Lokomotive die volle
Leistung der Fahrmotoren abgerufen werden.
Betrachten wir
daher die
Leistungsgrenze zuerst bei den Modellen der Baureihe Ee 3/3, die
eine
Höchstge-schwindigkeit von 60 km/h aufwiesen. Die Reihe Ee 3/3 erreichte die Leistungsgrenze bei einer Geschwindigkeit von 26.3 km/h. Dabei konnte noch eine Stundenzugkraft von 76 kN abgeben werden. Die nun massgebende Leistung wurde mit 636 kW angegeben.
Werte, die klar zeigen,
dass die
Lokomotiven für den
Ran-gierdienst bis 30 km/h ausgelegt wurden.
Bei maximaler Geschwindigkeit stand bei diesen Maschinen jedoch noch eine
Zugkraft von 12 kN zur Verfügung. Weil das Betriebskonzept bei der Baureihe Eea 3/3 anders ausgelegt wurde, erhöhte man hier die Geschwindigkeit auf 75 km/h.
Das wirkte sich auf die
Leistungsgrenze aus und sie zeigte, wie gross ursprünglich die geplanten
Reserven bei den drei
Fahrmotoren bemessen wurden. Bei unveränderter
Zugkraft von 76 kN wurde bei der Reihe Eea 3/3 die Leistungsgrenze bei 35
km/h erreicht. Auch bei der verfügbaren Zugkraft bei maximaler
Geschwindigkeit gab es keine Änderung.
Alle
Lokomotiven wurden mit einer
elektrischen
Bremse ausgerüstet. Da wegen dem
einfach aufgebauten
Stromrichter keine
Nutzstrombremse möglich war, wurde
eine
Widerstandsbremse verwendet. Diese wurde so optimiert, dass sie im
Rangierbetrieb angewendet werden konnte. Gerade der bei solchen
Bremsen
übliche Ausfall der elektrischen Bremse bei tiefen Geschwindigkeiten,
musste zwingend verhindert werden, da meistens in diesem Bereich gefahren
wurde.
Die einfachen
Dioden
wurden durch den entgegen-gesetzt fliessenden Strom im Anker geöffnet. Sank
dieser
Strom jedoch wegen der geringeren Drehzahl, wurden die Dioden
gesperrt. Die
Spannung wurde nun vom
Stromrichter gestützt. Dadurch konnte der Strom im Anker stabilisiert wer-den, wodurch wiederum die Bremskraft erhalten blieb. Diese konnte stufenlos reguliert werden und erreichte maximal eine Bremskraft von 50 kN.
Damit konnte gerade im
Rangierbetrieb ein grosser Teil der Verzögerung ohne die
Bremsklötze
vorge-nommen werden. Bei der Reihe Eea 3/3 wurde zudem mit dieser
elektrischen
Bremse eine wichtige Forderung der BLS-Gruppe erfüllt.
Wir haben
somit den Hauptstromkreis bei den
Lokomotiven Ee 3/3 abgeschlossen. Da die
Maschine für die Gürbetalbahn jedoch noch eine zweite Möglichkeit hatte,
die
Fahrmotoren zu versorgen, müssen wir uns diesen Teil
der
Zweisystemlokomotive noch ansehen.
Dabei lässt es das a in der Bezeichnung bereits erahnen, es wurde eine
Lösung mit
Akkumulatoren und nicht mit einem
Dieselmotor
gewählt.
Letzterer wäre in den
Anschlussgleisen zu laut gewesen.
Natürlich
spielten auch die Gedanken für den Umweltschutz mit. Wichtiger war jedoch
die Gefahr der
Abgase, wenn in geschlossenen Hallen gefahren werden
musste. Zudem sollte mit der Baureihe Eea 3/3 auch die Möglichkeit der
Anwendung aufgezeigt werden. Der Grund war klar, so wie Sie von der
Bezeichnung überrascht waren, so selten waren bisher mit
Akkumulatoren
betrieben Modelle. Es kann jedoch gesagt, es sollte noch viele Jahre
dauern, bis der Erfolg kam.
Damit wog der elektrische Teil bei der Baureihe Eea 3/3 mit den
später noch vorgestellten Komponenten 14.5 Tonnen. Die
Lokomotive war
daher 50 Tonnen schwer. Bei der Reihe Ee 3/3 wurden 48 Tonnen angegeben. Geladen wurden die Batterien während dem Betrieb unter Wechselstrom. Genauere Informationen dazu erhalten wir bei der Vorstellung der Hilfsbetriebe.
Hier ist es nur wichtig, dass wir wissen, dass eigentlich der
Antrieb mit
den
Akkumulatoren nur möglich war, wenn sich das Fahrzeug zuvor eine
bestimmte Zeit unter einer
Fahrleitung befand. Im Betrieb mit der Eea 3/3
konnte das nahezu garantiert werden, denn man fuhr oft auf der Strecke.
Wurde im
Batteriebetrieb gefahren, waren die drei
Fahrmotoren in Reihe geschaltet
worden. Dazu wurde die Erreger-Stützbremsschaltung der
elektrischen
Bremse
genutzt. Da nun aber der eingebaute
Bremswiderstand als
Anfahrwiderstand
benötigt wurde, konnte die elektrische Bremse bei der Fahrt mit
Akkumulatoren nicht genutzt werden. Das war jedoch kein Problem, da in
diesem Fall die
Bremskraft einfach durch die pneumatischen
Bremsen
erbracht wurde.
Die
Geschwindigkeit wurde mittels
Schützen in fünf
Fahrstufen geregelt. Dabei
lag an den
Fahrmotoren eine maximale
Spannung von 160
Volt an. Das führte
dazu, dass nur noch mit 10 km/h gefahren werden konnte. Jedoch konnte die
normale
Zugkraft abgerufen werden. Die Einbusse der Geschwindigkeit zu
Gunsten der Zugkraft konnte problemlos in Kauf genommen werden, da in der
Schweiz in
Anschlussgleisen generell nicht schneller gefahren wurde.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2022 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Es kam ein
damals auf vielen
Es kam ein
damals auf vielen
 Bei den an
die Post gelieferten Modellen mit den Nummern 8 bis 11 kam an die
Bei den an
die Post gelieferten Modellen mit den Nummern 8 bis 11 kam an die
 Ein weiterer
Vorteil dieses
Ein weiterer
Vorteil dieses 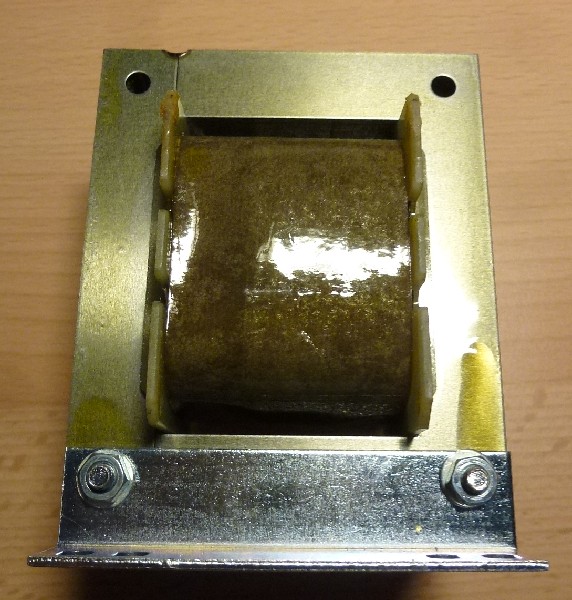
 Mit den
Mit den
 Es kam eine
kombinierte Erreger-Stützbremsschalt-ung zur Anwendung. Dabei speiste der
Es kam eine
kombinierte Erreger-Stützbremsschalt-ung zur Anwendung. Dabei speiste der
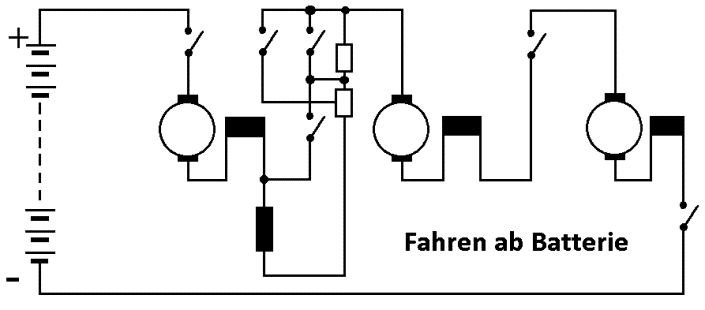 Die
Die