|
Neben- und Hilfsbetriebe |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Obwohl es in der Schweiz üblich war, dass die elektrischen
Rangierlokomotiven
mit einer
Zugsammelschiene
versehen wurden, fehlte diese bei der Baureihe Ee 3/3. Die Post war der
eigentliche Entwickler dieser Maschinen für den
Rangierdienst
und dort wurde diese Einrichtung schlicht nicht benötigt. Die meisten
Postwagen
besassen zwar die
Heizleitung,
jedoch auch nur diese. Postwagen wurden nur beheizt, wenn Personal damit
verkehrte.
Die
Soldaten reisten in
Personenwagen
und diese mussten natürlich von der
Lokomotive
geheizt wer-den können. Das war auch erforderlich, wenn wenig später die
Streckenlokomotive den Transport über-nahm. Man nannte diesen Einsatz auch
vorheizen. Die Zugsammelschiene musste zu den anderen Fahr-zeugen kompatibel sein. Daher wurde auch hier die benötigte Spannung von 1000 Volt Wechselstrom direkt dem Transformator entnommen.
Dazu
war in der
Primärwicklung
eine
Anzapfung
mit dem entsprechenden Wert vorgesehen. Eine galva-nische Trennung durfte
jedoch nicht erfolgen, da die Rückleitung von den
Personenwagen
über das
Ge-leise
erfolgte und diese geerdet wurden. Mit Hilfe eines Heizhüpfers konnte die Zugsammel-schiene ein- oder ausgeschaltet werden. Eine Über-wachung kontrollierte dabei den Strom, der durch die Leitung floss. Dieser durfte bei stillstehender Lokomotive deutlich höher sein, als während der Fahrt.
Das
war wegen der geringen
Leistung
erforderlich und die hohen
Ströme
flossen hier auch nur, wenn ausgekühlte Wagen vorgeheizt werden mussten.
In dem Fall stand die
Lokomotive
jedoch still.
Da
die Energie der
Heizleitung
auf der
Lokomotive
nicht benötigt wurde, konnte man sich auf die Leitungen und die unter dem
rechten
Puffer
montierten Steckdosen beschränken. Es waren übliche Steckdosen verwendet
worden, die verhinderten, dass ein eingestecktes Kabel aus der Dose fallen
konnte. Wäre das geschehen, hätte der
Lichtbogen
grosse Schäden anrichten können. Daher gab es hier zu anderen Baureihen
keine Abweichung.
Daher fiel die Quelle aus und in der Leitung konnte kein
Strom
fliessen. Jedoch hätte die
Zugsheizung
in dem Fall, die
Batterien
auch zu stark belastet, das war jedoch nicht gewünscht.
Die
Akkumulatoren
für die Traktion hatten eine
Kapazität
von 468 Ah. Diese reichte aus, um in
Anschlussgeleisen
ein paar Wagen abzuholen, aber nicht um noch weitere Funktionen, wie die
Heizung
der
Personenwagen
zu versorgen. Daher war keine Lösung vorhanden, um die
Zugsammelschiene,
oder die anschliessend vorgestellten
Hilfsbetriebe
mit Energie zu versorgen. Daher gab es zur Reihe Ee 3/3 beim Aufbau kaum
weitere Anpassungen.
Auch
nicht möglich war es, die
Akkumulatoren
über die
Zugsammelschiene
zu laden. Dies erfolgte über ein
Batterieladegerät,
das jedoch nicht an den
Nebenbetrieben,
sondern an den
Hilfsbetrieben
angeschlossen wurde. Ein Bereich, den es auch auf den anderen hier
vorgestellten Baureihen gab. Jedoch fehlte dort das Ladegerät für die
Akkumulatoren des Fahrbetriebes. Es lohnt sich daher, wenn wir auch die
verbauten Hilfsbetriebe genauer ansehen.
Versorgt wurden die
Hilfsbetriebe
ab einer eigenen
Spule.
Da es seinerzeit bei der Post auch darum ging, dass möglichst viele
Ersatzteile mit den anderen Baureihen genutzt werden konnten, war
eigentlich klar, wie die Hilfsbetriebe versorgt wurden. In der
Wicklung
im
Transformator
wurde daher eine
Spannung
von 220
Volt
erzeugt und diese stand den Verbrauchern zur Verfügung. Der
Strom
wurde mit einer einfachen
Sicherung
überwacht.
Wurde der
Depotstrom
angeschlossen, konnte das
Batterieladegerät
der Traktion betrieben werden. Daher war es ohne grossen Aufwand möglich,
die hier eingebauten
Akkumulatoren
vor dem Einsatz der
Lokomotive
ausreichend zu laden. Damit konnte mit der Lokomotive auch direkt mit dem
Batteriebetrieb losgefahren werden. Diese Betriebs-form der Reihe Eea 3/3
wird in den folgenden Abschnitten noch ein paar Mal erwähnt werden.
Auch
hier wurden an den
Hilfsbetrieben
viele kleinere Baugruppen angeschlossen. Dazu gehörten Steckdosen und die
im
Führerstand
verbauten
Heizungen.
Bei diesen Heizungen war neben den
Widerständen
für den Raum und das
Pedal
noch die in den
Frontfenstern
eingebaute
Scheibenheizung
vorhanden. Diese wurde benötigt, um eine klare Sicht zu erhalten. Zudem
konnte das Glas seine Festigkeit nur bei einer bestimmten Temperatur
erbringen.
Ein
weiterer kleiner Verbraucher war die Anzeige der
Spannung
in der
Fahrleitung.
Diese wurde, wie bei den damaligen Reihen über die
Hilfsbetriebe
angezeigt. Daher fiel diese Anzeige aus, wenn der
Stromabnehmer
für den Batteriebetrieb gesenkt wurde. Das gleiche galt auch für die
Heizungen.
Daher war auf der
Lokomotive
der
Antrieb
mit
Akkumulator
eher als Notfahrbetrieb anzusehen, der auch nicht über lange Strecken
erfolgte.
Anschliessend konnte mit dem Vorrat gearbeitet werden. Der
Hilfsluftkompressor
hatte jedoch eine zu geringe
Leistung,
dass er den Vorrat hätte ergänzen können. Ein Punkt, der im Betrieb
beachtet werden musste. Damit kommen wir zum wichtigen Teil, der Kühlung. Dabei wurden der Transformator und der Stromrichter mit einer Flüs-sigkeit gekühlt. Dazu verwendete man ein Öl, das seit Jahren bei Transformatoren verwendet wurde.
Es
wurde diesem
Transformatoröl
kein
PCB
beigemengt. Trotz-dem stellte es eine Gefahr für die Umwelt dar. Bei einem
Defekt konnte das
Öl
jedoch von der im mechanischen Teil erwähnten
Ölwanne
aufgenommen werden. Mit Hilfe einer an den Hilfsbetrieben angeschlossenen Ölpumpe wurde das Kühlmittel in Bewegung versetzt. So wurde eine künstliche Zirkulation erzeugt- Diese sorgte
dafür, dass bei der eigentlichen Wärmequelle durch die
Ölpumpe
immer wieder kühleres
Transformatoröl
zugeführt wurde. Damit aber auch dieses
Öl
nicht zu warm wurde und zu brennen beginnen konnte, musste auch es in
einem
Ölkühler
die Wärme wieder abgeben können.
Die
Rückkühlung des
Transformatoröls
wurde mit einem
Ventilator
verstärkt. Dieser bezog die Luft über das
Düsenlüftungsgitter
und presste diese schliesslich durch den
Kühler.
Dabei nahm diese
Luftkühlung
die Wärme auf und gelangte anschliessend in die Luftkanäle unter dem
Bodenblech. Damit konnte sie den
Fahrmotoren
zugeführt werden. Nachdem auch dort die Wärme aufgenommen wurde, gelangte
die Luft unter dem Fahrzeug ins Freie.
Sie
trat daher im Bereich des Daches aus, da die Luft eine für Menschen
gefährliche Wärme aufweisen konnte. Der Luftaustritt erfolgte seitlich und
so wurde auch die
Fahrleitung
nicht beschädigt. Doch diese Bauweise hatte noch einen anderen Grund. Wurde mit den Batterien gefahren nutzte die Lokomotive die Bremswiderstände weiterhin, da sie bekanntlich als Anfahrwiderstände genutzt wurden.
Da
nun aber der
Ventilator
wegen dem Ausfall der
Hilfsbetriebe
nicht mehr lief, setzte eine natürliche Zirkulation ein, die durch den
Kamineffekt auf natür-liche Weise verstärkt wurde. Daher war auch jetzt
eine
Kühlung
möglich.
Jedoch fiel auch die
Kühlung
der
Fahrmotoren
aus. Diese verfügten über eine Lösung, die dafür sorgte, dass die Wärme
über das Gehäuse abgeführt wurde. Das reichte aus, weil ja jetzt nicht die
volle
Leistung
abgerufen werden konnte. Trotzdem sehen wir gerade an Hand der
Fahrmotoren, dass ein längerer Betrieb ab den
Batterien
nicht vorgesehen war. Die
Lokomotive
Eea 3/3 musste deshalb irgendwann wieder unter die
Fahrleitung
kommen.
Abschliessen wollen wir die
Hilfsbetriebe
mit dem
Batterieladegerät.
Während es sich bei der Reihe Eea 3/3 um ein zweites Gerät handelte, war
es bei der Baureihe Ee 3/3 das einzige Ladegerät. Es wurde benötigt um die
Batterien
für die Steuerung und die Beleuchtung zu laden. Somit wurden auch diese
nur geladen, wenn die
Lokomotiven
unter der
Fahrleitung
standen und eingeschaltet wurden. Das galt auch für die Eea 3/3.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2022 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Bei
der Reihe Eea 3/3 war das jedoch anders. Die Gürbetalbahn GBS verlangte
für die
Bei
der Reihe Eea 3/3 war das jedoch anders. Die Gürbetalbahn GBS verlangte
für die
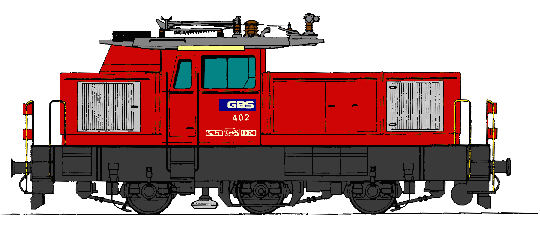 Wurde
mit der Baureihe Eea 3/3 mit den
Wurde
mit der Baureihe Eea 3/3 mit den
 Nach
der
Nach
der
 Selbst
der von den
Selbst
der von den  Mit
dem zweiten
Mit
dem zweiten