|
Beleuchtung, Steuerung und Bedienung |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Vorher bei der Betrachtung der
Hilfsbetriebe
haben wir das Ladegerät für die
Batterien
des Fahrzeuges kennen gelernt. Dieses gab die für die Steuerung ideale
Spannung
ab. Da diese bei den ersten vier
Lokomotiven
nach Möglichkeit zu den vorhandenen Maschinen der Post passen musste,
wählte man ein
Steuerstromnetz,
das zu diesen kompatibel ist. Doch bevor wir uns dieses ansehen, müssen
wir dessen Stützung ansehen.
Bei
der Baureihe Eea 3/3 galt das auch, wenn sie mit den
Akkumulatoren
betrieben wurde. Daher musste eine unabhängige Quelle bereitgestellt
werden und da war die Wahl des Mediums nicht besonders schwer. Es wurden auch hier die üblichen Bleibatterien verwendet. Diese wurden unter dem Vorbau eingebaut. Das führte bei der Baureihe Ee 3/3 dazu, dass die Längsträger kaum über An-bauten verfügten.
Bei
der Reihe Eea 3/3 waren diese
Batterien
jedoch klar von den Modellen für die Trak-tionsleistung getrennt worden.
Es waren hier also unterschiedliche Batterien verwendet worden. Zur
Unterscheidung sprach man bei der Traktion von
Akkumulatoren. Bleibatterien können pro Zelle eine Spannung von zwei Volt abgeben. Da davon in einem Behälter neun Stück verbaut wurden, besass dieser eine Spannung von 18 Volt. Damit war die bei den Bahnen übliche Spannung für den Behälter vorhanden.
Um
die für die Steuerung und die
Beleuchtung
erforderliche
Spannung
zu erhalten, mussten zwei von diesen Behältern in Reihe geschaltet werden.
So entstand letztlich ein Wert von 36
Volt.
War
die
Spannung
aus der
Fahrleitung
vorhanden, aktivierte sich das
Ladegerät.
Dieses gab eine leicht höhere Spannung ab. Dadurch floss der
Strom
von Ladegerät wieder zu den
Batterien.
Diese begannen nun, sich zu laden. Daher nutzte man einen grossen Vorteil
der
Bleibatterien,
denn diese waren sehr einfach zu laden. Der Nachteil war jedoch, dass
während der Ladung Wasserstoff ausgeschieden wurde. Aus diesem Grund
musste der Einbauraum belüftetet werden.
Wichtiger war jedoch die
Dienstbeleuchtung.
Diese wurde mit drei Lampen in Form eines A am Schutz-blech der
Rangierplattform
umgesetzt. Bei der Aus-führung dieser Lampen gab es jedoch grosse
Unter-schiede, die wir uns ansehen müssen. Bei den ersten vier an die Post ausgelieferten Ma-schinen wurden die üblichen bei Rangierlokomo-tiven verwendeten runden Lampen eingebaut. Diese besassen ein klares Glas und verfügten über Halter-ungen für Vorsteckgläser.
Dadurch konnten neben den
Signalbildern
für die Strecke auch die im
Rangierdienst
verwendeten Bilder gezeigt werden. Eine Umschaltung auf eine andere Farbe,
war jedoch nicht möglich.
Für
die später ausgelieferten Maschinen kam je-doch bei der
Beleuchtung
ein anderes Modell zur Anwendung. Dieses Modell stammte aus dem
Strassenverkehr und die rechteckigen Lampen verfügten über Halogenbirnen,
die neben dem normalen Licht auch ein Fernlicht erzeugen konnten. Dabei
konnten jedoch nur die unteren beiden Lampen umgeschaltet werden. Bei der
oberen Ausführung war nur eine Lichtstärke vorhanden.
Da
die Stirnlampen im Strassenverkehr bei den
Scheinwerfern
der LKW verwendet wurden, war darin auch ein gelbes Glas für die Blinker
vorhanden. Dieses wurde bei einem Fahrzeug der
Schiene
jedoch nicht benötigt. Daher wurde das Glas durch eine rote Ausführung
ersetzt. Die Ansteuerung der Lampe verhinderte, dass beide Farben zur
gleichen Zeit leuchten konnten. Damit war hier auch die Signalisation des
Warnsignales leicht zu verwirklichen.
Bei
dieser
Lokomotive
wurde dazu der längere
Vorbau
angenommen. Daher wurde diese spezielle Scheibe auf dieser Seite oben
aufgesteckt. Es konnten auch hier alle erdenklichen
Signalbilder
der Schweiz gezeigt werden. Der Lokführer konnte jede Lampe im Führerstand einschalten und mit Hilfe eines Schalters bei den neueren Lampen auch Volllicht geben. Damit sind wir jedoch bereits bei der Bedienung, welche sehr eng mit der Steuerung der Lokomotive verbunden war.
Daher werden wir diesen Bereich anhand der Sicht des Bedieners ansehen.
Dazu musste sich dieser jedoch in das
Führerhaus
begeben, was über eine der beiden Leitern erfolgte.
Wer
in den
Führerraum
trat, erkannte schnell, dass der Fussboden mit verklebten Holzplatten
belegt wurde. Die Wände und der zentrale
Führertisch
wurden in einer hellgrünen Farbe gehalten. Wobei es beim
Führerpult
mit den Bedienelementen einen grossen Bereich gab, der schwarz eingefärbt
wurde. Abgerundet wurde das ganze Bild mit der weissen Decke. Es war daher
die in der Schweiz übliche Farbgebung vorhanden.
Alle
für die Bedienung erforderlichen Elemente waren an dem zentral auf der
Seite des vorderen
Vorbaus
eingebauten
Führertisch
enthalten. Dieser war von drei Seiten her zugänglich und hatte an der
Stirnseite zwei grosse Türen enthalten. Hinter diesen versteckten sich ein
paar Elemente, die bei Störungen, oder zur
Inbetriebsetzung
benötigt wurden. Die beiden Seitenwände besassen schliesslich den
Fahrschalter,
der senkrecht nach oben stand.
Wurde der Griff auf die nächste Position verschoben, aktivierte sich die
Steuerung. Dabei wurden auch die
Sicherheitseinrichtungen
aktiviert. Wobei sich diese je nach Baureihe unterschieden. Die nächste Stellung unterschied sich jedoch. Bei der Reihe Eea 3/3 wurde nun der Fahrbetrieb mit den Akkumulatoren aktiviert. Durch diese Lösung war es möglich, die Lokomotive auch auf einem Abschnitt ohne Fahrleitung in Betrieb zu nehmen.
Die
nachfolgend beschriebene Bedienung unterschied sich jedoch nur im Bereich
der Steuerung. Die dazu erforderlichen Schaltungen wurden mit dieser
Stellung durch das Fahrzeug aktiviert.
Da
der Batteriebetrieb bei der Reihe Eea 3/3 nur eine Art Notantrieb war,
wurde er automatisch deaktiviert, wenn der Griff zum
Inbetriebsetzungsschalter vom Bediener in die nächste Stellung verbracht
wurde. Bei den Modellen der Baureihe Ee 3/3 folgte diese logischerweise
nach dem aktivieren der Steuerung, da dort ja der Betrieb ab
Batterie
nicht möglich war. Daher wurde nun die normale elektrische Ausrüstung
aktiviert.
Mit
anderen Worten. In dieser Stellung wurde der
Stromabnehmer
gehoben. Hier unterschieden sich lediglich die vier ersten an die Post
gelieferten
Lokomotiven.
Bei diesen wurde, sobald die
Schleifleiste
den
Fahrdraht
berührte und dieser
Spannung
führte, die Lokomotive eingeschaltet. Die anderen Maschinen hatten jedoch
noch eine weitere Stellung beim Schalter. Diese sorgte letztlich dafür,
dass auch der
Hauptschalter
eingeschaltet wurden.
Für
die Stirnlampen, aber auch für die anderen Lichter, war über dem Pult ein
geneigter Korpus vorhanden. Dort fand der Lokführer alle Schalter und
Anzeigen, die für den Betrieb wichtig waren, die aber während der Fahrt
nicht bedient werden mussten. Um die direkte Bremse zu prüfen, musste der Fahr-schalter von einer Mittelstellung in die Richtung für die Bremsung verschoben werden. Dabei bewegte sich der Griff nach unten und je mehr der Hebel abgelegt wurde, desto grösser war die Brems-kraft.
Im
Stillstand und bei Geschwindigkeiten unter 5 km/h wurde nur die
Rangierbremse
aktiviert. Um diese
Brem-se
wieder vollständig zu lösen, wurde der Hebel einfach wieder angehoben. Im Fahrschalter war zudem ein Druckknopf für die Bedienung der Schleuderbremse vorhanden. Dieses zen-trale Bedienelement war auf beiden Seiten des Führer-tisches montiert worden und funktionierte in entgegen-gesetzter Richtung.
So
wurde die
Bremse
je nach der Fahrrichtung immer aktiviert, wenn der Griff nach hinten
gezogen wurde. Wobei das natürlich nur galt, wenn der Lokführer auch
richtig am Schalter sass.
Den
aufmerksamen Lesern ist sicherlich dieser
Fahrschalter
bekannt vorgekommen. Es war keine Neuerung, die hier umgesetzt wurde. Der
Schalter und die Ansteuerung der
Rangierbremse
wurde schon bei den
Diesellokomotiven
der Schweizerischen Bundesbahnen SBB umgesetzt. Bei den Baureihen
Bm 4/4
und
Em 3/3 galt das sogar für die Ansteuerung der
elektrischen
Bremse. Damit waren auch jetzt die Maschinen
für den
Rangierbetrieb ausgelegt worden.
In dem Fall, wurde die Druckluft in der Hauptleitung mit der Rangierbremse gesteuert.
Befand sich der
Fahrschalter
in der waagerechten Position, war in der
Hauptleitung
noch ein Wert von 3.5
bar
vorhanden. Damit konnte hier kei-ne
Schnellbremsung
aktiviert werden. Die neueren Modelle besassen jedoch eine vollwertige automatische Bremse mit dem entsprechenden Bedienele-ment auf dem Führertisch.
Das
für die Bedienung der
automatischen Bremse
erforderliche
Führerbremsventil
stammte von der Firma Oerlikon Knorr Einheitsbremsen OKE. Es handelte sich
dabei um das Modell
FV4a,
das bei den Schweizerischen Bundesbahnen SBB schon seit Jahren bei vielen
Baureihen erfolgreich angewendet wurde.
Der
bei diesem
Ventil
eingebaute
Hochdruckfüllstoss
erlaubte das schnelle lösen und füllen der
automatischen Bremse,
was besonders im
Rangierdienst
gewünscht war. Beim aktiviertem Hochdruckfüllstoss wurden der
Bremsleitung
Luftdrücke
von bis zu acht
bar
direkt ab den Vorratsluftbehältern zugeführt. Das
Bremsventil
regelte den Enddruck in der
Hauptleitung
mit Hilfe eines Steuerbehälters automatisch auf 5.4 bar.
Anschliessend erfolgte ebenfalls noch die Wahl der Fahrrichtung. Dabei
zeigte der Griff immer in die Richtung in der auch gefahren wurde. In der
neutralen Stellung konnte zudem keine
Zugkraft
aufgebaut werden. Waren die Bedingungen erfüllt, konnte die Fahrt beginnen. Dazu musste der Hebel einfach aus der Bremsstellung über die senkrechte Position auf die andere Seite verlegt werden.
Die
Steuerung löste nun die
Bremse
und begann die
Zugkraft
aufzubauen. Je weiter der Hebel abgelegt wurde, desto mehr Zugkraft wurde
abgerufen. Die Einhaltung der maximalen
Ströme
an den
Fahrmotoren
wurde von der Steuerung übernommen. Da sich die Lokomotive nun bewegte, aktivierte sich die Sicherheits-steuerung. Diese war so ausgelegt worden, dass sie den Rangierbetrieb nicht behinderte, jedoch auf der Strecke den notwendigen Schutz bot. Es wurde daher auf die wegabhängige Erfassung verzichtet.
Ein
Zeitrelais löste nun die
Sicherheitseinrichtung
aus. Mit dem
Fahrschalter
konnte dieses
Relais
jederzeit wieder zurückgestellt werden. Nur, wenn keine Handlung erfolgte,
kam es zur
Zwangsbremsung.
An
der Mittelsäule fand der Lokführer schliesslich die Anzeigen für die
Luftdrücke
und die Geschwindigkeit. Die
V-Messer-Anlage
stammte von der Firma Hasler und entsprach dem Typ Teloc TEL 500. Das
sonst bei
Rangierlokomotiven
übliche Modell mit sehr geringen Geschwindigkeiten, war jedoch nicht
vorhanden. Keine der Maschinen sollte an einem
Ablaufberg
eingesetzt werden. In den anderen Fällen war die Anzeige nutzlos.
War
die Geschwindigkeit erreicht, wurde der Hebel einfach wieder angehoben.
Damit rollte die
Lokomotive
ohne
Zugkraft
weiter. Um eine Verzögerung zu erreichen, musste der Griff nun in die
Stellung der
Rangierbremse
verbracht werden. Die Steuerung aktivierte nun automatisch die
elektrischen
Bremse. Diese verzögerte die Maschine
und ergänzte diese
Bremse
bei Bedarf mit der
Klotzbremse.
Unter 5 km/h wirkte nur noch die
Druckluft.
Bei den neueren Maschinen wurde jedoch noch eine für die Strecke erforderliche Zugsicherung einge-baut.
Diese war eigentlich nur bei der Reihe Eea 3/3 gefordert worden, sie wurde
aber auch bei den anderen Modellen eingebaut und daher müssen wir uns
diese noch ansehen.
Die
Zugsicherung
nach dem Muster
Integra-Signum
arbeitete mit Magnetfeldspulen. Bei der Funktion gab es keine Neuerungen.
So konnte auch hier die
Warnung
mit einem
Quittierschalter
bestätigt werden. Halt zeigende Signale aktivierten jedoch die
Haltauswertung.
Damit erfolgten eine
Zwangsbremsung
und die Traktion wurde abgeschaltet. Eine Rückstellung war in diesem Fall
nur mit einer Taste im
Führerpult
möglich.
Da
im
Rangierbetrieb mit der
Lokomotive
an den
Hauptsignalen
vorbeigefahren werden musste, baute man auf dem
Führerpult
eine Taste ein. Diese M-Taste wurde durch einfaches drücken aktiviert und
überbrückte die
Zugsicherung.
Die
Manövertaste
blieb so lange aktiviert, bis sie manuell ausgeschaltet wurde. Eine
Beschränkung der erlaubten Geschwindigkeit war nicht vorhanden. Benutzt
wurde diese Taste auch bei Zügen, wenn nach besonderem Befehl gefahren
wurde.
Eine
Vielfachsteuerung
war nicht vorhanden. Diese wäre zwar umsetzbar gewesen, jedoch kam es
nicht zum Einbau. Der Grund ist simpel, denn der Einsatz brachte nie zwei
Lokomotiven
so nahe zusammen, dass diese Einrichtung genutzt werden konnte. Bei der
Baureihe Eea 3/3 kam noch hinzu, dass es nur das an die Gürbetalbahn GBS
gelieferte Modell gab. Zumindest so lange, bis die Umbauten an einigen
Maschinen einsetzten.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2022 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||

 Wir
haben so ein
Wir
haben so ein
 Um
die im
Um
die im  Um
die
Um
die
 Die
Die
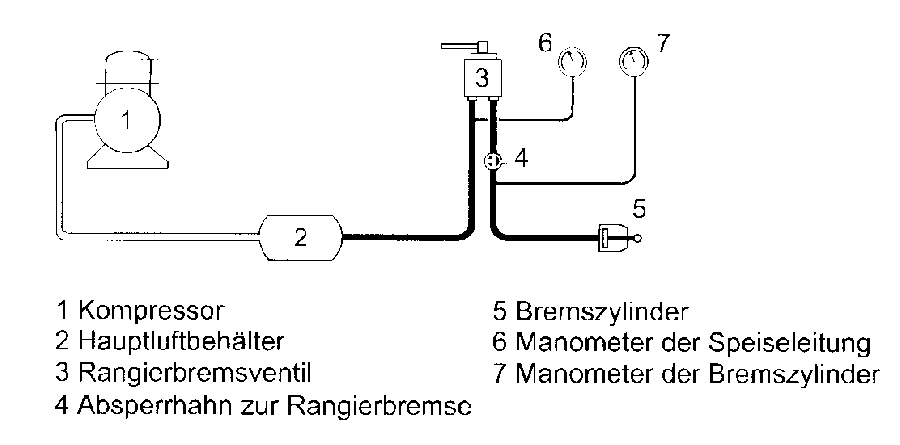 Bei
den ersten vier
Bei
den ersten vier

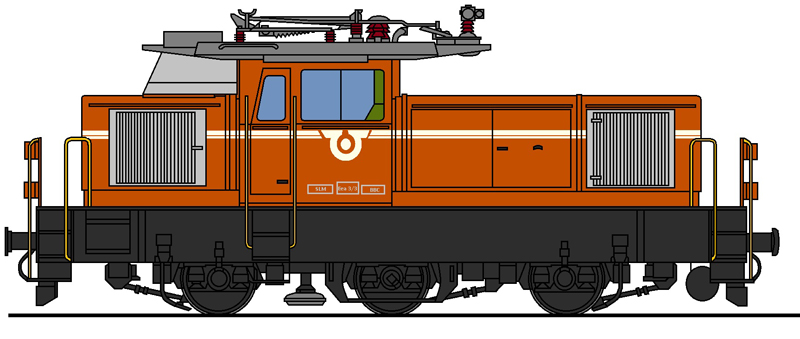 Soweit
können wir die Bedienung bei den ersten vier
Soweit
können wir die Bedienung bei den ersten vier