|
Neben- und Hilfsbetriebe |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Die
Lokomotive
Ae 3/6 II wurde für die Bespannung von
Reisezügen
gebaut. Aus diesem Grund musste sie mit den
Nebenbetrieben
ausgerüstet werden. Diese umfassten damals auch die
Zugsheizungen.
Diese Verbraucher hatten nichts mit der Lokomotive zu tun, sie wurden
jedoch von dieser mit der benötigten Energie versorgt. Die Rückführung der
Spannung
erfolgte immer über die an der Zugsheizung angeschlossen Fahrzeuge.
Zwar hatten sich die Bahnen damals auf eine
ein-heitliche
Spannung
geeinigt, jedoch waren noch nicht alle Wagen entsprechend umgebaut worden.
Daher musste die
Lokomotive
drei Spannungen anbieten. An der
Primärwicklung
des
Transformators
wurden
Spannungen
von 600, 800 und 1000
Volt
abgenommen. Jede wurde anschliessend einzeln zu einem eigenen Heizhüpfer
geführt. Die drei Heizhüpfer waren so verschlossen, dass immer nur einer
geschlossen werden konnte. Welcher das effektiv war, wurde mit einem
einfachen Wählschalter bestimmt. Es lag daher beim Personal die für den
Zug richtige Spannung auszuwählen. In der von den Heizhüpfern abgehenden
gemeinsamen Leitung war schliesslich die Messung des
Stromes
vorhanden. Diese war wichtig, da hier sehr viele Verbraucher angeschlossen
wurden. War die bezogene
Leistung
zu gross, wurde die
Lokomotive
ausgeschaltet. Eine übliche Lösung, die aber unabhängig von der
Spannung
den gleichen Strom zuliess. Ein Umstand, der gerade bei 600
Volt
ein Problem darstellen konnte. Ab der
Lokomotive
mit der Nummer 10 421 war die
Anzapfung
für 600
Volt
nicht mehr vorhanden. Das war kein Manko der Lokomotive, sondern wurde so
umgesetzt, da mittlerweile keine Wagen mehr eingesetzt wurden, die mit 600
Volt geheizt wurden. Sie sehen, dass man auch bei der Auslieferung
Anpassungen an die benötigten Baugruppen vornahm. Durch den Verzicht auf
eine
Spannung,
konnte man jedoch auch hier etwas Gewicht einsparen.
Wurde dieses nicht benötigt, war der
Stecker in einer speziellen Blinddose gehalten und es war so kein
ungewollter Zugang zu der
Spannung
der
Nebenbetriebe
möglich, was in Anbetracht der Höhe wichtig war. Es gab bei den Nebenbetrieben keinen Anschluss für Verbraucher auf der Lokomotive. Die hier be-nötigten Spannungen wurden nicht über diese Leitung, sondern ab einer eigenen dafür vorgesehen Spule versorgt. Diese Wicklung lieferte eine
Spannung
von 220
Volt
und diese wurde für die Versorgung der
Hilfsbetriebe
benötigt. Wir haben damit die
Nebenbetriebe
der
Lokomotive
jedoch bereits abgeschlossen und kommen nun zum wichtigeren Teil. Die
Spannung
für die
Hilfsbetriebe
konnten die Firmen nicht selber wählen. Hier waren klare Vorgaben von
Seiten des Bestellers vorhanden, denn schon die älteren elektrischen
Lokomotiven
hatten diese Spannung erhalten. Warum das so wichtig war, werden wir
gleich erfahren. Zuvor muss der
Transformator
geschützt werden und deshalb wurde in der Leitung eine einfache
Schmelzsicherung
eingebaut. Diese war für einen
Strom
von 400
Ampère
ausgelegt worden. Anschliessend wurde die
Spannung
der
Hilfsbetriebe
zum Depotumschalter geführt. Dieser Schalter war dazu vorgesehen, die
Verbraucher vom
Transformator
zu trennen und eine andere Quelle für die Versorgung der Hilfsbetriebe zu
nutzen. Benötigt wurde diese Funktion im Unterhalt und daher nur in den
Depots
und Werkstätten, daher nannte man diese Versorgung auch
Depotstrom.
Der Vorteil war, dass so kein Traktionsstrom entstehen konnte.
Da der Motor des
Kompressors
von den
Hilfsbetrieben
versorgt wurde, konnte mit Hilfe des
Depotstromes
auch fehl-ende
Druckluft
ergänzt werden. Dazu musste das Kabel angeschlossen und der Umschalter
richtig eingestellt werden. Nun konnte man den Kompressor auf ganz normale
Art in Betrieb nehmen. Dieser ergänzte so den Vorrat ohne gros-sen
Aufwand. War genug Druck vorhanden, wurde die
Lokomotive
wieder normalisiert und das Kabel ausgezogen. Wenn wir schon beim
Kompressor
sind, kann gesagt werden, dass dieser noch eine eigene
Sicherung
besass. Zudem war ein
Schütz
vorhanden, der entweder von der Steuerung, oder vom
Druckschwankungsschalter
beeinflusst wurde. Dieser Schalter regelte den Betrieb des Kompressors
anhand des Druckvorrates. Fiel dieser unter einen Wert von sechs
bar,
begann der Kompressor mit der Arbeit. War der Druck von acht bar erreicht,
schaltete er wieder aus. Die wichtigsten Verbraucher der
Hilfsbetriebe
waren jedoch die
Kühlungen
der elektrischen Baugruppen des Traktionsstromkreises. Dazu gehörte neben
den beiden
Fahrmotoren
auch der
Transformator.
Dieser war mit einer Kühlung versehen worden, die mit Flüssigkeiten
arbeitete. Bei der Baureihe Ae 3/6 II wurden dazu im Transformator und in
den Leitungen 1 620 Liter
Transformatoröl
benötigt. Dieses wurde über spezielle Leitungen eingefüllt. Dieses spezielle
Transformatoröl
verbesserte zusätzlich noch die elektrische
Isolation
der Leitungen. Dank diesen Eigenschaften konnte etwas Gewicht bei den
Isolationen eingespart werden. Weiteres Gewicht sparte man damit, dass
durch die Flüssigkeit die Wärme von den Leitern besser abgeführt werden
konnte, als das mit Luft möglich war. Aus diesem Grund wurde auch Metall
eingespart, das ein sehr hohes Gewicht hatte. Das von den Leitungen erwärmte
Öl
wurde von diesen weggedrängt, so dass kühleres
Transformatoröl
nachfliessen konnte. Durch diesen Prozess wurde das
Kühlmittel
immer mehr erwärmt. Bei der stillstehenden
Lokomotive
reichte zur Rückkühlung der Flüssigkeit das Gehäuse des
Transformators.
Das Öl kühlte am kalten Metall ab und gelangte durch die Änderung der
Dichte wieder zu den
Wicklungen.
Im Betrieb reichte diese
Kühlung
jedoch nicht mehr. Das
Kühlmittel
Transformatoröl
wurde daher mit einer von den
Hilfsbetrieben
versorgten Pumpe zum Ölkühler beim
Führerstand
zwei geleitet. Dort kühlte die Flüssigkeit am kalten Metall der Lamellen
wieder ab und gelangte anschliessend über die Rückleitung wieder zum
Transformator,
der sich auf der anderen Seite der
Lokomotive
befand. Daher wurde das
Öl
zweimal durch den ganzen
Maschinenraum
gepumpt. Um die Rückkühlung des
Transformatoröls
zu verbessern, wurde der Ölkühler mit einem eigenen
Ventilator
versehen. Dieser wurde vom gleichen Motor, wie die Pumpe angetrieben.
Dadurch konnte bei den
Hilfsbetrieben
ebenfalls etwas Gewicht eingespart werden. Ein Umstand der wichtig war,
wollte man möglichst viel der verfügbaren
Leistung
den
Fahrmotoren
zur Verfügung stellen, denn schliesslich bezogen auch die Hilfsbetriebe
ihre Energie vom
Transformator.
So wurden die beiden
Fahrmotoren
und gleichzeitig der
Maschinenraum
gekühlt. Durch die Lamellen in der Seiten-wand kam immer wieder frische
Luft nach. In den Maschinenraum gelangte die Luft bei den ersten Lokomotiven durch die vier seitlichen Lüftungsgitter bei den Führerständen eins und zwei. Die Luft wurde anschliessend am Stufenschalter und am Transformator vorbei, sowie durch den Hilfsbetriebe-raum, in den Fahrmotorraum geleitet. Dieser Weg diente gleichzeitig der
Beruhigung der Luft. Diese Beruhigung war wichtig, denn so konnte die
Kühl-ung
optimal arbeiten. Es zeigte sich jedoch, dass die Zufuhr von frischer Luft bei den ersten Maschinen nicht zureichend genug funktio-nierte. Gerade in den heissen Sommermonaten wurde der Maschinenraum stark erhitzt. Aus diesem Grund wurden ab der Nummer
10 421 zusätzliche
Lüftungsgitter
montiert. Diese sorgten nun dafür, dass die Aussenluft zusätzlich noch das
Gehäuse des
Transformators
umströmte und dieser so besser gekühlt wurde. Wir können uns nun den weiteren
Verbrauchern der
Hilfsbetriebe
zuwenden, dabei war einer vorhanden, der kaum
Leistung
benötigte, jedoch wichtig war. Wegen der klar definierten
Übersetzung
konnte die Anzeige der
Spannung
in der
Fahrleitung
ab den Hilfsbetrieben erfolgen. Speziell war dabei, dass diese auch
angezeigt wurde, wenn die Versorgung ab dem
Depotstrom
erfolgte. Es war daher in diesem Fall eine irreführende Anzeige vorhanden.
Bei allen
Heizungen
der
Lokomotive
wurde lediglich ein
Widerstand
angeschlossen. Dieser erwärmte sich durch den
Strom
und gab diese an die Umgebung ab. Abschliessen wollen wir die Betrachtung der Hilfsbe-triebe mit der Batterieladung. Diese erfolgte ab einer Umformergruppe, die im Hilfsbetrieberaum montiert wurde. Da der Platz dafür jedoch nicht mehr aus-reichte, fand diese ihren Standort auf dem Ölkühler. Der von den
Hilfsbetrieben
angetriebene Motor setzte einen
Generator
für
Gleichstrom
in Bewegung und er-zeugte so eine für die eingebauten
Batterien
passende
Spannung. Die
Umformergruppe
war bei eingeschalteter
Loko-motive
immer in Betrieb. Damit beim Einschaltvorgang die
Sicherung
der
Hilfsbetriebe
durch den plötzlichen Anstieg der Last nicht ausgelöst wurde, war der
Umformer,
der einen
Strom
von 32
Ampère
benötigt speziell angeschlossen worden. Diese Anlaufschaltung sorgte
dafür, dass die Umformergruppe zuerst mit reduzierter
Leistung
arbeitete und erst anschliessend voll funktionsfähig wurde. Damit haben wir den elektrischen Teil
aufgebaut. Dieser erreichte ein Gewicht von 40.6 Tonnen. Zusammen mit dem
mechanischen Teil und dem Inventar wurden die Maschinen mit den Nummern
10 402 bis 10 421 genau 96 Tonnen schwer. Deutlich schwerer war nur die
Nummer 10 401, da diese eine
elektrische
Bremse besass. Auch die Nummern 10 421 bis 10 460 wurden
wegen dem besseren
Transformator
etwas schwerer und erreichten ein Gewicht von 96.7 Tonnen.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2020 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
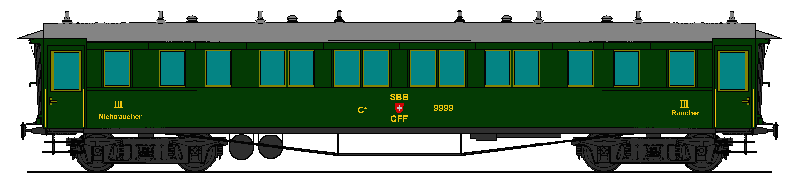 Da
damals noch nicht alle
Da
damals noch nicht alle
 Nach
dem Heizhüpfer wurde die
Nach
dem Heizhüpfer wurde die
 Um
das Kabel des
Um
das Kabel des
 Für
die
Für
die
 Im
Im