|
Entwicklung, Finanzierung und Beschaffung |
|||||||||||
| Navigation durch das Thema | |||||||||||
|
Eigentlich war alles
klar geregelt. Die BLS entwirft das
Pflichtenheft
für die neue
Lokomotive und der Kanton Bern sorgt für die Finanzierung. So
schön das klingt, es war in etwa der einzige Punkt, in dem es so kommen
sollte, wie geplant. Dabei begann alles in einer damals üblichen Art und
Weise. Die verantwortlichen Stellen suchten in Europa nach einem passenden
Modell. Danach wird dieses angesehen und eventuell verwendet.
Eine Idee war die
Beschaffung von
Motorwagen.
Jedoch bewährten sich die Modelle der Reihe
Ce 2/4 nicht
besonders. Aus diesem Grund wurden 1919 auf den bereits mit
Fahrleitung
versehenen Abschnitten Versuche ausgeführt. Es handelte sich dabei um ein
von den Firmen Dyle et Bacalan und
Westinghouse
erbautes Fahrzeug. Geliefert wurde dieses als
Triebwagen
bezeichnete Modell an die Compagnie des chemines de fer du Midi.
Das Fahrzeug, das von
der Gesellschaft für Versuche in die Schweiz geschickt wurde, war vom Typ
E ABD. Dabei müssen wir wissen, dass die Midi, wie man die Gesellschaft
nannte, damals mit einer
Fahrleitung
für 12 000
Volt
und 16 2/3
Hertz
Wechselstrom
versehen war. Das Versuchsfahrzeug passte daher nicht zur BLS, was aber
mit einem
Transformator
korrigiert werden konnte. Den Fahrten mit den
Triebwagen
aus Frankreich stand damit nichts mehr im Weg. Die Ergebnisse aus den Versuchsfahrten mit dem Modell aus Frankreich waren aber nicht befriedigend. Es zeigte sich, dass die Laufeigenschaften nicht viel besser waren, als das bei den Motorwagen Ce 2/4 der Fall war. Durch die bei solchen Fahrzeugen in den Drehgestellen verbauten Motoren und den Tatzlagerantrieb erhöhte sich die ungefederte Masse. Diese verschlechterten die Laufeigenschaften und schüttelte den Triebwagen durch.
Um die Episode mit
diesem
Triebwagen
aus Frankreich abzuschliessen, muss noch erwähnt werden, dass von diesen
Modellen zwei auf
Gleichstrom
umgebaute Exemplare später bei den Schweizerischen Bundesbahnen SBB
eingesetzt wurden. Dabei verkehrten diese auf der mit diesem System
elektrifizierten Strecke zwischen Genève und La Plaine. Doch nun wollen
wir uns wieder der BLS zuwenden und deren Lösung ansehen.
Jedoch war die Ausbeute an passenden Modellen noch bescheidener, denn alle bisher vorhandenen Maschinen war zu schwer, oder aber sie funk^-tionierten nicht wunschgemäss.
Eigentlich passten
von den
Achslasten
nur die bei-den Maschinen aus dem
Versuchsbetrieb
im Raum Zürich. Mit anderen Worten, die BLS hatte nichts anderes zu machen, als eine Lokomotive für Nebenbahnen zu entwickeln.
Wie stark das so
entstandene Modell mit den Bah-nen verbunden wurde, zeigt nur schon, dass
das neue
Triebfahrzeug
der BLS-Gruppe
schlicht als «Dekretsmühle» bezeichnet wurde. Daher lohnt es sich, wenn
wir einen etwas genaueren Blick in das
Pflichtenheft
werfen. Dabei müssen wir nicht einmal in die Details gehen.
Da auch wir dazu
neigen eine Neuerung mit etwas Bekanntem zu vergleichen, müssen wir ein
Muster finden. Bei der BLS bietet sich in diesem Punkt eigentlich nur die
Baureihe
Fb 5/7
an. Dabei besteht jedoch nun das Problem, dass wir eine komplett andere
Anforderung haben. Daher müssen wir das
Pflichtenheft
so ansehen, als gäbe es keine vergleichbaren Modelle. Nicht weil ich zu
faul bin, sondern weil es diese damals auch nicht gab.
Mit dem allgemeinen
Beschrieb im
Pflichtenheft
bekommt man einen guten Einblick. Die BLS wünschte eine
Lokomotive, die für
Nebenbahnen
geeignet war. Damals sah man eigentlich nur die Transitstrecke als
Vollbahn
an. Jedoch ist damit auch bereits klar, dass die
Achslasten
geringer ausfallen würden und somit gewisse Punkte der
Bergstrecke
nicht berücksichtigt würden. Was das genau bedeutete, zeigen ein paar
ausgewählte Punkte.
Die neue
Lokomotive sollte sowohl für Reise-, als auch für leichte
Güterzüge,
auf
Nebenstrecken
geeignet sein. Dabei sollten in Steigungen von bis zu 15‰
Anhängelasten
von bis zu 310 Tonnen mit 35 km/h befördert werden. Das entsprach den
Werten, wie es sie auf den meisten Strecken der BLS-Gruppe
zu berücksichtigen gab. Das galt auch für den Abschnitt zwischen Spiez und
Bönigen, wo die Werte für die anderen Bahnen galten.
Es gab jedoch noch
eine Strecke, die nicht berücksichtigt wurde. Auf der mit 25‰ starken
Steigungen versehenen Strecke der Bern – Schwarzenburg - Bahn BSB musste
von der neuen
Lokomotive jedoch eine
Anhängelast
von 180 Tonnen mit der gleichen Geschwindigkeit mitgenommen werden können.
Wegen den im
Pflichtenheft
fehlenden Angaben zu den grösseren Steigungen der Lötschbergstrecke, war
erkennbar, dass die neue Maschine dort nicht verkehren sollte.
Der Grund war
eigentlich simpel, denn die Reihe
Fb 5/7
konnte grössere Lasten bei höherer Geschwindigkeit befördern. Genau
deshalb können wir keinen direkten Vergleich anstellen. Auch bei den
weiteren Punkten gab es deutliche Unterschiede. Das umfasste auch die auf
der
Bergstrecke
neu verlangte
elektrische
Bremse, denn auf diese wurde im
Pflichtenheft
ausdrücklich verzichtet und so ein einfacher Aufbau verlangt wurde.
Die geforderte
Leistung
lag bei ungefähr 1000 PS. Diese Leistung sollte in einer
Lokomotive eingebaut werden, die maximal nur 12.5 Tonnen
Achslast
haben durfte. Damit konnte man darauf verzichten, den
Oberbau
der
Nebenbahnen
auf einen Wert der
Vollbahnen
zu verstärken. Ein Punkt, der gewählt werden musste, weil die verfügbaren
finanziellen Mittel einen grossen Umbau der
Nebenstrecken
nicht erlaubte.
Daher legte man den
Wert der
Lokomotive ent-sprechend fest. Da jedoch bei der BN höhere
Ge-schwindigkeiten zugelassen waren, musste bei der Konstruktion darauf
geachtet werden, dass auch eine Erhöhung auf 70 km/h möglich war. Man ging bei der Lokomotive von vier Triebachsen aus. Die sollten mit zwei führenden Laufachsen er-gänzt werden. Die Achsfolge der Lokomotive war somit definiert worden.
Bei der Bezeichnung
ging man daher davon aus, dass diese als Fc 4/6 erfolgen könnte. Wobei die
Lo-komotiven der Schweizerischen Bundesbahnen zeigten, dass
Drehgestelle
in engen
Kurven
besser waren. So war effektiv die Bezeichnung Fc 2x2/3 zu erwarten. Dazu sollte es jedoch nicht kommen, denn während sich die ersten Maschinen im Bau befanden, wurden die Bezeichnungen in der Schweiz geändert. Aus der Lokomotive wurde daher die Baureihe Ce 4/6. Bei der Steigerung der Geschwindigkeit auf 70 km/h änderte sich diese auf Be 4/6. Es waren die ersten Lokomotiven der BLS, die von Beginn an die neue Bezeichnung hatten. Daher wird auf dieser Seite auch mit diesen gearbeitet.
Von den eingereichten
Vorschlägen entschied sich die BLS schliesslich für ein Modell, das von
der Maschinenfabrik Oerlikon MFO angeboten wurde. Der mechanische Teil
sollte jedoch von der Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik SLM in
Winterthur stammen. Dabei sollte Maschine eine
Leistung
von 760 kW, oder 1035 PS besitzen. Selbst bei der
Höchstgeschwindigkeit
lag der Hersteller mit 65 km/h über dem Wunsch.
Das wichtigste bei
der angebotenen
Lokomotive war jedoch die
Achslast.
Diese sollte gemäss dem Hersteller sowohl für die Lauf- als auch für die
Triebachsen
eingehalten werden. Damit war man nun bei der BLS bereit für die
Bestellung der neuen Baureihe. Diese sollte insgesamt 14 Lokomotiven nach
dem Baumuster Ce 4/6 umfassen. Diese Maschinen sollten die Betriebsnummern
301 bis 314 erhalten und so sollten verteilt werden.
Knackpunkt war dabei
die geforderte kurze Lieferzeit, da die
Lokomotiven bestellt wurden, als die
Fahrleitung
auf den Strecken schon bald fertig war. Die MFO sah sich auch wegen der
grossen Serie von Lokomotiven der Baureihe
Ce 6/8 II für die
Schweizerischen Bundesbahnen SBB ausser stande diese Fristen einzuhalten.
Doch gerade in diesem Punkt konnte die BLS nicht warten und daher musste
eine Lösung gefunden werden.
Die BLS musste daher
die Bestellung der
Lokomotiven aufteilen. Die MFO sollte daher lediglich
die Nummern 301 bis 307 bauen. Bei den restlichen Maschinen sollte jedoch
die Brown Boveri und Companie BBC in Münchenstein berücksichtigt werden.
Eine Aufteilung, die der MFO nicht passte und so gab es im elektrischen
Teil zwischen den Maschinen Unterschiede. Da die SLM für alle Modelle den
mechanischen Teil lieferte, gab es dort jedoch keine Unterschiede.
|
|||||||||||
|
Typ |
Nummer |
Bahngesellschaft |
|||||||||
|
Ce 4/6 |
301 – 303 |
Bern – Lötschberg –
Simplon |
|||||||||
|
Ce 4/6 |
304 – 305 |
Spiez – Erlenbach –
Bahn |
|||||||||
|
Ce 4/6 |
306 – 307 |
Erlenbach –
Zweisimmen – Bahn |
|||||||||
|
Ce 4/6 |
308 – 312 |
Gürbetalbahn |
|||||||||
|
Ce 4/6 |
313 – 314 |
Bern –
Schwarzenburg – Bahn |
|||||||||
|
In der oben
eingefügten Tabelle mit der Verteilung der 14
Lokomotiven erkennt man, dass die in Oerlikon gebauten
Modelle im Raum Spiez eingesetzt werden sollten. Die aus Münchenstein
angelieferten Maschinen kamen jedoch im Raum Bern in den Einsatz. Das
ändert sich auch nicht, wenn die die später bestellten drei Maschinen für
die BN dazu nehmen würden. Betrieblich sollte es jedoch nie so klar
aufgeteilt bleiben.
Daher kam es dazu,
dass die
Lokomotiven durch die Berner Kan-tonalbahn gekauft
wurden. Erst mit deren Zusage konnten die Verträge endlich unterschrieben
werden. Der Beschaffung von 14 neuen Lokomotiven stand nichts mehr im Weg. Die Kantonalbank übergab schliesslich die Maschinen den ein-zelnen Bahnen gegen eine Mietgebühr. Später konnten diese je-doch von den Gesellschaften auch käuflich übernommen werden.
Heute kennen wir
solche Lösungen und sie werden als Leasing bezeichnet. Damals gab es diese
Regelungen jedoch noch nicht und so gab es im Vorfeld der Lieferung
Differenzen zu den an den
Lokomotiven anzubringenden Anschriften. Als rechtmässigen Besitzer sah sich die Berner Kantonalbank und diese verlangte die entsprechenden Anschriften. Jedoch sahen das die einzelnen Bahnen ganz anders.
Letztlich führte das
jedoch dazu, dass die auffälligen An-schriften, wie es sie bei der Reihe
Be 5/7 gab, bei
der Reihe Ce 4/6 nicht mehr vorhanden waren. Zur Klärung der Zuteilung
durf-te schliesslich an den
Stossbalken
ein einfacher Hinweis ange-bracht werden.
Diese erste
Bestellung, die dank der Bank doch noch getätigt werden konnte, wurde
später noch um drei weitere Maschinen erweitert. Diese besassen die
geforderte höhere
Höchstgeschwindigkeit
und sie wurden als Be 4/6 bezeichnet. Gebaut wurden auch diese
Lokomotiven bei der BBC in Münchenstein. Mit anderen
Worten, die von der MFO entwickelte Baureihe, wurde zum grössten Teil von
der Firma geliefert, in im Wettbewerb stand.
Somit gelangten
insgesamt 17
Lokomotiven dieser Baureihe zur BLS-Gruppe
und wurden dort unter den Bahnen der neuen BLS-Gruppe verteilt. So konnte
die vom Besteller verlangte kurze Lieferzeit eingehalten werden. Trotzdem
dauerte die Lieferung aller 17 Lokomotiven über vier Jahre, wobei
eigentlich nur die drei später bestellten Modelle der Baureihe Be 4/6 im
Jahre 1924 ausgeliefert wurden. Es gab daher eine Lücke.
|
|||||||||||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |||||||||
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | ||||||||
|
Copyright 2022 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||||||||||
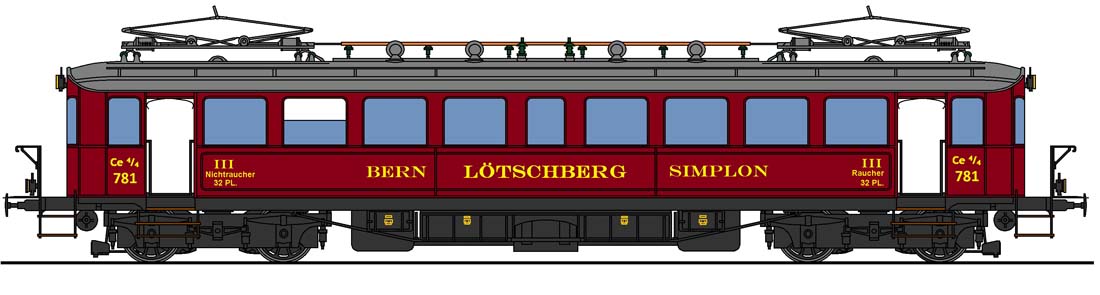
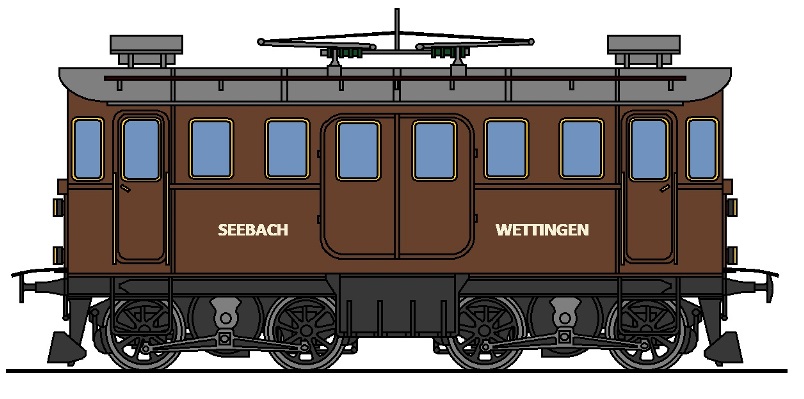 Daher
wurde die Entwicklung von neuen
Daher
wurde die Entwicklung von neuen
 Bei
der
Bei
der 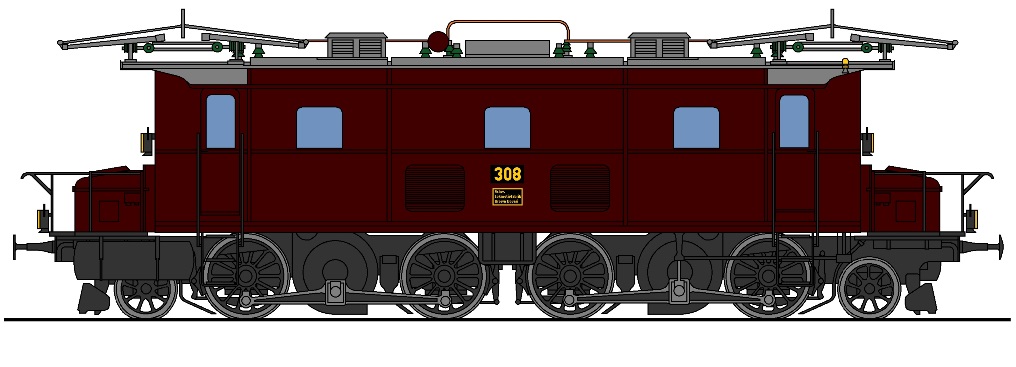
 Soweit
war die Welt in Ordnung, wäre da nicht die Finanzierung gewesen. Diese
konnte von den Bahnen nicht gestemmt werden. Es musste daher eine andere
Form für die Finanzierung gefunden werden.
Soweit
war die Welt in Ordnung, wäre da nicht die Finanzierung gewesen. Diese
konnte von den Bahnen nicht gestemmt werden. Es musste daher eine andere
Form für die Finanzierung gefunden werden.