|
Anstrich und Anschriften |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Wie jedes Fahrzeug, das sich in der Natur bewegt, musste auch
diese
Lokomotive
vor den Einflüssen der Umwelt geschützt werden. Die Bauteile aus Eisen und
Stahl waren besonders anfällig auf Rost. Diese Oxidation schmälerte die
Festigkeit und brachte das Fahrzeug in Gefahr. Die Folge davon war ein
intensiver Unterhalt. Damit dieser etwas geschmälert werden konnte, wurde
das Fahrzeug mit Farben behandelt.
Die Erfahrungen mit den Dampflokomotiven konnten bei den elektrischen Model-len einfliessen.
Trotzdem sollte der Unter-halt reduziert werden. Was nicht so
schwer war, da hier nicht mit Feuer und Wasser gearbeitet wurde. Es gab
keinen
Kessel
mehr, der stark belastet wurde. So bleib nur noch der gute Schutz vor den
Einflüssen der Natur.
Dieser Schutz war so ausgeführt worden, dass zwei Schichten
verwendet wurden. Dabei war jene, die im direkten Kontakt mit dem Metall
war wichtig. Diese diente nicht nur dem Schutz vor Rost, sondern sie bot
auch den Untergrund, für den nachfolgend beschriebenen Decklack. Es lohnt
sich, wenn wir diese auch als Grundierung bezeichnete Schicht etwas
genauer ansehen. Auch wenn sie später nicht mehr zu sehen war.
Bei der Grundierung kamen Lacke zur Anwendung, die eine gute
Deckung ergaben und die auch kleinere Kratzer ausgleichen konnten. Sie
bildeten zudem eine gute
Verbindung
mit dem Metall, so dass sie lange haften blieb. Aus optischen Gründen und
damit die Abdeckung auch erkannt werden konnte, wurden hier Pigmente
beigemischt. Diese waren im ganzen Bereich identisch, da sie später ja
nicht zu sehen waren.
Bei der zweiten Schicht, die als Decklack bezeichnet wurde, wurden
dann die vom Besteller vorgesehenen Pigmente verwendet. Dabei gab es je
nach Ort einen anderen Wunsch. Wobei hilfreich war, dass die
Bahngesellschaften damals noch einfachere Designs wählten. Bei den
elektrischen
Lokomotiven
kam jedoch hinzu, dass man nicht mehr auf die
Rauchgase
und den darin enthaltenen Russ achten musste.
Die dort gemachten Erfahrungen bei den Fahrten durch den langen
und feuchten Simplontunnel, waren vermutlich der massgebliche Grund für
die Wahl der Leute in Spiez. Für den Kasten wurde eine einheitliche Farbgebung verwendet. Nicht in dieser Farbe eingebunden wurde lediglich die Lokomotiv-brücke und das Dach. Als Farbton wurde dabei dunkelgrün ge-wählt.
Diese Farbe hatte den Vorteil, dass sie den
Personenwagen
entsprach. Zudem hatte ich bei den Maschinen im Simplontunnel gezeigt,
dass sie sehr gut gegen die Verschmutzungen des Betriebes reagiert. Die
Lokomotiven
wirkten lange Zeit sauber.
Speziell bei den damals verwendeten Lacken war, dass sie glänzend
abtrockneten. Das führte dazu, dass die neue Maschine je nach Sonnenlicht
bis zu schwarz schimmern konnte. Ein Effekt, der sich jedoch im Betrieb
schnell verflüchtigte und dadurch die
Lokomotive
matt wurde. Dazu beigetragen haben natürlich auch die Verschmutzungen. Das
war auch eine der Folgen, da Fahrzeuge des Eisenbahn damals nur selten
gereinigt wurden.
Bei den stark belasteten Regionen um das
Laufwerk
wurde eine schwarze Farbe verwendet. Diese wurde auch für die
Lokomotivbrücke
und das daran montierte Geländer verwendet. Auch hier lag der Grund bei
den Verschmutzungen. Diese waren von den Dampflokomotiven her bekannt. In
diesem Bereich vermischten sich die verbrauchten
Schmiermittel
mit dem Schmutz. Das ergab eine nahezu schwarze Masse, die an den
Bauteilen haften blieb.
Damit kein Rost entstehen konnte, wurden die Stangen mit einem
Gemisch aus
Öl
und
Petrol
behandelt. Dieses Ge-misch nahm den
Bremsstaub
auf, so dass er sich nicht im Metall einbrennen konnte. Bei den Bandagen kamen hochfeste Stähle zur Anwendung. Diese waren gut vor Rost geschützt. Zudem waren hier thermische Effekte und eine Abnützung vorhanden. Diese hätten der Farbe zugesetzt.
Im Bereich der
Lauffläche
musste zudem der blanke Stahl vorhanden sein, da hier die elektrischen
Ströme
zu den
Schienen
abgeleitet wurden. Farbe hätte auch eine Isolierung bedeutet, was hier
nicht zugelassen war.
Das Dach wurde in einem hellen Grauton gestrichen. Auch hier
zeigten die unter
Drehstrom
eingesetzten
Lokomo-tiven
der
Staatsbahnen
sehr gute Ergebnisse. Diese Farbe ergab ein freundliches Aussehen und
zudem wirkten die Verschmutzungen nicht so schlimm. Das Dach wurde mit der
Dauer des Einsatzes dunkler und wirkte dabei immer noch ansprechend.
Abweichungen gab es hier nur bei den
Isolatoren,
die sich farblich abgrenzten.
Spezielle Zierlinien gab es an der
Lokomotive
nicht, es war so ein schlichter Anstrich angebracht worden. Dieser passte
jedoch zur Maschine, die bekanntlich vor
Güterzügen
eingesetzt werden sollte.
Güterzugslokomotiven
waren schon immer schlichter gehalten, als die Schmuckstücke, die vor den
Schnellzügen
eingesetzt wurden. Wobei die BLS in diesem Punkt keinen Unterschied machte
und das galt auch für die Anschriften.
Davon machten auch die im Berner Oberland bereits verkehrenden
Bahnen gebrauch. Bei der neuen Gesellschaft wollte man jedoch neue Wege
gehen.
Entlang der Seitenwand wurde mit gelber Farbe der Schriftzug BERN
– LÖTSCHBERG – SIMPLON angebracht. Dabei wurde das Wort Lötschberg in
einer grösseren Schrift gehalten. Zudem wurde der Schriftzug mittig auf
der
Lokomotive
angeordnet. Eine Lösung, die auch schon bei den drei
Motorwagen
Ce 2/4 verwendet wurde
und die sich zum Markenzeichen der Gesellschaft entwickeln sollte. Es war
daher eine sehr auffällige Schrift vorhanden.
Noch wurde aber auf die auffällige Schreibweise in Schattenschrift
verzichtet. Es war ein gefälliger einfacher Anstrich vorhanden. Das
Unternehmen konnte so jedoch gut erkannt werden. Da die Gesellschaft weder
Bern anfuhr, noch den Simplontunnel passierte, wurde der Fokus mit der
grösseren Schrift auf die eigentliche Strecke gelegt. Mit der Abkürzung
BLS war dieser Umstand jedoch nicht so gut zu erkennen.
In der oberen Hälfte wurde in der Mitte zwischen den Fenstern die
Nummer der
Lokomotive
angeschrieben. Dabei verwendete die BLS dafür die Betriebsnummer 121.
Speziell war eigentlich nur, dass diese lediglich an den beiden Seiten
angeschrieben wurde. Die beiden
Frontwände
der
Führerkabinen
blieben frei von jeglichen Anschriften. Auch die Hinweise zur Nummer der
Kabinen wurde aussen nicht angebracht.
Das war kein so grosses Problem, denn diese Maschine sollte keine
andere Nummer erhalten. Wobei die zweite Ziffer für die
Güterzugslokomotiven
vorgesehen war. Da es diese je-doch nicht gab, wurde die Ziffer nicht mehr
an der Stelle verwendet.
Es war auffällig, wie bescheiden die technischen Anschriften
ausgefallen waren. Diese gab es schlicht nur bei der Nummer, denn dort
wurde ebenfalls mit gelber Farbe die Typen-bezeichnung angebracht. Diese
lautete bekanntlich Fc 2x 3/3 und sie bildete die Ausnahme. Andere
Angaben, wie jene zu den
Bremsen
und zum Gewicht wurden jedoch nicht angeschrieben. Diese Werte führte man
damals in einem Verzeichnis.
Die beiden Hersteller montierten auf den beiden Seiten unter der
Bezeichnung ein einfaches Herstellerschild. Es wurde dazu ein gemeinsames
Schild verwendet. Dieses war aus Grauguss erstellt worden. Die vertieften
Stellen behandelte man mit schwarzer Farbe. So leuchteten die erhabenen
und geschliffenen Bereiche hell leuchtend. Das Schild konnte daher gut
gelesen werden und das war für die beiden Hersteller wichtig.
Neben den Anschriften Maschinenfabrik Oerlikon und Schweizerische
Lokomotiv- und Maschinenfabrik war auch noch die Fabrikationsnummer
vorhanden. Es war daher ein Herstellerschild, das nachfolgend noch bei
vielen
Lokomotiven
der Schweiz zu sehen war. Wobei sich später die Erbauer nur noch mit den
Abkürzungen begnügten. Die Lokomotive Fc 2x 3/3 war daher klar, als Modell
der MFO und SLM zu erkennen.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2022 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Der
dabei von der Industrie verwendete Lacke, waren natürlich auf dem neusten
Stand.
Der
dabei von der Industrie verwendete Lacke, waren natürlich auf dem neusten
Stand.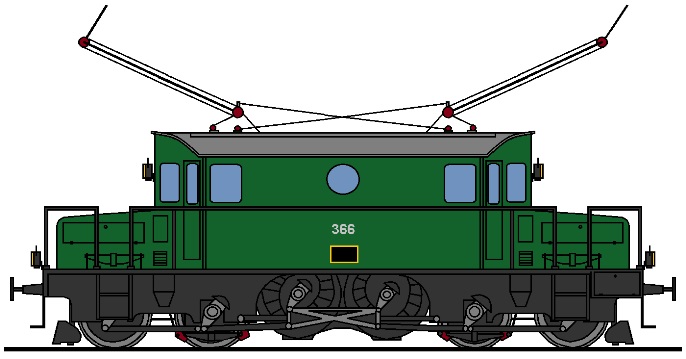 Das
erlaubte neue Ideen bei der Farbgebung. Die BLS war in diesem Punkt jedoch
noch gnädig, denn bei der Wahl der Farben orientierte sich das Unternehmen
bei den mit
Das
erlaubte neue Ideen bei der Farbgebung. Die BLS war in diesem Punkt jedoch
noch gnädig, denn bei der Wahl der Farben orientierte sich das Unternehmen
bei den mit 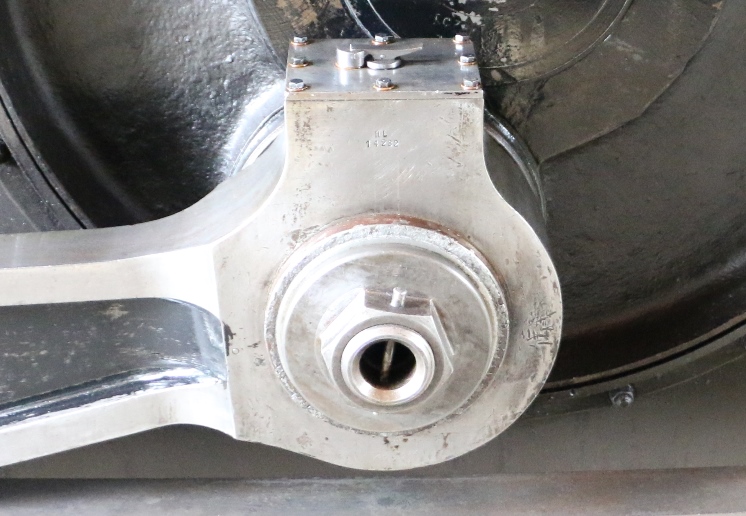 Nicht
überall behandelt wurden die
Nicht
überall behandelt wurden die 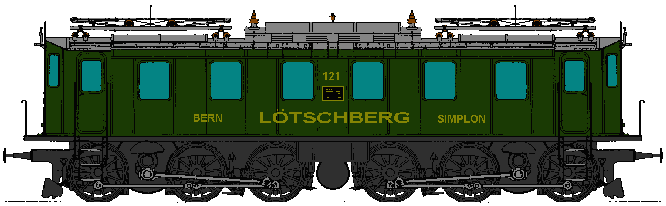 Die
Anschriften der
Die
Anschriften der
 Im
Gegensatz zu den anderen
Im
Gegensatz zu den anderen