|
Schlussworte mit den Folgen |
|||||||||||
| Navigation durch das Thema |
|
||||||||||
|
Wir haben nun die ersten
Triebwagen mit thermischen
Antrieben kennen
gelernt. Es zeigte sich dabei, dass diese nicht in jedem Fall überzeugen
konnten. Die Lösungen mit
Benzinmotoren konnten sich schlicht nicht
durchsetzen. Dabei war das Problem nicht nur beim gefährlichen
Treibstoff
vorhanden. Die damaligen Motoren konnten bei den schweren Fahrzeugen
einfach das verlangte
Drehmoment nicht aufbringen. Um vorwärts zu kommen,
mussten hohe Drehzahlen her.
Nachteilig war, dass die Motoren
eher träge reagierten, wenn die Drehzahl erhöht werden sollte. Bei den
Bah-nen war das hingegen kein Problem und so kamen nur noch diese Motoren
zum Einbau.
Benzin blieb aber auf der Strasse wichtig. Ein weiteres Problem war der schwere Aufbau. Auch wenn mit Leichtmetall versucht wurde Gewicht zu spa-ren, leicht wurden die Fahrzeug oft nicht gerade. Mit diesem Aufbau konnte man keinen Blumentopf ge-winnen.
So
tuckerte man gemütlich durch das Land. Gut zu Be-ginn knallte und zischte es
auf der Fahrt. Jeder Comic-Autor wäre darob vermutlich erblasst. Allgemein
blieb es träge und gemütlicher, als mit der alten Dampfloko-motive. Wollte man auf nicht elektrifizierten Strecken mit anderen Antrieben arbeiten, dann ging das nur mit geringem Gewicht und ohne mitgeführte Wagen. Sollten solche mitgenommen werden, musste man notgedrungen auch bei den Dieselmotoren auf Lokomotiven setzen. Schwache Nebenstrecken benötigten diese aber nur in den seltensten Fällen. Doch die Industrie sah das Problem und präsentierte Lösungen für die Anlagen.
Zusammen mit dem
Triebwagen
CLe 2/4 kamen auch zwei Modelle mit
Dieselmotor. Als
CLm 2/4 bezeichnet, sollten sie auf
Nebenstrecken
verkehren. Mit diesen kleinen roten Flitzern sollte die Post abgehen.
Bekannt wurden die Züge als
Rote Pfeile und wirklich schnell waren nur die
elektrischen Vertreter. Mit dem Dieselmotor ging bei hohen
Geschwindigkeiten nicht mehr viel und Nebenstrecken waren kaum als
Rennbahnen bekannt.
Die Erfahrungen hätten vermutlich auch in der Schweiz zu
erfolgreichen Fahrzeugen geführt, aber eben, es sollte anders kommen und
wie so oft, sollte sich die Geschichte wiederholen. Wirklich schlimm wurde
es diesmal.
Mit dem zweiten Weltkrieg kam die mechanisierte Kriegsführung. Die
schnellen Truppen benötigten
Treibstoffe und das führte dazu, dass auf dem
Markt kaum mehr die benötigten Mengen verfügbar waren. Was in die Schweiz
kam, beschlagnahmte die Armee, die in der Zeit nicht nur die Verteidigung
übte, sondern die Freiheit aktiv verteidigte. Auch dafür waren Triebstoffe
wichtig und das Nachsehen hatten die Bahnen mit solchen Fahrzeugen.
Auch wenn der General während dem Krieg im knallroten Flitzer durchs Land
fuhr. Bei den Schweizerischen Bundesbahnen SBB mussten wieder die alten
Dampfrösser ran. Hier konnte man immerhin noch einheimisches
Holz in die
Feuerbüchse schmeissen, bei einem
Dieselmotor ging das schlicht nicht
mehr. Die Probleme mit den importierten Betriebsstoffen waren gross und
das passte nicht jedem Menschen im Land.
Es kam ein Entscheid, dessen Folgen schlimmer waren, als jener für den
Beginn der Elektrifizierung. In der Schweiz sollten die Bahnen mit
Fahrleitungen versehen werden. Die Schweizerischen Bundesbahnen SBB
elektrifizierten auch schwache
Nebenstrecken. Wo es wirklich nicht mehr
ging, wurde die Einstellung des Verkehrs verfügt. Eine davon betroffene
Nebenstrecke war jene zwischen Niederglatt und Otelfingen.
Privatbahnen, die sich die Arbeiten nicht leisten konnten, wurden mit
Mitteln des Bundes elektrifiziert. Dazu gehörte auch die Mittellose
Thurgaubahn. Äh richtig heissen sollte es Mittelthurgaubahn. Nur eben das
mit den fehlenden Mitteln war kein Geheimnis. Als eine der letzten
Privatbahnen sollte auch sie mit einer
Fahrleitung versehen werden. Damit
waren nahezu 100% der Bahnen in der Schweiz unter dem
Fahrdraht.
Dass diese traumhafte Zahl aber nicht stimmt, verdanken wir der Brienz
Rothorn Bahn. Als die Aktionen mit den
Fahrleitungen begannen, hatte man
dort wegen den fehlenden finanziellen Mitteln den Betrieb schlicht
eingestellt. Die Bahn fuhr nicht und so kam auch niemand auf die Idee eine
Fahrleitung zu bauen. Als man es wieder schaffte Geld zu bekommen, war die
Aktion beendet und am Rothorn verkehrten wieder Dampflokomotiven.
So kam es dazu, dass die Schweiz eine sehr grosse Attraktion hat, denn wo
kann man sagen, dass es nur eine
Bergbahn gibt, die keine
Fahrleitung hat
und die immer noch mit Dampflokomotiven fährt. Der Bahn auf das Rothorn
bei Brienz kann das nur gut tun, denn nun denkt eigentlich niemand mehr an eine
Fahrleitung und auch die Einstellung ist kein Thema. Auch ich blickte
immer wieder auf die Züge, wenn ich Brienz passiere, denn sie gehören
dazu.
Natürlich gibt es Museumsbahnen, die auch ohne
Fahrleitung fahren. In den
meisten Fällen wurde sie einfach abgebaut. Bei der Strecke von Etzwilen
nach Singen kam es zum
Anschlussgleis. Für diese und andere Anlagen ohne
Fahrleitungen mussten aber Modelle mit
Dieselmotor her. In der nun
folgenden Tabelle ist die weitere Geschichte der thermischen Traktion bei
den Schweizerischen Bundesbahnen SBB aufgeführt.
|
|||||||||||
|
Thermische Triebfahrzeuge der
Schweizerischen Bundesbahnen SBB |
|||||||||||
|
Baujahr |
Bezeichnung |
Nummer |
Bauart |
Bemerkungen |
|||||||
|
1935 |
611 - 612 |
Triebwagen |
Umbau in RCe 2/4 |
||||||||
|
1939 |
Am 4/4 |
18 451 - 18 452 |
Lokomotive |
Später als Bm 4/4 II |
|||||||
|
1941 |
Am 4/6 |
1101 |
Lokomotive |
Gasturbine |
|||||||
|
1954 |
Bm 6/6 |
18 501 – 18 514 |
Lokomotive |
Schwerer Rangier |
|||||||
|
1957 |
RAm TEE I |
501 -502 |
Triebzug |
Zusammen mit NS |
|||||||
|
1959 |
Em 3/3 |
18 801 – 18 841 |
Lokomotive |
Rangierdienst |
|||||||
|
1960 |
Bm 4/4 |
18 401 – 18 446 |
Lokomotive |
Rangierdienst |
|||||||
|
1970 |
Em 6/6 |
17 001 – 17 006 |
Lokomotive | Umbau aus Eem 6/6 | |||||||
|
1976 |
Am 6/6 |
18 521 – 18 526 |
Lokomotive |
Rangierdienst |
|||||||
|
1988 |
Am 4/4 |
18 461 – 16 467 |
Lokomotive |
Ehemals V 200 DB |
|||||||
|
1991 |
Em 3/3 |
831 000 – 002 |
Lokomotive |
Rangierdienst |
|||||||
| 1992 | Am 842 |
842 000 – 001 |
Lokomotive | Ehemals Sersa | |||||||
|
1996 |
Am 841 |
841 000 – 039 |
Lokomotive |
Baudienste |
|||||||
|
2003 |
Am 840 | 840 001 – 003 |
Lokomotive |
Einsatz in Italien |
|||||||
|
2003 |
Am 843 |
843 001 – 090 |
Lokomotive |
Rangierdienst |
|||||||
|
Wenn wir die Tabelle genauer ansehen, dann erkennen wir, dass es sich mit
sehr wenigen Ausnahmen immer um
Lokomotiven handelte. Die
Triebzüge RAm
TEE I wären in der Schweiz nicht nötig gewesen, denn so hochwertige Züge
verkehren auf
Hauptstrecken und diese waren 1957 längst unter der
Fahrleitung. Jedoch sollten die Einheiten bis in die Niederlande fahren
und dann war es mit den Fahrleitung schnell vorbei.
Moderne Grossdiesel können
auch auf der Strecke verkehren. Bei der
Baureihe Am 840 war das sogar
vorgesehen. Jedoch nicht in der Schweiz, sondern in Italien.
Nicht in der Tabelle aufgeführt sind die zahlreichen Kleinfahrzeuge mit
Dieselmotor. Sie werden als
Traktoren bezeichnet und solche wurden nur im
Rangierdienst von den Schweizerischen Bundesbahnen SBB eingesetzt. Mit
speziellen Aufbauten gab es sie auch bei den Baudiensten. Hier ist die
Anzahl so gross, dass sie alleine die Tabelle gesprengt hätten. So
unübersichtlich sollte sie nicht werden und daher fehlen halt
Baureihen.
Fahrzeuge die für die Intervention vorgesehen sind, müssen auch
funktionieren, wenn die
Fahrleitung keine
Spannung mehr führt. Diese sind
mit thermischen
Antrieben versehen worden. Es gibt sie also überall, die
Triebfahrzeuge mit einem
Dieselmotor und das in einem Land, das kleinlaut
davon spricht, dass 99.9% der Strecken elektrisch befahren werden. Wie
schon erwähnt, es gibt die Ausnahme von dieser Regel.
Die Tabelle ist nicht abgeschlossen und kann erweitert werden. Eher üblich
sind heute elektrische
Triebfahrzeuge, die über einen
Dieselmotor verfügen.
Das Problem sind die von den Dieselmotoren erzeugten
Abgase. Diese sollte
man vermeiden und nun sind auch die
Akkumulatoren so weit, dass damit
gefahren werden kann. Es wird sicherlich noch viele Jahre dauern, bis auch
wirklich überall mit Ausnahme dem Rothorn bei Brienz elektrisch gefahren
wird.
|
|||||||||||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
||||||||||
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | ||||||||
|
Copyright 2025 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||||||||||
 Das bekam dem Motor nicht besonders und damit blieb der Erfolg aus. Anders
sah es beim
Das bekam dem Motor nicht besonders und damit blieb der Erfolg aus. Anders
sah es beim 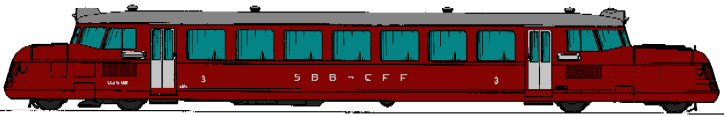 Es war nicht die bescheidene
Es war nicht die bescheidene
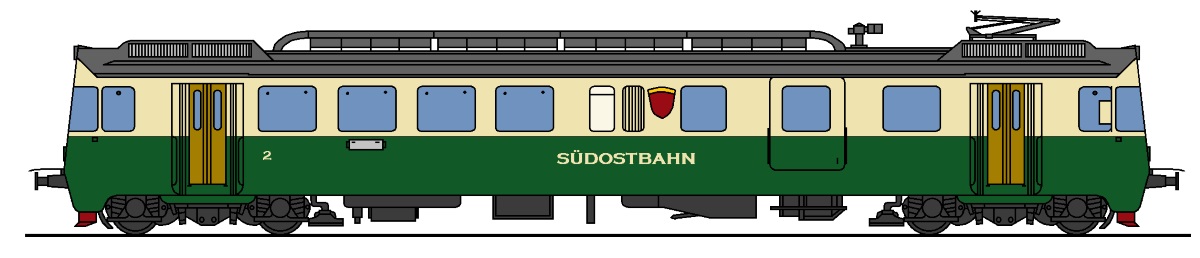
 Alle
Alle