|
Der Triebwagen CFm 2/4 Nr. 9921 |
|||||||||||
| Navigation durch das Thema | |||||||||||
|
Baujahr: |
1932 |
Leistung: |
220 kW / 300 PS | ||||||||
|
Gewicht: |
42 t |
V. max.: |
75 km/h |
||||||||
|
Normallast: |
Nicht bekannt |
Länge: |
17 800 mm |
||||||||
|
Wenn es in der beginnenden Geschichte der thermischen
Triebwagen
in der Schweiz einen
Versuchsträger
gab, der seinen Namen verdiente, dann haben wir ihn nun gefunden. Der
Triebwagen CFm 2/4 mit der Nummer 9921 kam in einer Zeit, wo ein paar
Exoten in der Schweiz zeigten, dass mit
Dieselmotoren
kaum die
Fahrpläne
der elektrischen
Triebfahrzeuge
gefahren werden konnten. Besonders dann, wenn es sich um Triebwagen
handelte.
Die grossen und schweren Motoren beanspruchten wert-vollen Platz und sie sorgten auch zu Problemen mit den Achslasten.
Ein Problem, dem sich mit dieser Reihe die Schweize-rische
Lokomotiv- und Maschinenfabrik SLM annehmen wollte.
Ziel war es, den
Dieselmotor
unter dem Wagenboden zu platzieren und dabei nicht zu viel
Leistung
zu verlieren. Durchaus eine lobenswerte Idee, die damals bei den
elektrischen
Triebwagen
gerade umgesetzt werden sollte. Daher galt es auch bei den thermischen
Modellen eine solche Lösung zu finden. Nur so konnte der grosse Vorteil
gegenüber den
Dampfmaschinen
ausgespielt werden. Der SLM ging es dabei nicht nur um die Schweiz.
Mit einer mechanischen Übertragung sollte zudem viel von der
Leistung
genutzt werden. Bei den
Dieselelektrischen Lösungen wurden damals die
Fahrstufen
mit den
Widerständen
erstellt. Das ergab grosse Verluste und auch bei hydraulischen Lösungen
war ein geringer Verlust vorhanden. Eine mechanische Lösung musste nur die
Hemmung der
Getriebe
überwinden und dann konnte die Kraft auf den
Antrieb
übertragen werden.
Auch wenn der
Triebwagen
eine Bezeichnung und eine Betriebsnummer nach den Normen der
Schweizerischen Bundesbahnen SBB bekommen hatte, verblieb er im Eigentum
der SLM. Diese war damit für alle Schritte mit dem
Versuchsträger
alleine verantwortlich und das betraf auch die externen Aufträge, die
erteilt werden mussten, denn die SLM war ein Lokomotivbauer und nicht
direkt mit Triebwagen beschäftigt.
Es war ein tragender Rahmen mit den Zug- und Stossvorrichtungen und ein Kasten mit Gerüst aus Holz vorhanden. Das Konstrukt wurde dann noch mit Blechen verkleidet.
Dabei war eigentlich nur spannend, dass das Fahr-zeug auch für
betriebliche Einsätze ausgelegt wer-den sollte. Die Aufteilung umfasste den vorderen Führerstand mit dem angrenzenden Abteil in der dritten Wagen-klasse. Dieses war für 30 rauchende Fahrgäste vorgesehen.
Ihm folgte die
Einstiegstüre
und danach das mit 19 Sitzlätzen deutlich kleinere Abteil für die nicht
rau-chenden Fahrgäste. Scheinbar waren damals bei der SLM viele Raucher
angestellt worden, denn Bahnen versuchten immer einen Ausgleich bei den
Sitzen zu bekommen.
Zum Schluss kamen dann noch das 12 m2
grosse
Gepäckabteil
und der zweite
Führerstand.
Wie damals üblich verfügten die Führerstände über eigene Einstiege. Die
Bedienung erfolgte auf der linken Seite und stehend. Das war speziell,
denn
Triebwagen
wurden bei den Schweizerischen Bundesbahnen SBB seit Beginn sitzend
bedient. Hier war klar der von
Lokomotiven
abgeleitete Führerstand des Triebwagens zu erkennen.
Viel Zeit wollen wir nicht mit dem 17 800 mm langen Aufbau
verlieren. Hier gab es keine Neuerungen, denn das Fahrzeug musste zu den
anderen Fahrzeugen passen und selbst bei der Farbgebung orientierte man
sich an den
Staatsbahnen.
Einzig auf die Bahnanschriften wurde verzichtet. Wer nun einen gut
sichtbaren Hinweis auf die SLM erwartet, muss enttäuscht werden. Es waren
lediglich die Hinweise zu den Abteilen vorhanden.
Mit A 2’ A haben wir eine Lösung, die unüblich ist. Es wird aber
noch spannender, wenn wir erfahren, dass sich der Kasten gar nicht auf den
Laufachsen
abstützte und auch diese waren gar nicht so üblich. Das mittige Laufdrehgestell war für die Aufnahme des Dieselmotors und des Getriebes vorgesehen. An diesem waren dann die beiden Bisselachsen vorhanden. Da es sich hier jedoch um die angetriebenen Achsen handelte, dürfen wir sie nicht wie üblich als Bissellaufachse bezeichnen.
Es war einfach eine
Bauart,
die auf diesem bekannten
Laufachsen
aufbaute. Bereits jetzt ist klar, dass ich nicht zu viel versprochen habe,
denn das
Fahrwerk
war spe-ziell.
Bei den
Achsen
selber gab es keinen Unterschied. Es wur-den
Speichenräder
mit
Bandage
verwendet und diese hatten einen Durchmesser von 950 mm erhalten. Das war
sehr gering und passenden Ersatzteile fanden sich bei den
Laufachsen
von anderen
Baureihen.
Es wurde also auch auf den Betrieb geachtet, auch wenn es ein Exot sein
sollte, der wirklich so bezeichnet werden darf. Mit dem
Antrieb
kommen wir zum Grund für das
Laufwerk.
Es bleibt der Kasten, denn dieser stützte sich über
Gleitplatten
und Führungen auf den beiden Bisselachsen ab. Um das
Fahrwerk
gegenüber dem Kasten abzufedern, waren
Blattfedern
verwendet worden. Bedingt durch den Aufbau befanden sich die Drehpunkte
bei den beiden
Achsen
am Schluss, das
Drehgestell
in der Mitte konnte sich seitlich verschieben. Trotz einer guten Führung
in geraden
Gleis,
war auch der Kurvenlauf sehr gut.
Dazu war eine
Kardanwelle
verwendet worden. Diese sind bei solchen
Antrieben
durchaus üblich und hier konnte so auch die Auslenkung der führenden
Achse
ausgeglichen werden. Wie jedes Fahrzeug musste auch dieses abgebremst werden. Dazu wurde wegen der Kombination mit üblichen Wagen Druckluft benötigt. Diese wurde mit einem auf mechanische Weise angetriebenen Kom-pressor erzeugt.
So viele Verbraucher, wie bei anderen
Baureihen
waren hier gar nicht mehr vorhanden, denn es wurden wirklich nur die
Bremse
damit ver-sorgt. Wobei die
Staatsbahnen
immerhin noch die
Lokpfeife
durchsetzen konnten. Da alles so einfach wie möglich sein sollte, wurde auch bei der Bremse nur das Minimum vorgesehen. Verbaut wurde die Westinghousebremse mit einem einlösigen Steuerventil.
Diese wurde auch für die Wagen benötigt und daher war diese
wichtig. Nicht sinnvoll erschien den Konstrukteuren die
Regulierbremse.
Daher wurde auf deren Einbau verzichtet. Das war jedoch bei den anderen
thermischen Modellen auch der Fall.
Bei den mechanischen Bauteilen kam eine normale
Klotzbremse
zum Einbau. Jede
Achse
wurde mit
Bremsklötzen
an der Drehung gehindert. Dabei besass jede Bisselachse einen
Bremszylinder
und dessen
Bremsgestänge
führte auch zur benachbarten
Laufachse.
Diese waren hier gebremst, da sie in einem
Drehgestell
eingebaut wurden. Die
Handbremse
wirkte immer auf das benachbarte Gestänge und so waren gute
Bremsen
vorhanden.
Der Regelbereich befand sich zwischen dieser Drehzahl und jener
von 350 Umdrehungen in der Minute. Soweit haben wir einen normalen
Dieselmotor
für das Fahrzeug erhalten. Wegen dem verfügbaren Platz musste der Dieselmotor sehr flach aufgebaut werden. Daher wurden die einzelnen Zylinder abgelegt und wirkten von beiden Seiten auf die gemeinsame Kurbelwelle.
Diese Bauweise nennt man auch
Boxermotor
und hier konnte die
Baureihe
dadurch so gemindert werden, dass der Motor zwischen den
Laufachsen
und unter dem Wa-genkasten angeordnet werden konnte. Zudem ergab das
ruhige Abteile.
Die
Kühlung
mit Wasser war üblich und hier wurde das erwärmte
Kühlwasser auf das Dach
geführt, wo es in gut sichtbaren
Kühlern
die Wärme an die Luft abgab. Je nach Wetter konnten dabei einige Kühler
auch abgetrennt werden. Das erfolgte gerade im Winter, wo mit dem
Kühlwasser auch das Fahrzeug geheizt wurde. Eine Möglichkeit den Zug zu
heizen gab es jedoch nicht, und auch die manuelle Umstellung war nicht so
einfach.
Mit dem Regelbereich konnte nicht die gesamte Bandbreite der
Geschwindigkeiten abgedeckt werden. Daher wurden nach dem Motor
Getriebe
eingebaut. Jede Seite hatte ein baugleiches Modell erhalten. Es waren
jeweils vier Gänge vorhanden. Mit diesen konnten die Geschwindigkeiten von
14, 27, 45 und 72 km/h erreicht werden. Mit dem
Dieselmotor
war als die
Höchstgeschwindigkeit
knapp nicht erreichbar, aber es gab ja auch Gefälle.
Die Lösung war beim vierten Gang nicht nötig, weil die-ser die
Drehzahl vom Motor direkt auf die
Kardanwelle
und so auf die
Achsgetriebe
übertrug. Bei diesen erfolg-te dann auch die Änderung der Drehrichtung bei
den beiden Fahrrichtungen. Der Schaltvorgang verlangte vom Personal eine gewisse Aufmerksamkeit. So wurde mit einem Handrad, das einem Steuerkontroller entsprach die Drehzahl des Mo-tors geregelt.
Für die
Getriebe
war ein
Steuerschalter
vorhanden und daher musste mit zwei Händen gearbeitet werden. Bei der
Beschleunigung wurde zuerst das
Gas
weggenom-men, dann der neue Gang eingelegt und dann die Dreh-zahl des
Motors wieder erhöht.
Dank der
Kupplung
erfolgte die Zuschaltung ohne störende Geräusche und bei einer Verzögerung
wurde einfach das
Gas
weggenommen, die
Bremse
aktiviert und am Schluss noch der Gang angepasst. Das ist auch bei einem
Auto der Fall, besonders dann, wenn die Zeit nicht mehr reicht um die
Gänge geordnet zu schalten. Hier konnte die Einstellung sogar im
Stillstand erfolgen, denn die
Zahnräder
waren ja immer im Eingriff.
Um auf die Mitnahme eines
Heizers
zu verzichten, wurde eine
Sicherheitssteuerung
im Fahrzeug eingebaut. Diese entsprach der Ausführung, wie Sie bei den SBB
üblich war. Das galt auch für die
Beleuchtung
und andere Vorgaben bei der Bedienung. Das war klar, denn der besondere
Triebwagen
sollte bekanntlich auf dem Streckennetz der
Staatsbahnen
eingesetzt werden. Dieser Einsatz wird nun zu einem spannenden Thema mit
dem Exoten.
Mit einigen Dreiachsern der Schweizerischen Bundes-bahnen SBB am Haken führte die Fahrt von Winterthur nach Romanshorn und wieder zurück.
Dabei waren durchaus ansehnliche Steigungen zu be-wältigen und im
Thurgau konnte auch schnell gefahren werden. Die Fahrten für Einstellungen und Versuche waren wirklich nur sehr kurz, denn mit dem Fahrplanwechsel im Mai 1932 kann das Fahrzeug in den Betrieb. Stationiert wurde der Triebwagen im Depot Rapperswil.
Dort war er jedoch selten, denn seine Heimat fand der Exot der SLM
in Glarus und damit recht weit von den Leuten der SLM entfernt, die das
besondere Fahrzeug durchaus auch Interessenten aus dem Ausland
schmack-haft machen wollte. Die Arbeit auf der noch nicht elektrifizierten Strecke wurde von den mit einem Benzinmotor versehenen Motorwagen übernommen.
Diese kamen einfach nicht mit den Steigungen im Kanton Glarus zu
recht und konnten besser im Raum Rapperswil eingesetzt werden. Mit seiner
doch recht ansehnlichen
Leistung
konnte er auf der Strecke durch den sprichwörtlichen «Zigerschlitz» recht
gut eingesetzt werden, wenn auch nicht für lange Zeit.
Im alpinen Bereich des Kantons sollten Stauanlagen entstehen. Die
dabei benötigten grossen Mengen an Zuschlagstoffen führten zu einem
umfangreichen
Güterverkehr.
Da man diesen nicht mit
Dampfmaschinen
abwickeln wollte, kam im Kanton Glarus die neue
Fahrleitung.
Mit der
Inbetriebnahme
derselben im Jahre 1933 wurde auch der
Personenverkehr
auf elektrische Traktion umgestellt. Der CFm 2/4 mit der Nummer 9921
packte seine Koffer.
Auch wenn das Furttal wieder mit einer
Fahrleitung
versehen worden war, galt das nicht für den Fahrweg des
Triebwagens,
der ab Otelfingen den direkten Weg der ehemaligen
National-bahn
nahm. Dort gab es noch keine Fahrleitung. Es muss erwähnt werden, dass gerade dieser Abschnitt zwi-schen Otelfingen und Niederglatt eine jener Strecken war, die statt mit einer Fahrleitung versehen zu werden, eingestellt wurden. Viele Jahre waren die Abzweigungen noch vorhanden und nur ein kurzes Stück sorgte für den Unterbruch. In Otelfingen sind die Spuren der ehemaligen Nationalbahn verschwunden und auf Seite Niederglatt ist noch ein Anschlussgleis vorhanden.
All das sollte der
Triebwagen
der SLM nicht mehr erleben. Ein Ausflug nach Brugg bekam dem Exoten nicht
gut. Am 23. Mai 1934 und damit nach einem Einsatz von zwei Jahren war er
in eine schwere Kollision verwickelt. Mit schweren Schäden wurde der Exot
nach der Bergung nach Winterthur überführt und dort der SLM übergeben.
Schliesslich gehörte er dieser Firma und nicht den
Staatsbahnen,
denn diese hätten ihn noch am Unfallplatz abgebrochen.
Bei der Begutachtung der Trümmer durch die Fachleute der SLM war
erkennbar, dass der ramponierte Holzkasten mit vertretbarem Aufwand
hergestellt werden könnte. Die verbogenen Bleche entfernen, ein neues
Gerippe und dann wäre die Sache erledigt. Soweit sollte es jedoch nicht
kommen, denn auch das
Laufwerk
war beim schweren Unfall beschädigt worden und daher musste auch dieses
untersucht werden.
Noch im selben Jahr wurde der CFm 2/4 mit der Nummer 9921
ausrangiert. Nach einem Einsatz von nur zwei Jah-ren, war das Verdickt
klar,
Triebwagen
mit
Dieselmotor
sollten leicht, rot und schnell sein. Ein Abbruch erfolgte jedoch nicht. Während dem zweiten Weltkrieg suchten die Schweizerischen Bundesbahnen SBB nach einem billigen Fahrzeug für einen Wagen mit Werk-statt.
Dabei stiess man auf die Trümmer und so wurde der Kasten ohne das
Laufwerk
übernommen. Das besondere Laufwerk mit seinen angetriebenen
Achsen
von Bissel sollte nicht mehr gerettet werden. Es wurde abgebrochen und
wurde dem Schrotthändler übergeben.
Als Wagen X4 mit der Nummer 99187 kam der Kasten wieder in
Betrieb. Es wurde umgebaut und dabei mit einer Küche versehen. Da noch ein
Führerstand
erhalten blieb, konnte der ehemaligen
Triebwagen
erkannt werden. Nur der
Kamin
für den Kochherd wirkte etwas verstörend, denn die
Abgase
wurden früher unter dem Fahrzeug entlassen. Jedoch haben wir mit einem
Kasten noch keinen Wagen, denn es fehlt das
Laufwerk.
Die Schweizerischen Bundesbahnen SBB setzten einfach gerade im
Lager
oder nach
Ausrangierungen
verfügbare
Laufwerke
darunter. Etwas speziell wirkten dann die
Drehgestelle
mit den einzelnen
Rädern.
So konnte sich der kaum mehr bewegte Wagen X 4 Nummer 99 187 noch 28 Jahre
halten. Die letzten Überreste wurden danach abgebrochen und so verschwand
der CFm 2/4 mit der Nummer 9921 mit einer extrem kurzen Karriere.
|
|||||||||||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |||||||||
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | ||||||||
|
Copyright 2025 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||||||||||
 Er
war von den Schweizerischen Bundesbahnen SBB gar nicht in Auftrag gegeben
worden. Als
Er
war von den Schweizerischen Bundesbahnen SBB gar nicht in Auftrag gegeben
worden. Als
 Der
Wagenkasten wurde von der Firma Schindler Wagonbau Schlieren SWS gebaut.
Dabei kamen die damals üblichen Konstruktionen zur Anwendung.
Der
Wagenkasten wurde von der Firma Schindler Wagonbau Schlieren SWS gebaut.
Dabei kamen die damals üblichen Konstruktionen zur Anwendung.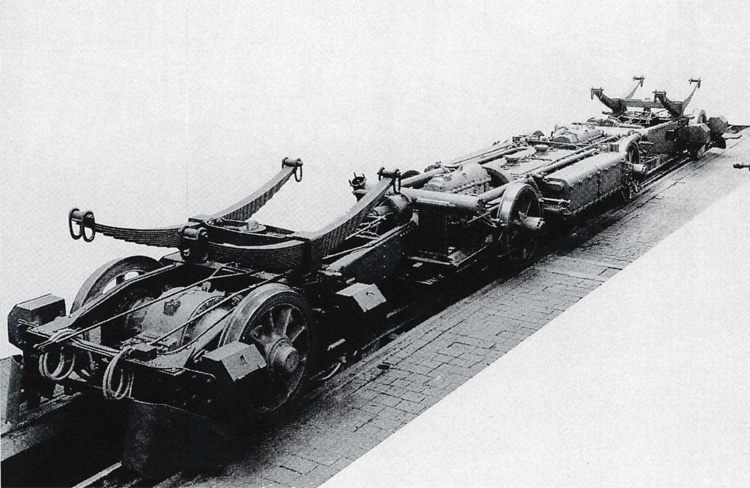 Deutlich
spannender wird hier das
Deutlich
spannender wird hier das
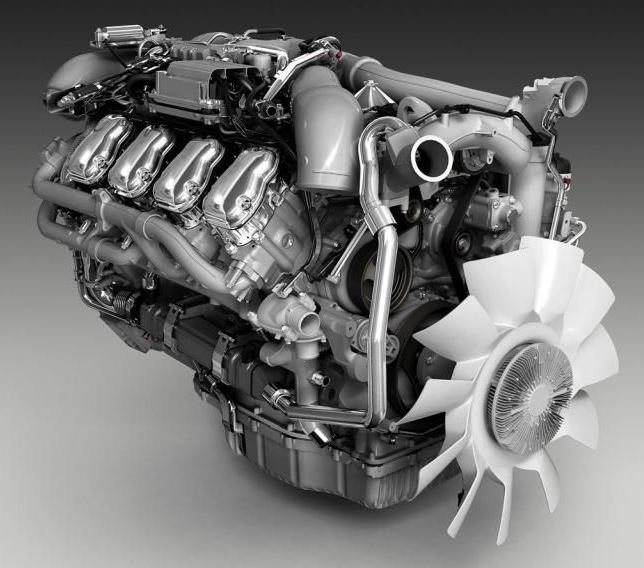 Bedingt
durch die Idee den
Bedingt
durch die Idee den
 Für
die Schaltung der einzelnen Gänge gab es bei den Untersetzungen eins bis
drei eine Ölkupplung. Die
Für
die Schaltung der einzelnen Gänge gab es bei den Untersetzungen eins bis
drei eine Ölkupplung. Die
 Im
Frühling begannen die
Im
Frühling begannen die  Neu
hiess das
Neu
hiess das