|
Der Triebwagen Fm 2/4 Nr. 1962 |
|||||||||||
| Navigation durch das Thema | |||||||||||
|
Baujahr: |
1930 |
Leistung: |
308 kW / 420 PS | ||||||||
|
Gewicht: |
57.3 t |
V. max.: |
75 km/h | ||||||||
|
Normallast: |
Nicht bekannt |
Länge: |
17 600 mm |
||||||||
|
Wie bei allen thermischen
Triebwagen
der Frühzeit, galt auch hier, dass mit der
Baureihe
Fm 2/4 nur alleine, oder mit geringen Lasten gefahren werden sollte. Das
erfolgte auf nicht elektrifizierten
Nebenstrecken.
Auch sonst, war der Triebwagen keine grundsätzliche Neuerung, denn auch
hier galt, es sollte der
Antrieb
erprobt werden und noch waren
Dieselmotoren
neu. Also musste für mehr
Leistung
eingespart werden.
Genauer bedeutet das, es wurde nach dem gleichen Muster gearbeitet, wie das schon beim CFm 2/4 der Fall war.
Hier sollte jedoch auf das
Personenabteil
verzichtet wer-den und so mehr Platz für den Motor geschaffen werden. Als
Folge davon konnte, das Fahrzeug gekürzt werden.
Auch wenn wir mit dem gleichen Aufbau arbeiten können, bei den
Lieferanten gab es Unterschiede. Beim mechanischen Teil gab es mit der SIG
keinen Unterschied. Auch der
Dieselmotor
wurde von der Firma Sulzer geliefert. Jedoch stammte die elektrische
Ausrüstung diesmal von der Maschinenfabrik Oerlikon MFO. Daher kann dort
auch der grösste Unterschied erwartet werden, denn bei der SIG machte man
sich das Leben leicht.
Der tragende Rahmen nahm die Bauteile auf. Er war auch für die
Übertragung der von den Zug- und
Stossvorrichtungen
übertragenen Kräfte zuständig. Im mit einem Gerüst aus
Holz
aufgebauten Kasten konnten keine Kräfte übertragen werden. Bei der
Verblechung wurde wegen dem hier recht hohen Gewicht, das leichte
Aluminium verwendet. Auf die weitere Betrachtung können wir verzichten,
denn es war schlicht Standard.
Durch den Verzicht auf das
Personenabteil
ergaben sich jedoch Anpassungen. Nach der vorderen
Führerkabine
folgte nun der
Maschinenraum
mit dem
Dieselmotor.
Diesem folgte das
Postabteil.
Damit das Postgeheimnis gewahrt blieb, war ein Seitengang vorhanden. Durch
diesen Aufbau konnten auch allenfalls erforderliche Arbeiten des Zolls
vorgenommen werden. Auf die Angabe in der Bezeichnung wurde jedoch
verzichtet.
Da keine Reisenden angerechnet werden mussten, konnte die Zuladung auf 2.5 Tonnen angehoben werden.
Für schwere Stücke wurden damals in erster Linie
Güterwagen
verwendet. Trotzdem so richtig viel konnte auf der grossen Fläche nicht
verladen wer-den. Ein Problem ergab sich nach dem Muster mit den Achslasten. Diese wurden durch den schweren Die-selmotor auf dem vorderen Drehgestell zu stark erhöht. Um die Lasten ausgleichen zu können, wurden die Drehgestelle einfach getauscht. Die Antriebe wur-den nun im hinteren Drehgestell eingebaut.
Das war nicht so schwer, da ja das Muster für Motoren ausgelegt
wurde. Wie nahe verwandt der
Fe 4/4 war, sollte sich noch
zeigen.
Wie alle anderen
Triebwagen
mit thermischem
Antrieb
wurden die von den Wagen her bekannten Farben in grün verwendet. Das galt
auch für die Anschriften, denn Triebwagen sind in dem Punkt den
Personenwagen
gleich gestellt. Wirklich spannende Punkte gab es beim mechanischen Aufbau
nicht, denn wenn sie nicht zum
CFm 2/4 passten, dann
sicher zum
Fe 4/4. Man konnte so auch
die Kosten für den Exoten gering halten.
Die grössten Abweichungen will ich Ihnen aber nicht vorenthalten.
Der Fm 4/4 hatte eine Länge über
Puffer
von 17 600 mm. Damit reihte er sich zwischen dem längeren
CFm 2/4 und dem eher kurzen
Fe 4/4 ein. Optisch war der eher
wie ein Fe 4/4 aussehende
Triebwagen
an den fehlenden
Stromabnehmern
zu erkennen. Diese wurden nicht benötigt, da hier die Energie von einem
Dieselmotor
geliefert wurden und den sollen wir uns ansehen.
Wurde diese jedoch auf 520 Umdrehungen verringert, sank auch die
Leistung.
Beide Drehzahlen konnten manuell eingestellt werden und das war eher
speziell. Der Motor wurde mit Wasser gekühlt. Das Kühlwasser wurde in einem Behälter mitgeführt und nahm die Wärme im Motor auf. Danach wurde es auf das Dach des Triebwagens geführt und dort in mehreren Kühlern durch den Fahrtwind abgekühlt.
Eine
Kühlung
die durchaus ausreichend bemessen war und die je nach Jahreszeit verändert
werden musste, denn bei kalten Tagen wurde der
Dieselmotor
zu stark gekühlt. Um einen Dieselmotor zu starten, muss nur die Kurbelwelle in Bewegung versetzt werden. Dazu wurde der fest verbundene Generator genutzt. Dieser wurde dazu ab den auf dem Fahrzeug verbauten Bleibatterien so erregt, dass er sich zu drehen begann.
War der
Dieselmotor
gestartet, konnte umgeschaltet werden. Eine durchaus übliche Lösung, die
hier aber trotzdem speziell gelöst wurde, denn es gab nur diese
Batterien.
Die für den Anlassvorgang benötigten
Bleibatterien
hatten eine
Spannung
von 120
Volt
und sie wurden auch für die Steuerung und die
Beleuchtung
benutzt. Eine Lösung, die später auch bei anderen
Baureihen
verwendet werden sollte, denn so konnte das Gewicht der schweren
Batterien
gemindert werden. Auch hier musste wegen den zugelassenen
Achslasten
darauf geachtet werden. Sie sehen, es war nicht leicht und das galt auch
für die Bedienung.
Es
wurde eine andere Lösung verwendet und dazu müssen wir uns die Ansteuerung
der beiden im hinteren
Dreh-gestell
verbauten
Fahrmotoren
ansehen. Auf die Um-schaltung derselben wurde jedoch verzichtet und
sie waren immer parallel geschaltet. Für die Regelung der Fahrmotoren wurden Widerstände verwendet. Diese konnten so geschaltet werden, dass der Triebwagen über 20 Fahrstufen verfügte und dabei mit den beiden Leistungsklassen arbeiten konnte.
Eine Lösung, die mit grossen Verlusten arbeitete und das wirkte
sich auf den Verbrauch des
Dieselöls
aus, denn der Motor lief mit einer festen Drehzahl und konnte nicht so gut
an den Bedarf angepasst werden. Um den Verbrauch zu mildern wurde das Lokomotivper-sonal angehalten mit der niederen Drehzahl zu fahren. So sollte der Verbrauch beim Dieselöl gesenkt werden. Zudem wurde dadurch der Dieselmotor etwas geschont.
Bei Fahrten im
Leerlauf,
oder bei
Bremsungen
auf einen Halt, sollte der
Dieselmotor
zudem abgestellt werden. In dem Fall wurde mit der
Westinghousebremse
gearbeitet, denn eine andere Lösung gab es nicht mehr.
Auch wenn wir hier einen
Triebwagen
haben, der nur über ein
Gepäckabteil
verfügte, musste eine
Heizung
eingebaut werden. Das mitfahrende Personal konnte besser arbeiten und auch
allenfalls mitgeführtes Wasser konnte nicht gefrieren. Gegenüber den
anderen hier vorgestellten
Versuchsträgern
kam hier eine andere Lösung zur Anwendung und die arbeitete mit dem
Dieselmotor
und einem
Generator,
der von diesem angetrieben wurde.
Diese wurde wie bei den elektrischen Triebfahrzeugen mit einem Heizhüpfer geschaltet und dabei gab es bei dem Triebwagen drei mögliche Schaltungen. Ein Umschalter konnte so eingestellt werden, dass die Leistung des Dieselmotors für die Heizung bereit stand.
Mit der zweiten Stellung konnte noch mit reduzierter
Leistung
geheizt werden. Nun war es auch mög-lich, mit dem
Triebwagen
aus eigener Kraft zu fahren. Im dritten Programm stand dann die Leistung
des
Dieselmotors
nur den
Fahrmotoren
zur Verfügung. Die entsprechende Einstellung musste vom Personal
vorgenommen werden. Die von der Regel abweichende Spannung führte dazu, dass von diesem Triebwagen im Park der Schweizerischen Bundesbahnen nur neun Personenwagen geheizt werden konnten. Zudem war es auch nur möglich mit Widerständen zu arbeiten, da in der Regel Wechselstrom benutzt wurde.
Gerade dieser und seine Eigenschaften wurden auf diesem
Triebwagen
genutzt, denn einen Zug mit dem
Dieselmotor
aufzuheizen verbrauchte viel
Treibstoff.
Daher war es ohne Probleme möglich, den
Triebwagen
Fm 2/4 an eine stationäre
Vorheizanlage
anzuschliessen. Die nun vorhandenen 1000
Volt
Wechselstrom
hatten bei den
Widerständen
den gleichen Effekt, wie das beim geringeren
Gleichstrom
der Fall war. So musste mit dem
Dieselmotor
nur noch die Wärme gehalten werden. Auf den Verbrauch beim
Dieselöl
wirkte sich das natürlich positiv aus und der
Treibstoff
konnte zum fahren genutzt werden.
Bei dieser wurde mit Hilfe der
Abgase
eine
Turbine bewegt und so mehr Luft in den Verbrennungsraum geführt. Eine
Lösung, die heute durchaus unter dem Namen
Abgasturbolader
bekannt ist. Die Aufladegruppe hatte aber noch ein höheres Ge-wicht. Auf den sonst unveränderten Motor hatte das grosse Auswirkungen. Bei gleichem Verbrauch konnte die Leistung auf 440 kW, oder 600 PS gesteigert werden. Das waren nahezu 50% mehr Leistung.
Deutlicher kann der Vorteil dieser Aufladegruppe nicht aufgezeigt
werden. Noch wurde damit also mehr
Leistung
abgerufen und nicht der recht hohe Verbrauch beim
Dieselöl
gemindert. Die spezielle Bedienung blieb daher erhalten. Mit mehr Leistung konnte auch die Höchstgeschwindigkeit angehoben werden. Neu durfte mit 90km/h gefahren werden. Wobei weiterhin galt, dass das oft nur im Gefälle erreicht wurde.
In Steigungen mit geringer Last war davon kam etwas zu bemerkten,
denn in diesem Bereich waren die elektrischen Vertreter schlicht nicht zu
schlagen. Der
Triebwagen
war aber immer noch ein
Versuchsträger,
auch wenn das bisher nicht so deutlich schien. Der stark belastetet Dieselmotor musste nach einem Defekt ersetzt werden. Daher wurde der Triebwagen im Jahre 1959 modernisiert. Neben einem neuen Motor umfasste das auch Anpassungen bei den Bremsen.
So gab es ein mehrlösiges
Ventil
für die
automatische Bremse
und auch die direkte
Regulierbremse
wurde eingebaut. Es sollte so eine bessere Verwendung ermöglicht werden.
Bei der neuen
Höchstgeschwindigkeit
von 90 km/h sicherlich nicht falsch. Ausgeführt wurde die Arbeiten in der Hauptwerkstätte Zürich und dabei war der neue Motor der wichtigste Teil. Es wurde ein Modell eingebaut, das über acht Zylinder verfügte.
Um die Baulänge nicht zu erhöhen, wurden diese in der V-Form
angeordnet. Auch wenn es für den
Triebwagen
ein neuer Motor war, er stammte von der
Baureihe
Em 3/3. So konnte man die
Vorhaltung von Ersatzteilen reduzieren und ein besser einsetzbarer
Triebwagen entstand.
Mit dem neuen
Dieselmotor
konnte die
Leistung
weiter gesteigert werden. So war nun ein Wert von 530 kW oder 720 PS
vorhanden. Davon wurde aber ein Teil auch für die neue
Zugsheizung
benötigt. Beibehalten wurde die Umschaltung und auch die zugelassene
Geschwindigkeit blieb bei 90 km/h. Ansehen müssen wir jedoch die neue
Zugsheizung, denn die Versorgung erfolgte nun mit
Wechselstrom
und einem eigenen
Generator.
Zwar lag die
Nennspannung
auf dem üblichen Wert von 1000
Volt,
jedoch konnte diese mit dem
Dieselmotor
nicht immer gehalten werden. Das führte dazu, dass zwar andere
Personenwagen
verwendet werden konnten, jedoch immer noch kein freizügiger Einsatz
möglich war. Damit sind wir aber soweit, dass wir uns diesen Einsatz
genauer ansehen müssen, denn der
Triebwagen
hatte eine überraschend lange Karriere.
Im benannten Abschnitt von Etzwilen nach Singen sollte das so-gar
bis zum Schluss so bleiben, denn die Sanierung der
Brücke
über den Rhein verhinderte eine
Fahrleitung. Nach der Ausrüstung mit der Aufladegruppe kam der Trieb-wagen auch auf anderen Strecken zum Einsatz. Dabei befuhr der Fm 2/4 mit Eilzügen den Umlauf von Winterthur über Schaffhausen, Konstanz und Basel zurück nach Winterthur.
Das führte dazu, dass dieser
Triebwagen
eine ansehnliche Lauf-leitung bekam. Das hatte er in erster Linie der
gegenüber den anderen
Versuchsträgern
mit thermischem
Antrieb
der
Leistung
zu verdanken.
Der zweite Weltkrieg brachte auch diesen
Triebwagen
in die
Remise.
Er wurde wegen dem akuten Mangel bei den
Treibstof-fen
abgestellt. Auch er konnte an der Tatsache nichts ändern, denn
Dieselöl
wurde auch in der Schweiz für die Armee benötigt. Daher verschlief auch er
den Entscheid für eine weitere umfangreiche Welle bei den
Elektrifizierungen. Die Schweiz sollte mit der
Fahrleitung
überspannt werden, wenn auch nicht überall.
Nach dem Krieg wurde auch der Fm 2/4 zusammen mit dem
CFm 2/4 in den Süden nach
Bellinzona versetzt. Dort sollte er auf der Strecke nach Luino eingesetzt
werden und auch dieser
Triebwagen
war beim Personal in der Südschweiz nicht so beliebt. Ein Bruch der
Kurbelwelle beendete den Einsatz. Es ging zur Reparatur in den Norden und
dort in die
Hauptwerkstätte
Zürich. Der Motor wurde repariert und dem Fm 2/4 die neue Nummer 891
verpasst.
Nach der Herstellung kam der
Triebwagen
wieder an seinen ursprünglichen Standort in Winterthur. Dort konnte er auf
den bekannten Strecken noch verwendet werden. Der Einsatz blieb jedoch auf
wenige Strecken beschränkt, denn neue
Lokomotiven
mit
Dieselmotor
waren besser verwendbar. Der Dieselmotor war dazu einfach zu schwach und
damit auch immer öfters anfällig auf Schäden. So einer sollte auch den
Einsatz beenden.
Auch er sollte sich noch auf der Strecke von Genève nach La Plane
nützlich machen. Wobei es beim sollte blieb, denn die schwere Arbeit wurde
immer wieder von den neuen
Lokomotiven
übernommen. Der neue Dm 2/4 wurde in die Reserve abgedrängt. Als universelle Reserve war der alte Triebwagen wenig geeignet. Auch wenn mit dem Dieselmotor der Baureihe Em 3/3 ein guter Motor vorhanden war.
Die deutlich grösseren
Lokomotiven
konnte er nicht ersetzt und so sank sein Stern immer mehr. Es mangelte an
Arbeit für einen reinen Gepäcktrieb-wagen mit
Dieselmotor.
Die passenden Strecken benötigten nur kleine
Gepäckabteile.
Der Einsatz endete 1971. Zum Abschluss wurde der
Triebwagen
am 29. Dezember 1971 von Winterthur aus auf seine letzte Fahrt nach
Schaffhausen begleitet. Danach endete seine Karriere und sowohl der
Dieselmotor,
als auch der
Generator
wurden ausgebaut, denn sie konnten auch bei der
Baureihe
Em 3/3 verwendet werden. Der Rest
wurde in der
Hauptwerkstätte
in Olten abgestellt und wartete auf eine ungewisse Zukunft.
Die Teile sollten nicht abgebrochen werden. Denn auf die Reste
wurde die Bahn Emmental – Burgdorf – Thun EBT aufmerksam. Da es sich beim
Fahrzeug um einen ehemaligen
Triebwagen
handelte, war er für einen Wagen sehr robust gebaut worden. Das führte
dazu, dass er noch eine Zukunft als
Hilfswagen
bekommen sollte. Im Jahre 1973 endeten die letzten Teile des Fm 2/4 und
daraus wurde der Wagen X 1201 der EBT.
|
|||||||||||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |||||||||
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | ||||||||
|
Copyright 2025 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||||||||||
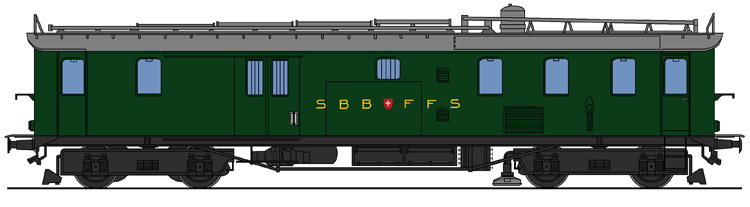 Das
1928 von den Schweizerischen Bundesbahnen SBB bestellte Fahrzeug war
eigentlich der
Das
1928 von den Schweizerischen Bundesbahnen SBB bestellte Fahrzeug war
eigentlich der
 Gegenüber
dem Muster konnte der
Gegenüber
dem Muster konnte der 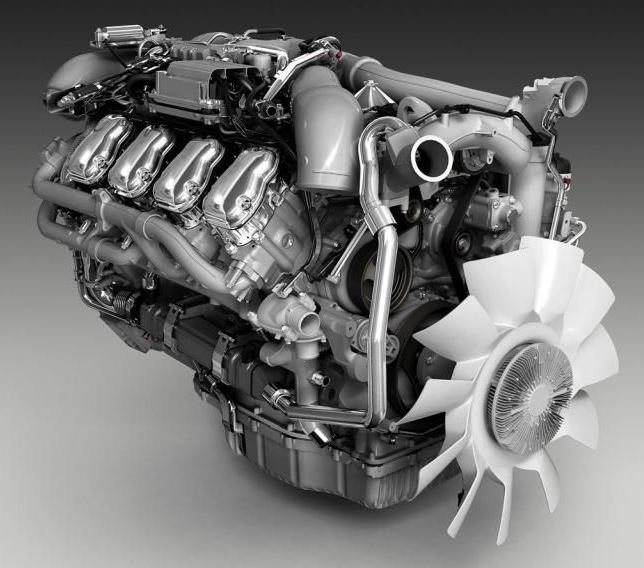 Beim
Beim
 Der
Der
 So
konnte eine
So
konnte eine
 Der
so aufgebaute
Der
so aufgebaute
 Der
neu ausgelieferte
Der
neu ausgelieferte
 Mit
einem neuen
Mit
einem neuen