|
Der Triebwagen CFm 2/4 Nr. 1691 |
|||||||||||
| Navigation durch das Thema | |||||||||||
|
Baujahr: |
1925 |
Leistung: |
220 kW / 299 PS | ||||||||
|
Gewicht: |
61 t |
V. max.: |
75 km/h |
||||||||
|
Normallast: |
20 t |
Länge: |
20 300 mm |
||||||||
|
Mit dem Modell CFm 2/4 kommen wir zum ersten vierachsigen
Fahrzeug. Mit dem grossen Bruder kam auch ein neuer Motor. Fuhr man bisher
mit
Benzin,
weil dort die Motoren weiter entwickelt waren, kam nun auch das
Dieselöl
zur Anwendung. Mit diesem
Treibstoff
gab es weniger Gefahren, denn der Flammpunk lag hoch und so konnte
ausgelaufener
Diesel
nicht so leicht in Brand geraten, wie das beim Benzin der Fall war.
So oblag es der Firma Sulzer den
Dieselmotor
zu liefern. Von der BBC wurde die elektrische Ausrüstung bereit ge-stellt.
All das wurde in einem Fahrzeug eingebaut, das von der Firma SIG in
Neuhausen geliefert wurde. Auch bei
Triebwagen
traten hier
Wagenbauer
auf.
Keine grossen Neuerungen gab es beim Aufbau des Kastens. Es war
ein tragender Rahmen vorhanden, der aus einzelnen Blechen vernietet wurde.
Die beiden Längsträger wurden innerhalb und am Ende mit Querträgern
versehen. Die am Ende verbauten Teile wurden zu dem als
Stossbalken
ausgebildet. An diesem wurden dann die üblichen Zug- und
Stossvorrichtungen
montiert. Daher gab es hier wieder die alten
Stangenpuffer.
Um dem Rahmen leichter und dennoch tragfähig zu halten, war dieser
mit einem
Sprengwerk
versehen worden. Mit diesem konnten die Kräfte aufgefangen werden und das
war gerade im Bereich des
Dieselmotors
wichtig, weil er ein grossen Gewicht aufwies und weil hier auch der Rahmen
in der Breite angepasst werden musste. Es war also trotz dem über 20 Meter
langen Fahrzeug nicht so viel Platz vorhanden, wie man meinen könnte.
Der Aufbau bestand aus einem Gerippe aus
Holz. Auf diesem wurden dann die
Bleche als Verkleidung montiert. Hier kamen Lösungen aus Aluminium zur
Anwendung. Das leichte Metall sorgte dafür, dass der
Triebwagen leicht
genug wurde. Zum einen war das wegen der geringen
Leistung des Motors,
aber auch wegen den
Achslasten auf
Nebenstrecken wichtig. Sie sehen, man
musste auch hier sparen und das ging bei den Blechen sehr gut.
Wenn wir die einzelnen Zonen anhand der Ausrichtung definieren, dann beginnt alles beim ersten Führerstand.
An diesen gliederten sich dann
die Abteile für die Reisenden an. Der
Maschinenraum trennte diese
schliesslich noch vom
Gepäckabteil mit dem zweiten
Führerstand.
Jeder
Führerstand verfügte über eigene Zugänge. Die-se waren analog zu den
anderen elektrischen
Trieb-wagen aufgebaut worden. Hier zeigte sich, dass
bei den Kabinen oft einfach ein bestimmtes Muster gebaut wurde und das man
an die Fahrzeuge baute. So waren auch hier die Zugänge in der
Front
vorhanden und wie bei solchen Modellen üblich, sass der Lokführer und das
erst noch auf der linken Seite, wo auch die Signale stehen.
Der Bereich für die Fahrgäste teilte sich in zwei Abteile auf, die mittig
den Einstieg mit der Treppe hatten. Auch hier gab es zu den anderen
Baureihen keine grossen Unterschiede. Im Abteil nach dem
Führerstand
konnten sich 30 nicht rauchende Fahrgäste auf den üblichen Holzbänken
niederlassen. Im Abteil für die Raucher konnten sich hingegen nur 20
Personen setzen. Damit gab es immerhin 50 Sitzplätze, wenn auch eng
aufgestellte.
Das WC befand sich in einem Vorraum zum Abteil für Raucher. Es grenzte
somit den Bereich für die Fahrgäste vom anschliessenden
Maschinenraum ab.
Dieser wurde wegen den Abmessungen des
Dieselmotors benötigt. Auch das
Gewicht musste so platziert werden, dass die
Achslasten stimmten. Über dem
Drehgestell
war der Zugang von unten nicht möglich. So war es der einzige
Ort, wo der Maschinenraum angeordnet werden konnte.
Damit sind wir aber bereits beim zweiten
Führer-stand angelangt. Der
entsprach jenem auf der anderen Seite. Speziell war eigentlich das Dach
über dem
Maschinenraum, denn nur dort konnte es entfernt werden. Wenn wir nun zu den Drehgestellen kommen, dann finden sich hier die geringsten Neuerungen. Es wurden schlicht die gleichen Modelle verbaut, wie sie schon beim Motorwagen Fe 4/4 verwendet wur-den. Bei einem Einzelgänger, wie dieses Muster eins sein sollte, suchte man nach vorhandenen Bauteilen, die man nutzen konnte.
Hier waren es die beiden
Drehgestelle. Der Unter-schied bestand nur darin, das nur das vordere mit
Antrieben versehen wurde.
Auch keine Änderung ergab es bei den
Blattfedern und den von den
Tender
genommen
Gleitlagern. Bei den einzelnen
Achsen wurden mit
Radreifen
versehene
Scheibenräder verwendet. Diese hatten einen Durchmesser von 1040
mm erhalten. Somit waren auch hier die Bauteile des Musters verwendet
worden. Der CFm 2/4 hatte eigentlich nur einen anderen Kasten und einen
Dieselmotor. Es wurde auch nur ein
Drehgestell angetrieben.
Die Abstützung erfolgte über Wiegebalken mit quer zur Fahrrichtung
eingebauten
Blattfedern. Diese Lösung erlaubte es, die einzelnen Radlasten
auszugleichen. Wegen dem schweren
Dieselmotor wurde das zweite
Drehgestell
nicht mit
Fahrmotoren versehen. Zudem konnte mit den elektrischen Motoren
mehr
Leistung erzeugt werden, als der Dieselmotor liefern konnte. Mehr
Triebachsen hätten schlicht keinen Vorteil ergeben.
Das
Getriebe hatte
eine
Übersetzung von
1:4.24 erhalten und es musste hier wegen dem
Dieselelektrischen Aufbau nicht geschaltet werden. Wirklich neu war daher
nur der
Dieselmotor und zu dem kommen wir später. Es versteht sich, dass bei den Drehgestellen der Triebwagen Fe 4/4 auch deren Bremsen verbaut wurden. Trotzdem gab es hier Unterschiede. Geblieben waren nur die zwei Bremsklötze pro Rad.
Deren Abnutzung wurde mit einem
automatischen
Gestängesteller nachge-stellt. Das war neu, denn bisher gab
es nur manuelle Lösungen und somit zeigt sich auch hier der
Versuchsträger, auch wenn das nicht so gut zu erkennen war. Die pneumatischen Bremsen wurden vereinfacht. So wurde schlicht auf die direkte Regulierbremse verzichtet. Es kam also nur die automatische Westing-housebremse zum Einbau.
Das dabei verbaute
Steuerventil war
einlösig und verlangte bei der Bedienung der
Bremsen eine gewisse
Sorgfalt. Im Notfall konnte aber in jedem
Führerstand noch die
Handbremse
angezogen werden. Trotzdem war die Bedienung der Bremsen nicht leicht.
Bisher gab es keine grossen Verbesserungen, denn auch hier wurde in erster
Linie der
Antrieb erprobt. Da es hier kein passendes Muster gab, musste
neu gebaut werden und dabei nahm man das von bekannten
Baureihen, die
gerade im Bau waren. Hier war das der ganz gut zu diesem Fahrzeug passende
Triebwagen der Baureihe
Fe 4/4, der viele Teile beisteuerte und dabei den
grössten Vorteil der
Fahrleitung zeigte, denn die
Leistung war viel höher.
Insgesamt waren acht
Zylinder vorhanden,
die in V-Anordnung eingebaut wurden. Zur
Kühlung der stark belasteten
Bauteile wurde das bei sol-chen Motoren übliche
Kühlwasser verwendet.
Dieses wiederum wurde durch thermische Effekte gekühlt. Speziell war der Start des Motors. Für diesen waren Bleibatterien mit einem Gewicht von 1.2 Tonnen verbaut worden. Ab diesen wurde der Generator so erregt, dass er als Motor arbeitete und die Kurbelwelle sich drehte.
Dadurch startete der Motor und der
Starter wurde nicht mehr benötigt. Da
zu Beginn noch nicht alle
Zylinder korrekt arbeiteten, wurde der
Triebwagen regelrecht durchgeschüttelt. Das erfolgte auch beim abstel-len.
Die
Abgase gelangten durch einen
Sie sehen noch achtete man nicht auf den Lärmschutz, der
sollte erst mit den grösseren Motoren kommen. Der
Versuchsträger war dank
dem
Direkt am
Dieselmotor angeschlossen war der fremderregte
Generator. Dieser
war für eine
Spannung
von 750
Volt
Gleichstrom ausgelegt worden. Damit
haben wir eine
Dieselelektrische Ansteuerung bekommen und das war der
grösste Unterschied zu den bisher vorgestellten Lösungen mit einem Motor
für
Benzin. Es war also auch in dem Punkt eine Erprobung, denn es wurde
auch mit der Regelung der
Zugkraft experimentiert.
Alle weiteren Stufen wurden mit
Widerständen geschaltet. Das
war damals bei Bahnen mit
Gleichstrom eine übliche Lösungen und es zeigte
sich hier, dass mit nur zwei Motoren nicht viele wirtschaftliche Lösungen
möglich waren. Der Triebwagen war für die einmännige Bedienung ausge-legt worden. Das umfasste das Totmannpedal. Die hier verbaute Lösung gab nach einer bestimmten Zeit eine Warnung aus.
Wurde nicht reagiert, erfolgte eine
Zwangsbremsung. Soweit entsprach sie der heute üblichen Lösung. Jedoch war
sie bei Geschwindigkeiten unter 20 km/h nicht aktiv. Damit sollte sich die
Einrichtung im
Rangierdienst nicht als störend auswirken. Geheizt wurde der Triebwagen mit dem Kühlwasser des Dieselmotors. Da dieses jedoch erst nach einiger Zeit warm genug war, konnten die Abteile auch elektrisch geheizt werden.
Dazu wurden schlicht die auf dem Fahrzeug
verbauten
Batterien genommen. Wie oft diese durch die
Heizung entleert
wurden, ist nicht überliefert worden. Es kann aber angenommen werden, denn
für die Heizung wird viel Energie benötigt.
Neben den schon erwähnten
Starterbatterien gab es auch die normalen
Bleibatterien für die Steuerung und die
Beleuchtung. Wie in der Schweiz
üblich waren an der
Front über den
Puffern Laternen montiert. Da die
Kabine von den
Triebwagen
Fe 4/4 stammte, war die obere Lampe auch hier in
der Front eingelassen worden. Dennoch konnten alle
Signalbilder gezeigt
werden und diese wurde gerade auf
Nebenstrecken noch benötigt.
Oft wurde dann auch gleich der
Generator erneuert. Die sich auf die
Dieselmotoren beschränkten Umbauten,
zeigten, dass mit dem Fahrzeug auch neue Techniken erprobt wurden. Es
blieb daher immer ein spezielles Fahrzeug.
Beim zweiten eingebauten Motor handelte es sich um einen
Zweitaktmotor.
Weiterhin konnte dieser mit
Dieselöl betrieben werden. Durch die
verbesserten Techniken konnte die
Leistung des Fahrzeuges auf einen Wert
von 250 kW, oder 400 PS gesteigert werden. Höher sollte sie jedoch nie
mehr werden, denn der Motor war zumindest in dem Punkt gut aufgestellt.
Die höhere Leistung wurde natürlich unverzüglich genutzt.
So konnte nun die
Höchstgeschwindigkeit auf 90 km/h gesteigert werden.
Dazu waren noch ein paar kleinere Anpassungen erforderlich, die bei dieser
Gelegenheit eingebaut wurden. Der nachfolgende Betriebseinsatz wird der
Grund für diese umfangreichen Arbeiten liefern. Denn auch dieser
Dieselmotor sollte nicht bis zum Ende der Karriere im
Triebwagen verbaut
bleiben, denn wenn man einen
Versuchsträger hat, dann nutzt man diesen.
1951 kam dann der dritte Motor. Diesmal war es wieder ein Modell mit vier
Takten. Zudem wurde die
Leistung auf 220 kW gemindert. Da die elektrischen
Motoren nicht mit üppiger Leistung versehen wurden, war das eine
Anpassung, denn nun gab es deutlich mehr bei gleicher Grösse. Wegen der
geringeren Leistung wurde wieder mit 75 km/h gefahren. Wobei diese Werte
in den meisten Fällen auch nur auf dem Papier bestanden.
Niemand wusste genau, wie sich das Fahrzeug verhalten würde.
Bei einer Präsentation wird kaum alles bereits ausgereizt. Dazu hat man ja
die nachfolgenden
Probe-fahrten. Speziell war eigentlich nur der Start in
Walli-sellen. Mit den Versuchsfahrten kam der Triebwagen auch zur Linie über den Hauenstein. Die dort vorhandenen Steig-ungen waren mit jenen des Gotthards zu vergleichen. Das bei einem deutlich geringeren Verkehrsaufkommen.
Man
schreckte also auch vor
Bergstrecken nicht zurück und noch spannender wird
es, wenn wir zum ersten
Depot kommen, denn dort würde man einen
Triebwagen
mit
Dieselmotor wirklich nicht so schnell vermuten. Nach den Versuchen wurde der Triebwagen dem Depot Brugg zugeteilt. Dort wurde er auf der Strecke über Lenz-burg nach Wohlen eingesetzt. Durchaus eine Nebenbahn mit geringen Zahlen bei den Fahrgästen.
Jedoch wurde die
Strecke auch für die Züge in Richtung Gotthard benötigt und daher waren
vermutlich die ersten Masten bereits gestellt, als der CFm 2/4 seine Reise
nach Wohlen angetreten hat. Trotzdem blieb er dort lange stationiert.
Im Jahre 1938 kam es dann zur Versetzung. Der
Triebwagen wurde neu dem
Depot Winterthur zugeteilt. Dort verkehrte er auf der Strecke von Koblenz
über Winterthur und Etzwilen nach Singen am Hohentwiel. Speziell dabei
war, dass die Strecke von Etzwilen nach dem Deutschen Singen nie mit einer
Fahrleitung versehen werden sollte. Hier wurde der Verkehr eingestellt und
die Strecke zu einem
Anschlussgleis degradiert.
Für die Schweiz hatte das jedoch zur
Folge, dass die
Treibstoffe knapp wurden. Wegen dem Mangel wurde der
Triebwagen bis 1945 abgestellt und in der Zeit auch beschlossen, dass
Nebenstrecken vollständig mit der
Fahrleitung versehen werden sollten. Nach dem zweiten Weltkrieg kam der Triebwagen in den Süden des Landes und somit nach Bellinzona. Auch wenn die Gotthardstrecke schon seit Jahren elektrisch befahren wurde, galt das nicht für die Nebenstrecke nach Luino.
Dort regierten immer noch die
Dampfmaschinen und dazwischen sollte der
CFm 2/4 seine Eignung unter Beweis stellen. Die moderaten Steigungen kamen
ihm dabei sogar noch entgegen. So richtig durchsetzen konnte sich der Einzelgänger jedoch nicht. Er war für den Einsatz unzuverlässig und anfällig auf Störungen.
Im Tessin war
man sich daher schnell sicher, das Teil wird abgestellt. Bereits 1946 war
sich in dem Punkt auch das Direktorium in Bern sicher. Der
Versuchsträger
wurde jedoch nicht abgebrochen, sondern nur in einer
Remise versteckt.
Dort wartete er auf 1951 und den dritten Motor.
1951 mit dem dritten Motor, wurde das offiziell dem
Depot Bern zugeteilte
Fahrzeug im Raum Genève eingesetzt. Dort war nun klar, die Strecke nach
Frankreich wird nicht mit
Wechselstrom aus der Schweiz betrieben. Der
Triebwagen sollte die Cholis ersetzen. Jedoch war damit bereits 1952
Schluss. Der zu einem Wagen umgebaute CFm 2/4 war damit Geschichte.
Endgültig fertig war es aber erst 1989, als auch der Wagen verschrottet
wurde.
|
|||||||||||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |||||||||
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | ||||||||
|
Copyright 2025 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||||||||||
 Bestellt
wurde der für den alleinigen Einsatz auf Strecken ohne
Bestellt
wurde der für den alleinigen Einsatz auf Strecken ohne
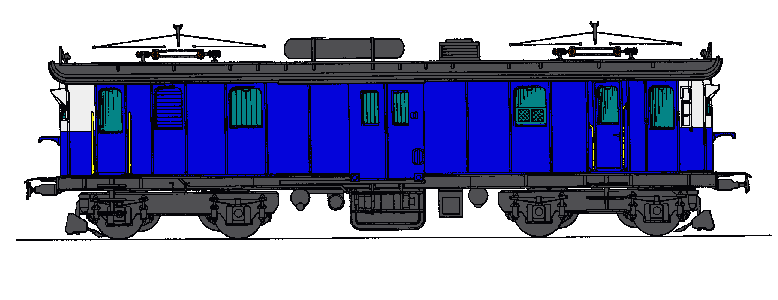 Der Kasten teilte sich in vier Bereiche auf. Das waren die beiden
Der Kasten teilte sich in vier Bereiche auf. Das waren die beiden
 Abschliessen können wir den Durchgang mit dem
Abschliessen können wir den Durchgang mit dem 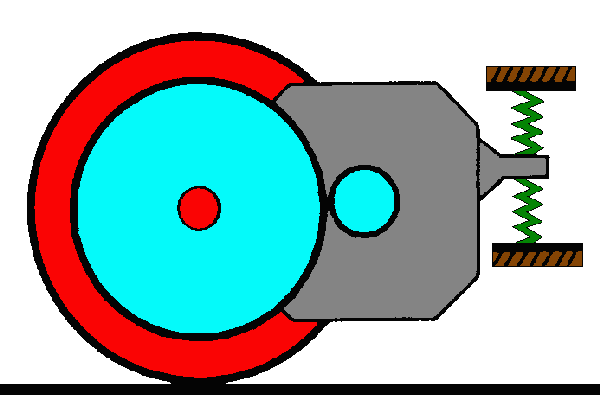 Wie beim
Wie beim
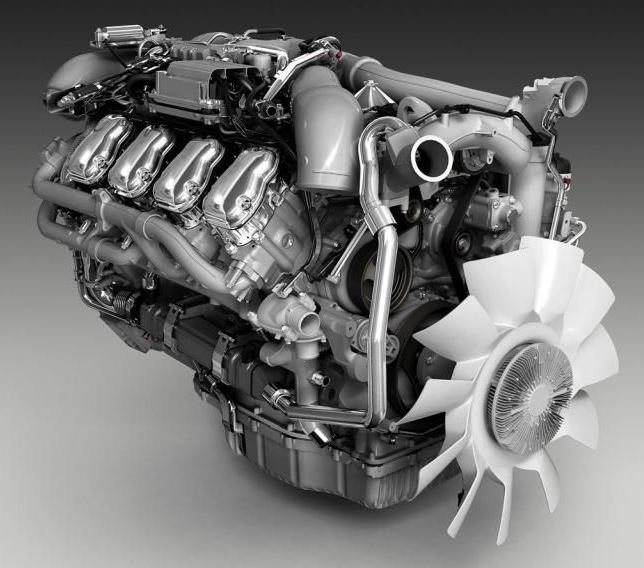 Das Herzstück des
Das Herzstück des
 Geregelt wurden die beiden im
Geregelt wurden die beiden im
 Im Gegensatz zu den Modellen mit
Im Gegensatz zu den Modellen mit
 Die Karriere des CFm 2/4 begann am 19. Februar 1925. Bei einer
Präsentation fuhr der
Die Karriere des CFm 2/4 begann am 19. Februar 1925. Bei einer
Präsentation fuhr der
 Lange sollte dieser Einsatz jedoch nicht dauern. Mit dem Überfall auf
Polen begann der Krieg, der mit seinen Gräueltaten an der Menschheit in
die Ge-schichte eingehen sollte.
Lange sollte dieser Einsatz jedoch nicht dauern. Mit dem Überfall auf
Polen begann der Krieg, der mit seinen Gräueltaten an der Menschheit in
die Ge-schichte eingehen sollte.