|
Druckluft und Bremsen |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Druckluft
wurde auf den
Lokomotiven zu einem Thema, als die damit betriebenen
Bremsen
eingeführt wurden. Bei den Dampflokomotiven waren dazu die üblichen
Luftpumpen
vorhanden. Diese konnten hier schlicht nicht mehr verwendet werden, da es
keinen Dampf gab. Zudem konnte diese komprimierte Luft auch für andere
Funktionen genutzt werden. Man musste sie erzeugen, also nutzte man diese
auch auf dem Fahrzeug.
Bei diesem
Kompressor
wurde wie bei den
Luftpumpen
mit Hilfe eines
Kolbens
Luft in eine Leitung geschöpft. Einzig der
Antrieb
erfolgte nun mit einem entsprechenden Motor. Die von den Kompressoren geschöpfte Luft gelangte in die zwischen den beiden Drehgestellen montierten Hauptluft-behälter. In dieser Leitung waren ein Bauteil vorhanden, das Ölabscheider genannt wurde.
Dieses entnahm der
Druckluft
die allenfalls ausgeschieden Feuchtigkeit. Da vom
Kompressor
auch ein Verlust des
Öls
zu erwarten war, wählte man den Namen so, denn noch war die
Schmierung
das Problem.
Verwendet wurden die beiden
Hauptluftbehälter
als zusätz-liches Volumen, aber auch zur Speicherung des Vorrates. So
lange die
Kompressoren
liefen und der Bezug im System geringer war, stieg der Wert beim
Luftdruck
an. Da der Motor nicht einfach stillstehen durfte, wenn der maximale Druck
erreicht wurde, musste verhindert werden, dass zu hohe Werte erreicht
wurden. Zudem konnten auch die Leitungen bersten.
Der
Luftdruck
wurde daher durch ein in der Zuleitung verbautes
Überdruckventil
beschränkt. Dieses war so eingestellt worden, dass es bei einem Wert von
über acht
bar
öffnete und so die Luft wieder ins Freie gelangte. Der Luftdruck konnte
daher nicht weiter ansteigen. Im Betrieb war aber eine andere Regelung
vorhanden, diese arbeitete mit dem aktuellen Vorrat und diese beeinflusste
die Steuerung, daher kommen wir dort dazu.
Sowohl in der Zuleitung, als auch in den abgehenden Leitungen
waren dazu spezielle
Absperrhähne
verbaut worden. Waren die-se geschlossen, blieb die
Druckluft
im Behälter gespeichert und konnte später wieder genutzt werden. Das war
hier sehr wich-tig. Von den beiden Hauptluftbehältern gelangte die Druckluft in eine gemeinsame Apparateleitung. Diese stand den Verbrauchern auf der Lokomotive zur Verfügung. Eine Leitung, die zu den Stoss-balken geführt worden wäre, gab es nicht.
Zudem war der
Luftdruck
auch nicht geregelt worden und er entsprach den Werten in den
Hauptluftbehältern.
Mit den Ver-brauchern an dieser Leitung kommen wir auch gleich zu einem
Problem. An der Apparateleitung waren nun auch Bauteile der elektrischen Ausrüstung angeschlossen worden. Zu diesen gehörte zum Beispiel der Stromabnehmer. Dieser konnte nur gehoben wer-den, wenn genug Druckluft vorhanden war.
Fehlte diese, konnte die
Lokomotive nicht eingeschaltet und damit auch keine
Druckluft
erzeugt werden. Es musste daher eine von den
Kompressoren
unabhängige Lösung gefunden werden.
Für diesen Fall bediente man sich den Pumpen für Fahrräder. Auf
der
Lokomotive wurde so eine eingebaut und als
Handluftpumpe
bezeichnet. Mit dieser konnte von Hand die
Druckluft
für die
Stromabnehmer
erzeugt werden. Berührten diese den
Fahrdraht
konnte die Lokomotive eingeschaltet und die Druckluft mit den normalen
Kompressoren
erzeugt werden. Eine einfache, aber sehr effiziente Lösung, die nicht
allen gefiel.
Eine davon gab es bereits bei den Dampflokomotiven. Im Fall der
Lokpfeife
wurde diese bisher mit Dampf und nun mit
Druckluft
betrieben. Vom Aufbau her ergab sich bei der
Pfeife
jedoch kein Unterschied. Beim Laufwerk haben wir die Sandstreueinrichtung kurz angeschnitten. Diese war hier vorhanden und sie wurde nach den Regeln der neusten Dampfloko-motiven erstellt.
Der in einem Behälter im
Maschinenraum
gelagerte
Quarzsand
wurde durch Leitung auf die
Schienen
vor der
Lauffläche
gelassen. Das erfolgte immer bei der vorlaufenden
Triebachse eines
Drehgestells. Die dazu erforderliche Um-schaltung wurde mit
einem
Ventil
verwirklicht. Mit diesem Ventil gelangte Druckluft in die Leitung. Diese beschleunigte in der Folge den Quarzsand und dieser wurde nach dem Verlassen des Rohres im Bereich vor dem Rad auf den Schienen verteilt.
So war eine bessere Wirkung vorhanden. Dies obwohl hier grosse
Diskus-sionen wegen dem Sinn dieser Einrichtung geführt wurden, denn hier
gab es ja keine
Schlemmhähne,
welche die
Schienen
mit Dampf benässten.
Damit haben wir bereits die wichtigsten Verbraucher der
Druckluft
kennen gelernt. Es bleibt nur noch der Grund, warum diese auf der
Lokomotive überhaupt vorhanden waren, denn all die
erwähnten Lösungen hätten auch anders geregelt werden können. Jedoch ging
das nicht bei den in Europa vor Jahren eingeführten pneumatischen
Bremsen.
Diese
Druckluftbremsen
kamen damals immer mehr auch im
Güterverkehr
zur Anwendung.
Diese endete bei den für die Bedienung wichtigen
Ventilen.
Damit war in der Zuleitung maximal ein Wert von acht
bar
vorhanden, dass für die hier verbauten
Bremsen
ausrei-chend bemessen war. Das erste Bremssystem, das wir uns ansehen, ist die im Aufbau sehr einfache direkte Bremse. Für die Bremsung wurde von einem Bremsventil Druckluft in die Zuleitung zum Bremszylinder geleitet.
Da hier die
Bremskraft
sehr einfach eingestellt, bezieh-ungsweise reguliert werden konnte, nannte
man diese
Bremse
auch
Regulierbremse.
Der vom
Ventil
maximal erzeugbare
Luftdruck
in der Leitung lag bei dieser
Bauart
bei 3.5
bar.
Näher ansehen müssen wir uns bei der
Regulierbremse
die Leitung, denn diese wurde zu den beiden
Stossbalken geführt. Dort wurde sie geteilt und sie
stand mit zwei
Luftschläuchen
mit
Absperrhahn
auch der
Anhängelast
zur Verfügung. So konnte mit dem Zug die Geschwindigkeit auf Talfahrten
genau eingehalten werden. Durch die direkte Wirkung war es auch das
Bremssystem, das im
Rangierdienst
angewendet wurde.
Es muss jedoch erwähnt werden, dass die
Regulierbremse
auch bei den für die schweren
Güterzüge
gedachten
Lokomotiven verbaut wurde. Deren Wagen besassen keine
Regulierbremse und daher wirkte sie nur auf der Lokomotive. Die Leitung
zeigten jedoch, dass beim Bau dieser Lokomotive bereits davon ausgegangen
wurde, dass es zu Einsätzen vor
Reisezügen
kommen könnte. In dem Fall waren die Leitungen wichtig.
Dabei handelte es sich um den noch fehlenden Teil der
Doppelbremse. Sie wurde nach dem Entwickler benannt und daher sprach man
in diesem Zusammenhang auch von der
Bremse
nach
Bauart
Westinghouse. Um diese Westinghousebremse zu lö-sen und um die Betriebsbereitschaft zu bekommen, musste eine als Hauptleit-ung bezeichnete Leitung mit einem Luftdruck von fünf bar gefüllt werden.
Diese erfolgte durch ein
Bremsventil,
das diesen Druck einhalten konnte, aber auch für eine geordnete Absenkung
sorgen konnte. Das war wichtig, weil die
Westinghousebremse
mit dem abfallenden
Luftdruck
in der
Hauptleitung
angezogen wurde.
Bevor wir zur Wirkung kommen, müssen wir uns diese
Hauptleitung
noch genauer ansehen. Auch sie wurde zu den beiden
Stossbalken geführt und dort geteilt. Es waren ebenfalls
Absperrhähne
mit
Luftschläuchen
vorhanden. Um zu verhindern, dass diese Leitung mit der
Regulierleitung
vertauscht werden konnte, waren am Schlauch andere
Kupplungen
vorhanden. Diese waren so aufgebaut worden, dass sie auch unter Druck
geöffnet werden konnten.
Hier sprach man von einer indirekten
Bremse,
weil der
Bremszylinder
nicht durch die
Hauptleitung
angesteuert werden konnte. Der Grund war, dass dieser mit steigendem
Luftdruck
mehr Kraft erzeugen konnte. Die Leitung verstärkte die
Bremsung
jedoch mit einem fallenden Luftdruck. Damit das funktionierte, musste in
die Zuleitung ein
Steuerventil
aus dem Hause
Westinghouse
verwendet werden. Davon rührte auch der Name.
Die
Bremsung
wurde so eingeleitet und maximal konnte im
Bremszylinder
ein
Luftdruck
von 3.9
bar
erzeugt werden. Dazu musste die Absenkung in der
Hauptleitung
jedoch mehr als 1.5 bar betragen. Eine weitere Reduktion er-zeugte jedoch
keinen höheren Druck. Die als Einströmzeit bezeichnete Zeit, bis der erforderlich Luftdruck erreicht war, konnte eingestellt werden. Dazu waren an einem Umstellhahn die Stellungen für die normale Personenzugsbremse und für die G-Bremse vor-handen.
Wurde die
Güterzugsbremse
angewendet, erfolgte die Zeit länger bis der Druck erreicht war. Befand
sich der Um-stellhahn in einer zweifelhaften Position wirkte in jedem Fall
die
P-Bremse.
Wurde hingegen der
Luftdruck
in der
Hauptleitung
wieder erhöht, steuerte das
Ventil
erneut um und löste die
Brem-se
vollständig. Dabei spielte es keine Rolle, ob nur ein leichter Anstieg
vorhanden war, oder ob der Regeldruck erreicht wurde. Man sprach deshalb
bei diesem
Steuerventil
von einer einlösigen Variante und diese war damals üblich. Da mit der
Bremse jedoch nicht die Geschwindigkeit reguliert wurde, war das kein
Problem.
Es spielte für den
Bremszylinder
keine Rolle, von welcher
Bremse
die
Druckluft
kam. Dazu war in der Zuleitung ein spezielles
Ventil
vorhanden, das immer den grössten
Luftdruck
zuführte. Daher konnte die
Regulierbremse
ohne Probleme durch die
Westinghousebremse
übersteuert werden. Ein Punkt, der dazu führte, dass hier von einer
Doppelbremse nach
Westinghouse
gesprochen wurde. Die Maschine hatte normale Bremsen.
Seit einem Unfall in Brig war vorgeschrieben worden, dass Lokomotiven nur alleine in einem starken Gefälle fahren durften, wenn sie über ein geteiltes Brems-gestänge verfügten.
Die weitere Forderung werden wir erst bei der elek-trischen
Ausrüstung kennen lernen. Hier war die Teilung wichtig. Durch den Bremszylinder, aber auch durch die im benachbarten Führerstand montierte Handbremse, wur-de ein Bremsgestänge bewegt. Da jeder Führerstand über eine von Hand bediente Spindelbremse verfügte, konnten damit sämtliche ge-bremsten Achsen angezogen werden.
Da mit der
Feststellbremse
jedoch nicht die normalen Kräfte erreicht wurden, galten hier spezielle
Regeln für die Abstellung. Jedoch reichte diese Lösung für das gesamte
Netz.
Am
Bremsgestänge
war eine normale
Klotzbremse
angeschlossen worden. Diese wirkte bei jeder
Triebachse
mit einem
Bremsklotz
auf die
Laufflächen.
Wie in der Schweiz üblich, waren die beiden
Laufachsen
nicht mit einer
Bremse
versehen worden. Der Grund lag bei den auf den Triebachsen möglichen
höheren Werten für die
Bremskraft.
Die Laufachse wäre blockiert, was hier leicht erfolgen konnte, da sie ja
nur eine geringe
Achslast
hatte.
Die auf die
Lauffläche
wirkenden
Bremsklötze
hinderten das
Rad
an der freien Drehung. Durch die Reibung entstand grosse Wärme, die aber
durch die aus Grauguss gefertigten Klötze abgeführt wurde. Da dabei an den
Bremsklötzen auch eine Abtragung des Materials erfolgte, wurde der Weg bis
zu Lauffläche immer grösser. Das konnte dazu führen, dass die
Bremse
schlicht nicht mehr wirksam war und nicht gebremst werden konnte.
Die dazu erforderlichen Arbeiten erfolgten während des regulären
Unterhalts und wurden auch vorgenommen, wenn die Lokführer nach der Fahrt
im
Depot
eine unge-nügende
Bremskraft
bemängelten. Wurde die Druckluft wieder aus dem Bremszylinder ent-fernt, wirkte auf die Bremsklötze keine Kraft mehr. Zumindest galt das, wenn die Handbremsen in den Führer-ständen nicht angezogen waren.
Alleine durch diese Lösung blieben die
Bremsklötze
jedoch auf dem
Rad
und so war trotz der geringen Reibung eine Abnutzung vorhanden. Daher
musste eine Lösung gefun-den werden und diese befand sich bei den
Bremszylindern. Bei jedem Bremszylinder war eine Feder vorhanden. Diese Rückholfeder sorgte nun dafür, dass auch das Bremsge-stänge so bewegt wurde, dass sich die Bremsklötze vom Rad entfernten.
So erfolgte kein Wärmeeintrag mehr und die Klötze konn-ten bis zur
nächsten
Bremsung
abkühlen. Jedoch war die
Leistung
der
Klotzbremse
so gut, dass damit ohne grosse Probleme die steilen
Rampen
der Gotthardstrecke
befah-ren werden konnten.
Zum Schluss muss noch erwähnt werden, dass die Ausrüstung der
Bremsen
den alten Dampflokomotiven entsprach. Die einzige Neuerung war alleine das
geteilte Gestänge. Diese war wegen den
starken Gefällen
erforderlich und dazu gehörte auch eine verschleisslose Bremse. Diese
sehen wir uns aber im nächsten Kapitel mit der elektrischen Ausrüstung
genauer an. Wir kommen damit zur Arbeit der Firma BBC.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2024 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Wegen
dem zusätzlichen Bedarf von
Wegen
dem zusätzlichen Bedarf von
 Ich
habe es schon erwähnt, im Gegensatz zu den Dampfloko-motiven wurde hier
die
Ich
habe es schon erwähnt, im Gegensatz zu den Dampfloko-motiven wurde hier
die
 Mit
der
Mit
der
 Verbaut
wurde eine Doppelbremse nach
Verbaut
wurde eine Doppelbremse nach
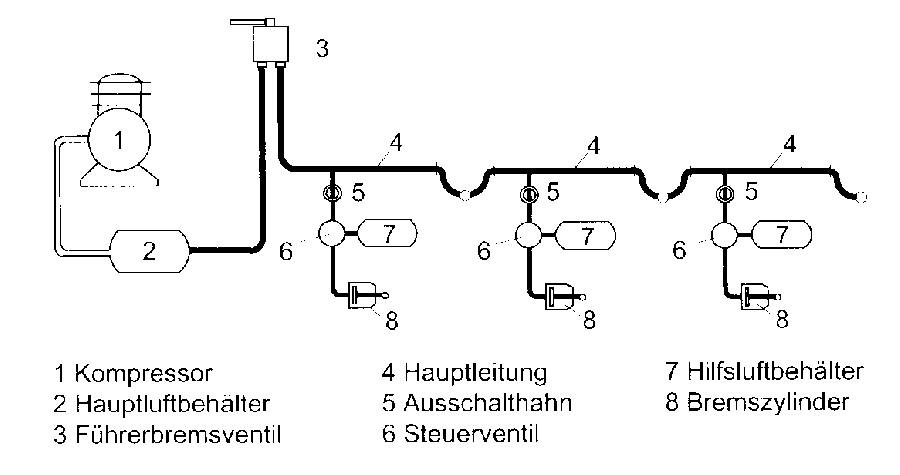 Ungeeignet
war die
Ungeeignet
war die
 Wurde
der
Wurde
der
 Bedingt
durch die beiden
Bedingt
durch die beiden
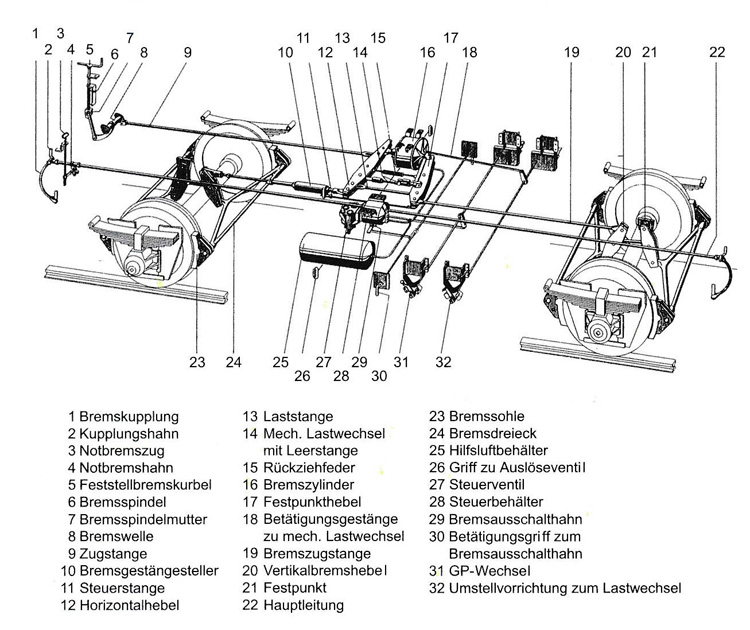 Aus
diesem Grund war im
Aus
diesem Grund war im