|
Inbetriebsetzung |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Die
Inbetriebsetzung
von
Lokomotiven hatte sich im Lauf der Jahre immer wieder
verändert. So wurden diese anfänglich nur in sehr bescheidenem Rahmen
ausgeführt. Mittlerweile werden jedoch oft umfangreiche
Testfahrten
durchgeführt. Besonders grössere Gesellschaften führten viele Versuche
durch, um zu erfahren, ob das neue Fahrzeug den Ansprüchen gerecht wird.
Auch bei der Baureihe Am 841 sollten daher viele Versuche angestellt
werden.
Doch gerade die Anpassungen an die
Normalspur
waren Ver-änderungen, die viel auswirken konnten. Was auf
Breitspur
klappt, muss auf dem schmaleren
Gleis
nicht unbedingt auch funktionieren. Wie bei jedem neuen Fahrzeug führte der
Hersteller eine Endkontrolle durch. Diese umfassten immer wieder die
gleichen Punkte. So wurde kontrolliert, ob es überhaupt möglich ist, die
Lokomotive in Betrieb zu nehmen. Danach wurden einige Tests
auf einem kurzen
Geleise
durchgeführt. Diese ersten Gehversuche waren meist auch der Abschluss für
die Arbeiten im Werk. Dabei blieben jedoch noch viele Fragen offen und die
waren hier noch umfangreicher. Die fertige
Lokomotive musste wieder zerlegt werden. Zwar nur in
einigen Punkten, aber ohne diese Demontage war der Transport nicht
möglich. Wir haben früher schon erfahren, wie aufwendig der Transport von
Spanien in die Schweiz war. Danach ging es wieder in ein Werk, wo das
Fahrzeug erneut komplettiert wurde. Damit stellten sich gleich weitere
Frage, die nicht unbedingt leicht zu beantworten waren und die daher Zeit
beanspruchten. Wir erinnern uns, bei der Baureihe
Re 4/4 II wurde ein
spezieller Zug mit drei neuen
Lokomotiven bespannt. Jede davon wurde in einem anderen
Werk gebaut. Niemand konnte sicher sein, dass es mit der korrekten
Umsetzung der Pläne geklappt hatte. Besonders bei der in Meyrin montierten
Maschine war man sich nicht sicher, ob die Anweisungen richtig übersetzt
worden waren. Ein Punkt, der auch hier zu grösseren Problemen führen
konnte.
Selbst die neuen Handbücher mussten in
dieser Sprache verfasst werden. Die beiden anderen Spra-chen in der
Schweiz, war dann nicht mehr direkt das Problem des Herstellers in
Spanien. Gerade das Problem mit den Sprachen war nicht zu unterschätzen. Zwar gab es durchaus Leute, die ohne Probleme beide Sprachen beherrschten. Je-doch waren in den Dokumenten auch Fachbegriffe enthalten und bei denen war es schwer. Je nach Sprache konnten diese eine ganz
andere Bedeutung haben. In der Folge benötigte man Fach-leute, die beide
Sprachen kannten. In diesem Punkt, wurde die Auswahl bereits deutlich
geringer. Am 31. Mai 1996 traf mit der Nummer 841 000-3 die erste Maschine der Baureihe Am 841 in Win-terthur ein. Dort wurden in den Hallen der
Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik SLM die entfernten
Baugruppen wieder montiert und die beiden
Drehgestelle
auch noch elektrisch angeschlossen. Damit war auch diese Endmontage
beendet und die
Diesellokomotive
konnte erneut geprüft werden. Auch jetzt musste geklärt werden, ob alles
funktioniert. Mit dem starten des
Dieselmotors
und ein paar Metern Fahrt im Gelände der SLM, war klar, der Transport von
Spanien in die Schweiz hatte funktioniert. Der Weg für die weiteren
Maschinen der Reihe Am 841 war geebnet worden und die restlichen Am 841
sollten über die gleiche Route die Schweiz erreichen. In der Folge musste
am Transportweg und am Aufwand dafür, nichts mehr verändert werden. Die
restlichen
Lokomotiven konnten somit auch auf die Reise geschickt
werden.
Der Grund lag, dass die Bahnen oft sehr
genau wissen wollten, was wie gebaut wurde. Das waren aber oft auch
Punkte, die der Hersteller geheim halten wollte. Die Schweizerischen Bundesbahnen SBB
erhielten daher die erste
Lokomotive der Baureihe Am 841, wie alle weiteren Maschinen
dieses Typs in Winterthur. Dort wurde die
Diesellokomotive
von den Fachleuten den
Staatsbahnen
gleich genaustens untersucht und für die anstehenden Versuche vorbereitet.
Das bedeutete, dass gewisse Messgeräte angebracht wurden. Auf eine
öffentliche Präsentation verzichtete der Kunde jedoch, was aber nicht
überraschend war. Eine Vorstellung eines neuen
Triebfahrzeuges
gegenüber der Fachpresse und der allgemeinen Presse erfolgte in den
meisten Fällen nur bei Modellen, die im direkten Kontakt mit den Kunden
eingesetzt werden.
Lokomotiven für den Rangier- und Baudienst wurden von den
Leuten nicht so sehr wahrgenommen. Daher konnten diese Aktionen
unterlassen werden. Zudem drängte es, denn wie so oft, wurde die Maschine
dringend benötigt. Bevor es auf die ersten Fahrten mit der
neuen
Lokomotive ging mussten jedoch die verbauten
Sicherheitseinrichtungen
geprüft werden. Nur so konnten die Leute, die bei den
Probefahrten
dabei waren, sicher sein, dass diese Einrichtungen einwandfrei und korrekt
funktionierten. Eine Bedingung, die auch in Zukunft jede neue Maschine
dieser Baureihe zu erfüllen hatte. Damit das auch einfach zu erledigen
war, wurden Vorkehrungen getroffen.
Mehrmals musste die neue Maschine über die
Sonden der
Zugsicherung
und
ZUB 121
fahren. In jedem Fall musste die erwartete Reaktion eintreten. Versagte
die Technik, ging es nicht aus dem Werk. Diese ersten Kontrollen konnten teilweise auch im Stillstand erfolgen, da für die verbauten Sicherheitseinrichtungen spe-zielle Prüfprogramme eingebaut waren. Erst als alle Punkte erfolgreich abgeschlossen waren, ging es auf die Strecke. Somit stand die erste eigentliche
Probefahrt
auf dem Pro-gramm. Viele Versuche wurden dabei noch nicht angestellt.
Solange das alleine verkehrende Fahrzeug nicht funktioniert, müssen keine
Wagen mitgenommen werden. Bei diesen Fahrten ging es in erster Linie um das Fahr-verhalten bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Wie stand es mit der Laufruhe bei 80 km/h und wie wurden Weichen befahren. Alles Versuche, die nicht mit einer
umfangreichen
Komposition
gefahren werden. Wobei natürlich die erfassten Parameter später mit Last
zum Teil wiederholt wurden. Gerade die
Lastprobefahrten
waren immer wieder für Wunder gut, wie die Geschichte schreibt. Die Baureihe
Ae 4/6, die es nicht schaffte die
angedachten Wunderlasten zu ziehen, war eine leerreiche Erfahrung. Der Zug
mit
Messwagen
und viel Last stand dann und musste abgeschleppt werden. Ein Szenario, das
man hier verhindern wollte und so nutzten die Fachleute den Umstand, dass
man im Bestand eine gute elektrische
Lokomotive hatte. Diese simulierte Last und im Notfall,
konnte sie auch die Strecke räumen.
So musste bei den nun anstehenden
Probefahrten
die
Versuchsloko-motive
zeigen, was sie leisten konnte. Unterschiedliche Lasten wurden mit der
Regelung der
Bremskraft
simuliert, was bei der Reihe Re 460
gut ging. Bei
Testfahrten
für die elektrische
Widerstandsbremse
der neuen Bau-reihe war es natürlich gerade umgekehrt. Die
Diesellokomotive
musste die munter schiebende Re 460
abbremsen. Da hier grosse Kräfte auf die
Puffer
wirkten, machten man solche Fahrten auf möglichst geraden Abschnitten.
Ideal war dazu die Strecke durch den Kanton Thurgau. Dort gab es knackige
Steigungen und viele gerade Abschnitte, wo man nicht so auf die Kräfte
achten musste. Die
Versuchsfahrten
dienten natürlich nicht nur der Prüfung. Es wurden mit den Fahrten auch
die Lasttabellen für die neue Baureihe festgelegt. Dazu waren umfangreiche
Fahrten nötig und daher dauerte es mehrere Tage, bis die ersten
erfolgreichen Abschlüsse gemacht wurden. Das aus Spanien gelieferte Modell
konnte sich dabei gut in Szene setzen und überzeugte so die Fachleute in
der Schweiz. Ein Meilenstein war erreicht. Für die neue Baureihe wurden die zwei
Lastreihen für
Diesellokomotiven
erstellt. Diese umfassten die
Anhängelasten
auf bestimmten Steigungen und die dabei noch erreichbare Geschwindigkeit.
Im Vergleich zu den anderen Baureihen war die Reihe Am 841 etwas höher
eingereiht als die Baureihe
Bm 4/4. Wobei die Unterschiede
jedoch gering waren. Die neue Maschine war daher der alten
Lokomotive gewachsen und das wollte man.
Bevor dieser Betriebseinsatz jedoch
beginnen konnte, musste das Personal geschult werden. Dabei geht man
meistens davon aus, dass dies nur das Fahrpersonal be-träfe. Jedoch musste
auch die Werkstatt wissen, wie der Unterhalt ausgeführt werden konnte. Die weiteren Lokomotiven, die in der Schweiz ankamen, durchliefen ebenfalls die Endmontage in Winterthur. Nach Abschluss der Arbeiten wurde jede Maschine einem be-stimmten Prüfprogramm unterworfen. Dieses Programm umfasste in erster Linie
die grund-legenden Funktionen, aber auch das Verhalten mit der
Zugsicherung
und mit
ZUB 121.
Danach konnte sie das Werk verlassen und dem Betrieb übergeben werden. Den Kleinunterhalt besorgten die Depotwerkstätten in der näheren Umgebung. Für den schweren Unterhalt und die Revisionen mussten die Lokomotiven jedoch in die Haupt-werkstätte Biel überstellt werden. Dort hatte man die Erfahrungen mit dem
Unterhalt von
Diesellokomotiven
gesammelt und die neue Baureihe war sicherlich gut aufgehoben. Wobei
erwähnt werden muss, dass die elektrischen Komponenten in der
Hauptwerkstätte
Yverdon unterhalten wurden. Damit waren alle wichtigen Punkte für die
Lokomotive geregelt, und die Verteilung der einzelnen
Maschinen konnte beginnen. Dabei wurden die in den Listen bereits
geführten, aber noch nicht gelieferten Maschinen nach Ankunft sofort
endmontiert und den entsprechenden Standorten zugeführt. Es kam daher
keine Maschine ohne Prüfung in den Betriebseinsatz. Für uns bedeutet das
nun, dass wir uns diesem Kapitel zuwenden können.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2022 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Wobei
gerade die Baureihe Am 841 besonders war. Die Ma-schine war keine komplett
neue Konstruktion, sondern sie wurde von einem Muster der RENFE
abgeleitet. Daher konn-ten gewisse Daten von der spanischen Baureihe
übernommen werden.
Wobei
gerade die Baureihe Am 841 besonders war. Die Ma-schine war keine komplett
neue Konstruktion, sondern sie wurde von einem Muster der RENFE
abgeleitet. Daher konn-ten gewisse Daten von der spanischen Baureihe
übernommen werden. Gebaut
wurde die
Gebaut
wurde die
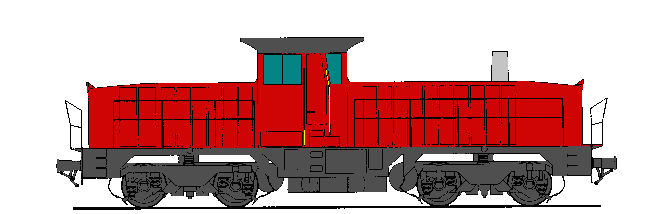 Da
keine Einstellungen mehr vorgenommen werden mussten, konnte man die erste
Am 841 noch am gleichen Tag dem Kunden, also den Schweizerischen
Bundesbahnen SBB, übergeben. Ein Vorgang, der im-mer wieder erfolgte und
der für die Hersteller nicht immer angenehm war.
Da
keine Einstellungen mehr vorgenommen werden mussten, konnte man die erste
Am 841 noch am gleichen Tag dem Kunden, also den Schweizerischen
Bundesbahnen SBB, übergeben. Ein Vorgang, der im-mer wieder erfolgte und
der für die Hersteller nicht immer angenehm war. Für
diese wichtigen Prüfungen wurden im Areal der Schweizerischen Lokomotiv-
und Maschinenfabrik SLM die entsprechenden Bauteile im
Für
diese wichtigen Prüfungen wurden im Areal der Schweizerischen Lokomotiv-
und Maschinenfabrik SLM die entsprechenden Bauteile im
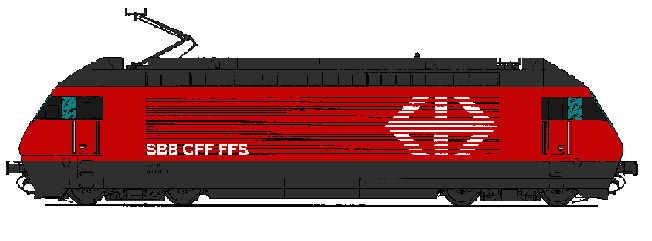 Aus
diesem Grund kuppelte die Mannschaft für Versuche die neue
Aus
diesem Grund kuppelte die Mannschaft für Versuche die neue
 Somit
hatte man nun alles, damit die
Somit
hatte man nun alles, damit die