|
Der Kasten (ohne Führerräume) |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Die Reihe Re 4/4 der Schweizerischen
Bundesbahnen SBB sollte die erste elektrische
Lokomotive des Unternehmens sein, das nach den neusten
Grundsätzen beim Bau solcher Fahrzeuge aufgebaut wurde. So verzichtete man
seit vielen Jahren wieder auf einen tragenden Plattenrahmen, wie es bisher
üblich war. Möglich wurde dies jedoch, weil die
Fahrwerke
mit
Drehgestellen optimiert werden konnten und besser
funktionierten.
Doch damals wusste man noch nicht, dass diese
Bau-weise so erfolgreich werden sollte, dass nahezu sämt-liche danach
gebauten
Triebfahrzeuge
so gestaltet wurden. Dabei wurde statt einem stabilen Plattenrahmen ein als Untergurt bezeichneter Hilfsrahmen verwendet. Dieser Rahmen gab bereits die Abmessungen des Kastens vor und konnte das Gewicht der eingebauten Ausrüstung in seinem Aufbau schlicht noch nicht tragen.
Seine Aufgabe bestand eigentlich nur darin, die Auf-gabe des Rahmens zu
übernehmen und so die
Zug-kräfte
zu übertragen. Um die verbauten Geräte zu tragen, griff man jedoch zu
einer anderen Lösung.
Der
Untergurt wurde als Hohlträger in Form eines Vierkantrohres ausgeführt und
bestand aus einzelnen Stahlblechen, die elektrisch miteinander
verschweisst wurden. Erst diese Lösung bei der Fertigung von
Lokomotiven, erlaubte diese Bauweise mit mehreren
Baugruppen, die letztlich das kräftige und tragende Objekt werden liessen.
Im Gegensatz zu den Nieten, konnten über die Schweissnähte auch höhere
Kräfte übertragen werden.
Damit der Untergurt stabil war, baute man an den wichtigen Stellen
Querträger ein. Die Träger waren jedoch so positioniert worden, dass die
eingebauten Bauteile ideal abgestützt werden konnten. Dazu gehörten jene
Bereiche, die den
Transformator
aufnahmen. Zudem waren auch die Querträger bei den beiden
Drehgestellen vorhanden. Weitere Träger gab
es jedoch nicht mehr und auch der Boden sollte nicht überall vorhanden
sein.
Je
leichter nun der mechanische Aufbau wurde, desto mehr Gewicht durfte die
elektrische Ausrüstung haben. Dieses Gewicht wurde aber bei der Bestimmung
der
Leistung
wichtig. Einfach gesagt, ein leichter Kasten ergibt eine höhere Leistung.
Am
Untergurt waren auf beiden Seiten je zwei Supporte angebracht worden.
Diese Supporte waren nach Vorgaben der Schweizerischen Bundesbahnen SBB
ausgeführt worden und standen leicht vom Kasten ab. Musste die
Lokomotive, oder nur der Kasten mit einem
Kran
abgehoben werden, konnten die Ketten mit Bolzen an diesen Supporten
einfach und schnell befestigt werden. Dadurch entfielen die Stahlträger,
die bei den
Rahmenlokomotiven
noch benötigt wurden.
Wichtig bei den Supporten war, dass sie auch genutzt wurden, wenn der
Kasten ohne
Drehgestelle abgestützt werden musste. Damit die
Kasten jedoch dabei nicht ab den Hebeböcken fallen konnte, mussten die
Punkte für die Supporte so gewählt werden, dass der Schwerpunkt
richtiglag. Wie kräftig der selbsttragende Kasten wurde, zeigt die
Tatsache, dass an diesen Supporten die komplette
Lokomotive angehoben werden konnte.
Vorne und hinten wurde der Untergurt so gestaltet, dass dieser als
Stossbalken
verwendet werden konnte. Mit im Untergurt eingezogenen Verstrebungen
wurden die an diesen Stellen entstehenden Kräfte optimal in den Kasten
abgeleitet. Genau hier war die Neuerung, denn im Gegensatz zum
Plattenrahmen wurden die
Zugkräfte
im Fall des Untergurtes über den Kasten auf die
Zugvorrichtungen
übertragen. Daher musste dieser optimiert werden.
In
der Mitte des
Stossbalkens
wurden die
Zugvorrichtungen
eingebaut. Dabei wurde im Untergurt der
Zughaken
federnd eingebaut. Jedoch konnte sich der Zughaken seitlich verschieben,
so dass die Kräfte optimaler übertragen werden konnten. Führungen, die
oben und unten vom Haken eingebaut wurden, besorgten die saubere Führung.
Zur Reduktion der Reibung und damit sich der Haken leichter verschieben
konnte, wurden diese Führungen mit
Fett
geschmiert.
Am
Zughaken
wurde noch die
Schraubenkupplung montiert. Diese war, wie der Zughaken
etwas schwächer, als nach den Vorgaben der
UIC
ausgeführt worden. Solche
Kupplungen besassen schon die
Leichtstahlwagen und wurden daher auch bei
der
Lokomotive gewählt, die nicht vor
Güterzügen
eingesetzt werden sollte.
Ein Nebeneffekt dieser
Zugvorrichtungen war, dass man mit dieser Kupplung
ein paar Kilogramm Gewicht einsparen konnte.
Diese
Puffer
waren als
Hülsenpuffer
ausgeführt worden und besassen runde
Pufferteller. Dabei wurde der linke Puffer mit einem flachen und der
rechte mit einem gewölbten Teller versehen. Somit entsprachen die Zug- und Stossvorrichtungen vom Aufbau her den Nor-men der UIC. Lediglich die Zugvorrichtungen wurden etwas schwächer aus-geführt. Bei den Puffern wurden jedoch die üblichen Modelle genommen.
Diese waren
kräftig genug, dass die
Lokomotiven die schweren Züge auch ohne Probleme
schieben konnte. Das besonders bei den
Pendelzügen
wichtig war. Es gab
daher in diesem Bereich keine speziellen Vorrichtungen, wie zum Beispiel
Zerstörungsglieder. Im Bereich der Puffer war der obere Abschluss des Untergurtes gut zu erken-nen. Der Grund dafür war, dass der Stossbalken wegen seinem Aufbau und dem Abstand der beiden Stossvorrichtungen, nicht der Front der Führerhäuser folgen konnte.
So entstanden in den Ecken kleine
Plattformen, die jedoch keine
grosse Stand-fläche boten. Beim Typ B wurde dieser Bereich etwas grösser
und daher mit einem Riffelblech abgedeckt.
Mit den
montierten
Stossvorrichtungen können wir die
Lokomotiven bereits messen.
Bei der Länge gab es zwischen den beiden Serien einen Unterschied. So wies
die
Bauart
A eine Länge von 14 700 mm aus. Die Bauart B wurde jedoch
leicht gestreckt und kam daher auf eine Länge von 14 900 mm. Ein
Unterschied, der im Untergurt umgesetzt wurde, denn die verwendeten
Puffer
waren bei allen Lokomotiven identisch ausgeführt worden.
Diese
Differenz war eine direkte Folge der Änderungen bei der Konstruktion.
Diese hatte geänderte
Führerhäuser zur Folge. Dadurch wurde aber ein etwas
längerer Untergurt nötig. Diese leichte Veränderung beim Aufbau wirkte
sich wegen den gleichen
Stossvorrichtungen direkte auf die Länge der
Lokomotive aus. Die Seitenwände des Kastens waren daher wirklich bei allen
Lokomotiven der Reihe Re 4/4 gleich lang geworden.
Die Trennlinien zwischen dem
Untergurt und den bei-den Seitenwänden waren gut zu erkennen. Zur
Ver-stärkung der Naht, wurden zusätzlich längs verlauf-ende Schweissbänder
verwendet. Diese wurden so-wohl mit dem Untergurt, als auch mit der
Seitenwand verschweisst. Dadurch konnten die Seitenwände einen Teil der Kräfte übernehmen und dem Kasten so die benötigte Stabilität geben. Wollte sich der Untergurt durch die Last nach unten durchbiegen, ging das nur, wenn die Wände verbogen wurden.
Dadurch entstand eine entgegenwirkende Kraft, die so das ganze Bauteil
verstärkte. Jedoch bestand nun die Gefahr, dass die Seitenwände, die ja
nur aus ein-fachem Stahlblech bestanden nachgeben könnten.
Damit diese
Verteilung der Kräfte optimiert werden konnte, wurden innen die Wände mit
Profilen, verstrebt. Im Dachbereich wurden die beiden Seitenwände an
mehreren Orten gegeneinander abgestützt. So konnten sie nicht mehr
verbogen werden und der Kasten bekam die volle Festigkeit. Eine leichte
und sehr stabile Konstruktion, die jedoch nur wegen der neuen
Schweisstechnik umgesetzt werden konnten, denn Nieten waren zu flexibel.
Wir haben
das Geheimnis des selbsttragenden Kastens kennen gelernt. Der Untergurt
wurde mit Hilfe der beiden Wände so verspannt, dass er sich nicht mehr
durchbiegen konnte. Damit konnte viel Gewicht eingespart werden. Ein
Punkt, der sowohl bei der
Bauart
A, als auch bei der Variante B angewendet
wurde. Bei der Ausführung gab es jedoch zwischen den beiden Modellen im
Bereich der beiden Seitenwände deutliche Unterschiede.
Wir beginnen
mit dem Typ A und dabei mit der Seitenwand auf der linken Seite der
Lokomotive. Es war eine glatte Wand entstanden, die nur durch die
anschliessend erwähnten Öffnungen unterbrochen wurde. Dabei befanden sich
in der unteren Hälfte nur die beiden Deckel zu den Sandbehältern für die
Achsen
zwei und drei. Diese wurden unmittelbar über der Trennlinie zum
Untergurt platziert und störten daher die glatte Wand nicht gross.
Durch die
gleichmässige Verteilung der vier Seitenfenster wurde der Gang dahinter
sehr gut erhellt. Diese Fenster hatten daher ausser der Aufgabe, den
Durchgang dahinter bei Tag ausreichend zu erhellen, keine weitere Funktion
erhalten. Da zwei Fenster geöffnet werden konnten, wurde verhindert, dass
es in diesem Bereich der
Lokomotive in den heissen Tagen des Sommers zu
unerträglichen Temperaturen kommen konnte.
Spannender
als diese Wand mit den vier Fenstern, war der dahinter verlaufende
Durchgang. Er verband die beiden
Führerstände
durch eine gerade
Verbindung. Diese war mit einer zurück-versetzten weiteren geschlossenen
Wand vom eigentlichen
Maschinenraum abgetrennt worden. So entstand ein
schmaler Durchgang, der vom
Zugpersonal, aber auch von den Reisenden,
benutzt werden sollte. Damit konnte die
Lokomotive auch mitten im Zug
eingereiht werden.
Kommen wir
nun zur zweiten Seitenwand der
Bauart
A. Diese könnte man ungeniert auch
als Maschenraumseite bezeichnen. Im oberen Bereich bekam diese Seite die
gleichen vier Fenster, wie wir sie vorher kennen gelernt haben. Einziger
Unterschied dazu war, dass man hier alle vier Fenster öffnen konnte. Dazu
waren über dem Fenster Riegel angebracht worden. Löste man diese, konnte
die Scheibe nach innen eingeklappt werden.
Die Lösung
auf dieser Seite hatte eigentlich zwei Aufgaben zu erledigen. In erster
Linie sollten sie bei sehr heissem Wetter dafür sorgen, dass die warme
Luft aus dem
Maschinenraum besser abgeleitet werden konnte. Zusätzlich
dienten diese Fenster aber auch als Fluchtweg für das
Lokomotivpersonal. Dieses
konnte hier ein Fenster komplett lösen, so dass der Durchgang frei war.
Nötig war dieser Weg jedoch nur, wenn bei
Führerstände
eingedrückt waren.
Die Gitter hatten die Aufgabe, die
zur
Kühlung
der
Lokomotive benötigte Luft in den
Maschinenraum zu leiten.
Dort wurde sie dann von den Einrichtungen bezogen und auf anderen Wegen
wieder aus der Lokomotive gelassen. Filter oder ähnliche Einrichtungen, die die Luft gereinigt hätten, gab es bei dieser Lösung für die Lüftungsgitter nicht, so dass die Lamellen wirklich nur verhinderten, dass Regenwasser in den Maschinenraum eindringen konnte.
Eine Lösung, die schon bei anderen
Lokomotiven angewendet wurde und die
sehr gut funktionierte. Dabei wurde der
Ma-schinenraum ausreichend gekühlt.
Die Fenster mussten wirklich nur bei grosser Hitze geöffnet werden.
Hinter
dieser Wand befand sich der Durchgang für das
Loko-motivpersonal. Die Apparate
und Bauteile der elektrischen Ausrüstung waren von diesem seitlichen Gang
aus direkt zugänglich. Es war also jener Durchgang, der nicht für die
Reisenden bestimmt war. Damit diese nicht unbedacht in diesen Bereich
gelangen konnten, waren die beiden Türen, die diesen Durchgang von den
Führerständen abschlossen, mit einem üblichen Vierkantschloss versehen
worden.
Natürlich
fehlten auch hier die Deckel zu den beiden Sandbehältern nicht. Diese
waren identisch zu anderen Seite ausgeführt worden und lagen daher auch an
der gleichen Stelle. Wir können daher zusammenfassen, dass die Seite mit
dem
Maschinenraum
sich von der anderen Seitenwand optisch nur durch die
Gitter unterschied. Wir hatten daher nahezu gleiche Seitenwände erhalten.
Bei der
Bauart
B wurde dies jedoch zusätzlich vereinfacht.
Da der
Durchgang für Reisende bei den
Lokomotiven des Typs B nicht mehr
vorgesehen war, konnte man den Durchgang hinter den Wänden anders nutzen.
Sie haben richtig gelesen, der zweite Durchgang war mit samt den beiden
Türen zum
Führerraum weiterhin vorhanden. Er wurde jedoch nicht mehr als
reiner Durchgang genutzt. Das bedeutete, dass die Wand gegen den
Maschinenraum
hin geöffnet werden konnte.
Der Bereich
musste schliesslich nicht mehr vor unbefugtem Zugriff geschützt werden.
Das führte auch dazu, dass die vorher bei der
Bauart
A erwähnten
Vierkantschlösser an den Türen zum
Maschinenraum
nicht mehr vorhanden
waren. Der Maschinenraum war daher für das Personal leicht und von beiden
Seiten her zugänglich. Eine Lösung, die es jedoch nur hier gab, und die
wegen der Ableitung der etwas älteren Modelle entstanden war.
Bei den
Lokomotiven der
Bauart
B wurden daher zwei identische Seitenwände
aufgebaut, so dass sie etwas einfacher gestaltet waren, als beim Typ A.
Wobei in vielen Bereichen entsprachen die Wände der Seitenwand beim
Durchgang. Das betraf besonders die Deckel für die Sandbehälter und die
untere Hälfte, wo weiterhin keine Öffnungen vorgesehen wurden. Trotzdem
wurden die
Lüftungsgitter der anderen Seite beim Typ A benötigt.
Anstelle der
vier Fenster, verwendete man hier zwei Fenster und zwei
Lüftungsgitter.
Dadurch befanden sie sich nun in einer Linie. Die Reihenfolge war so
gewählt worden, dass die Lüftungsgitter immer hinter dem
Führerstand
angeordnet wurden. Zudem konnten die Fenster auf beiden Seiten geöffnet
werden. Dabei musste das Personal analog dem Typ A vorgehen und auch der
Zweck entsprach diesem Typ. Es war daher auf beiden Seiten ein Notausstieg
vorhanden.
Speziell war
hier, wie schon angetönt wurde, dass auch diese
Lokomotiven beide gerade
verlaufenden Durchgänge hatten. Einzig die Verkleidung entfiel, so dass
beide Gänge einen freien Zugang zum
Maschinenraum
boten und damit
eigentlich nur Durchgänge waren, die durch diesen geführt wurden um den
Zugang zu ermöglichen und um den
Führerstand der Lokomotive zu wechseln.
Daher konnten auch die Schlösser an den Türen entfallen.
Der durch
die beiden Seitenwände und die beiden seitlichen Durchgänge beschränkte
Maschinenraum, wurde an den stirnseitigen Abschlüssen mit einer einfachen
Wand mit jeweils zwei Türen abgeschlossen. Diese Wand stabilisierte die
Seitenwände und bildete gleichzeitig die klare Trennung des
Maschinenraumes zu den beiden
Führerständen. Die Position dieser
Trennwände war auch aussen gut zu erkennen, weil hier senkrecht
verlaufende Nietenbänder vorhanden waren.
Zudem konnte hier auf auf eine verstärkte Ausführung verzichtet
werden, da nur die leichteren Bau-teile der elektrischen Ausrüstung
getragen werden mussten. Jedoch hatte die Lösung auch Nachteile.
Das Dach
konnte nicht mit den beiden Seitenwänden verschweisst werden. Daher wurde
es mit Schrauben an den dort montierten Auflagen befestigt und konnte von
der Werkstatt in drei Teilen abgehoben werden. Spezielle Ösen
erleichterten die Anbringung der Ketten. So war im Unterhalt ein leichter
Zugang zu den eingebauten Baugruppen möglich. Letztlich war diese Lösung
auch wegen dem selbsttragenden Kasten erforderlich geworden.
Nicht
entfernt werden konnten die seitlichen Rundungen. Diese waren auch aus
Stahl aufgebaut worden. Sie dienten den Seitenwänden als zusätzliche
Stabilisierung. Speziell war jedoch der am unteren Rand dieser Rundungen
vorhandene Absatz. Es handelte sich dabei um eine Regenrinne, die
verhinderte, dass das Dachwasser seitlich am Kasten abfloss. Durch Rohre
tropfte das Wasser daher unter dem Kasten auf den Boden.
Damit das
Dach etwas stabiler wurde, bekam es zwei quer verlaufende Stege im
Maschinenraum, die an den beiden Seitenwänden montiert wurden. Dadurch
konnte sich das Dach darauf zusätzlich abstützen und war etwas stabiler
geworden, als das bei der
Lokomotive der Baureihe
Ae 4/4
der Fall war.
Gleichzeitig dienten diese Querträger auch der Aufnahme der Schrauben, die
zur Befestigung des Daches verwendet wurden.
Damit das
Personal bei der Wartung das gerundete Dach gefahrlos begehen konnte,
waren beidseitig Stege montiert worden. Diese waren so gestaltet worden,
dass sie die Demontage eines Segmentes nicht behinderten. Dabei
beschränkten sich diese Stege jedoch nur auf die Bereiche mit den lösbaren
Dachteilen und führten nicht in den Bereich der
Führerstände. Belegt
wurden die Stege mit Holzplanken, die so einen guten Stand erlaubten.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2019 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Stattdessen
benutzte man die Ideen, die bei der Bau-reihe
Stattdessen
benutzte man die Ideen, die bei der Bau-reihe
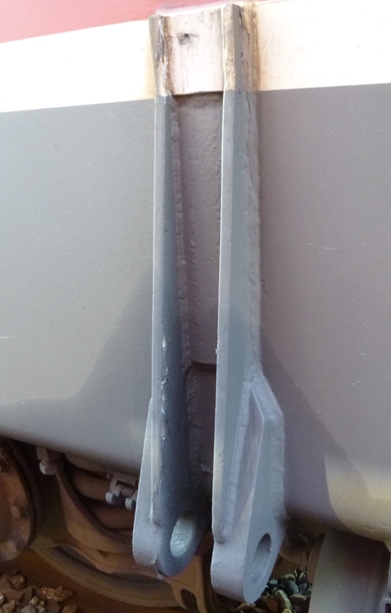
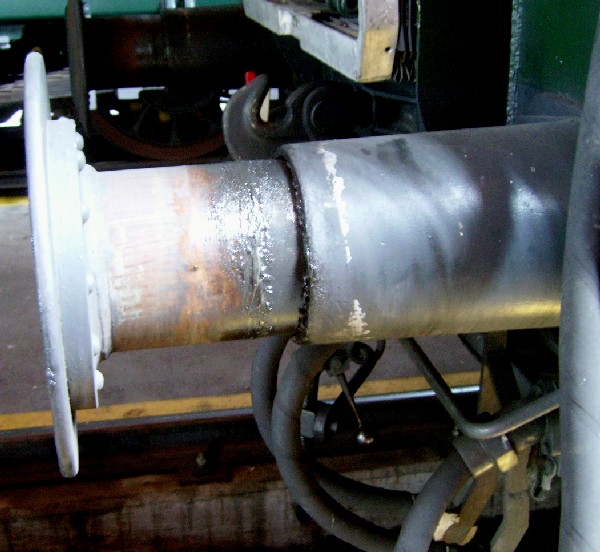 Weil es der
Weil es der
 Auf dem
Untergurt wurden die beiden Seitenwände aufgebaut. Diese bestanden
ebenfalls aus normalen Stahlblechen, die mit einander und mit dem
Untergurt elektrisch verschweisst wurden.
Auf dem
Untergurt wurden die beiden Seitenwände aufgebaut. Diese bestanden
ebenfalls aus normalen Stahlblechen, die mit einander und mit dem
Untergurt elektrisch verschweisst wurden.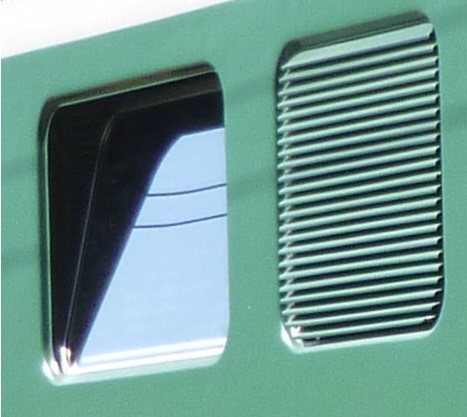 Im oberen
Bereich dieser Seitenwand kamen vier gleichgrosse Fenster zum Einbau.
Dabei waren die beiden mittleren Fenster fest in der Seitenwand eingebaut
worden. Die beiden Fenster unmittelbar bei den
Im oberen
Bereich dieser Seitenwand kamen vier gleichgrosse Fenster zum Einbau.
Dabei waren die beiden mittleren Fenster fest in der Seitenwand eingebaut
worden. Die beiden Fenster unmittelbar bei den
 Unterhalb
der Fensterreihe wurden die gleiche Zahl
Unterhalb
der Fensterreihe wurden die gleiche Zahl
 Abgedeckt
wurde der
Abgedeckt
wurde der