|
Einleitung |
||||
|
|
Navigation durch das Thema | |||
| Baujahr: | 2010 – 2016 | Leistung: | 4 000 / 6 000 kW | |
| Gewicht: | 212 - 297 t | V.max: | 160 km/h | |
| Normallast: | Triebzug | Länge: | 100 360 - 150 000 mm | |
|
Schon an anderen Orten haben wir erfahren, dass nach dem Jahr 2000 die Hersteller ihre Modelle als Baukasten anbieten. Der Kunde kann dann aus einer Palette für Baugruppen sein genau abgestimmtes Fahrzeug formen. Bekannt sind in diesem Punkt sicherlich die Lokomotiven der neusten Generation. Dort begann es aber bereits mit der Lok 2000. Aber funktioniert dies auch bei Triebzügen. Die hier vorgestellten Modelle meinen ja.
Ja selbst bei den
Staatsbahnen
gab es unterschiedliche Varianten. Letztlich gab es fünf Lösungen, die
sich jedoch nur in die beiden Bau-reihen RABe 511 und RABe 515 aufteilten. Wer sich mit dem System für die
Bezeichnungen der
Triebfahrzeuge
in der Schweiz befasst hatte, sah gleich, dass es eine grosse
Ver-wandtschaft geben musste. Die an der dritten Stelle aufgeführte fünf,
sagte eigentlich nur, dass es sich hier um ein Fahrzeug der BLS AG
handelte. Da jedoch die Modelle der beiden Bahnen aus einem vielfältigen
Katalog stammen, ergaben sich die zuvor erwähnten technischen
Unterschiede. Trotzdem waren die Modelle der beiden
Bahnen so nahe verwandt, dass sich eine gemeinsame Seite für die
Triebzüge
lohnt. Wir werden auf die Unterschiede der einzelnen Modelle im Kapitel
Entwicklung und Beschaffung näher eingehen. Nicht weiter erwähnt werden
jedoch die vom Hersteller in andere Länder ausgelieferten Fahrzeuge. Das
erfolgt, obwohl dort eigentlich die Anfänge dieser beiden Baureihen zu
finden wären. Bevor wir jedoch dazu kommen, müssen wir
uns zuerst mit der geschichtlichen Entwicklung der Bahnen befassen.
Letztlich war diese dafür verantwortlich, dass es zu den hier
vorgestellten Fahrzeugen kommen konnte. Dabei war der Grund eigentlich
bekannt, denn solche Fahrzeuge werden nur beschafft, wenn es zu Problemen
mit dem bestehenden
Rollmaterial
kam. Doch, wie sah es in der Schweiz damals aus?
Jedoch konnten die Schweizerischen
Bundesbahnen SBB zusammen mit den zahlreichen
Privatbahenn
bei der Di-stanz das Land im fernen Osten übertrumpfen. Die Schweiz war
auf Augenhöhe mit Japan und das ohne Shinkansen und auf die Sekunde
geplanten Zügen. Mit der Einführung des Taktfahrplanes im ganzen Land, fand dieser Ansturm statt. Es war nun auch für nicht so gut gebildete Leute einfacher die Bahn zu benutzen. Der komplizierte Fahrplan war weg und nun konnte er leich-ter gelesen werden. Das gefiel den Leuten und deshalb stiegen
sie immer mehr auf die Eisenbahn um. Besonders im Grossraum Zürich gab es
bei der neuen
S-Bahn
erste Probleme mit dem er-warteten Aufkommen. Aus diesem Grund wurden dort in der Schweiz
seit der Bödelibahn wieder Wagen mit zwei Stockwerken einge-führt. Mit
einer
Lokomotive der Reihe Re 450 bespannte kurze 100 Meter lange
Pendelzüge
konnten mit bis zu drei Einheiten nahezu 3000 Personen aufnehmen. Der
Hauptbahnhof
wurde so zu einem der am meisten bereisten
Bahnhöfe
der Welt. Besonders zu den Zeiten, wo die zahlreichen Pendler unterwegs
waren. Auf diesen Lorbeeren wollte man sich jedoch
nicht Ausruhen. Der
Fahrplan
sollte noch einfacher werden. Die Idee
Bahn 2000
sollte sogar das bekannte
Kursbuch
verschwinden lassen. Das in der Schweiz am häufigsten verkaufte Buch, war
so dick geworden, dass es in mehreren Bänden herausgegeben werden musste.
Das machte dessen Nutzung nicht einfacher und aus diesem Grund sollte der
Fahrplan noch einfacher werden.
Die nun möglichen schnellen
Verbindungen
mit umsteigen vom Nah- auf den
Fernverkehr sorgten für einen Ansturm bei den Reisenden. Dies wiederum
sorgte auf vielen Strecken der Schweizerischen Bundesbahnen SBB dafür,
dass die bisherige
Kapazität
der vorhandenen
Kompositionen
nicht mehr ausreichend war. Es musste öfter gefahren und Züge verlängert
werden. So kam es zum heute fast üblichen Halbstundentakt. Der erste Schritt wurde mit den speziellen
Doppelstockwagen
für die
IC 2000
getan. Damit verkehrten erstmals ausserhalb von Zürich solche Fahrzeuge.
In erster Linie sollte mit diesen das bereits vorhandene Problem auf der
Strecke Zürich – Bern gelöst werden. Doch zeigte sich, dass auch bei
anderen Linien diese
Pendelzüge
benötigt wurden. Immer mehr Strecken in der Schweiz mussten an deren
Profile angepasst werden. Bei all den Zügen mit
Doppelstockwagen
verwendete man eine
Lokomotive, die bei der Reihe Re 450 als
Triebkopf
aufgebaut wurde. Gerade diese zeigte aber, dass eine Lokomotiven viel
Platz an den
Bahnsteigen
benötigten. Bei drei Einheiten bedeutete das, dass rund 45 Meter Platz
nicht genutzt werden konnten. So kamen im Bereich der einstöckigen
Fahrzeuge erste
Triebzüge
auf. Diese nutzten den Platz sehr optimal.
Ein Prinzip, das bei den
Staatsbahnen
schon bei der Baureihe RABDe 8/16 erprobt wurde. Dort waren die noch zu
schwach gebauten Kasten das Problem. Nun sollte dieses Prinzip bei einem
doppelstöckigen Zug umgesetzt werden. So kamen die von der Firma Siemens
gelieferten Fahrzeuge der Reihe RABe 514 in Betrieb. Da man damals noch
nicht wusste, wie ein
Hochspannungskabel
durch den doppelstöckigen Zug geführt werden kann, mussten bei diesen
Triebzügen
wieder beide
Stromabnehmer
gehoben werden. Damit entstanden durchaus grössere Probleme beim Einsatz
dieser Triebzüge. Diese sollten wir uns kurz ansehen, den sie waren gross. Werden mehrere
Stromabnehmer
gehoben, sorgen diese dafür, dass der
Fahrdraht
durch den
Anpressdruck
angehoben wird. Je grösser die Anzahl ist, desto mehr wird die Leitung
gehoben. Das kann bei Quertragewerken dazu führen, dass es zu einem
Kurzschluss
in der
Fahrleitung
kommen konnte. Bei drei Einheiten der Baureihe RABe 514 bedeutete das
nicht weniger als sechs gehobene Bügel, die kräftig gegen den Fahrdraht
drücken.
Um die gefürchteten Effekte zu minimieren,
wur-den Beschränkungen bei den Geschwindigkeiten verfügt und die Anzahl
gehobener Bügel be-schränkt. Bei einem
Triebzug
für den
Personen-verkehr
konnte das nicht akzeptiert werden. Als Folge davon, mussten die Schweizerischen Bundesbahnen SBB für eine weitere Generation von Zügen mit Doppelstockwagen das Konzept über-denken. Zumal nun auch schnelle
Regioexpress
und sogar vereinzelte
Interregio
im Land mit solchen Fahr-zeugen geführt werden sollten. Mit anderen
Wor-ten, es wurden damit auch Geschwindigkeiten von bis zu 160 km/h
gefahren. Je weniger Bügel am
Fahrdraht,
desto besser. Soweit der geschichtliche Werdegang bei den
Schweizerischen Bundesbahnen SBB, die durchaus die grosse
Kapazität
solcher
Triebzüge
nutzen wollten. Es stellt sich damit aber unweigerlich die Frage, was denn
bei der BLS AG zur Beschaffung solcher Triebzüge führte. Dabei müssen wir
bedenken, dass die Gesellschaft im Berner Oberland sich immer mehr auf den
Regionalverkehr
im Kanton Bern ausgerichtet hatte. Bei der BLS AG sah die Situation nicht viel
anders aus. Die Übernahme der
S-Bahn
Bern von den Schweizerischen Bundesbahnen SBB brachte neue Verkehre. Die
dabei neu befahrenen Strecken zeigten jedoch schnell, dass die Modelle der
älteren Generation nicht ideal aufgebaut waren. Insbesondere bei der
Kapazität
gerieten die Züge schnell an ihre Grenzen. Doppelte Einheiten sollten das
Problem vorerst lösen. Blicken wir auf das vorhandene
Rollmaterial
der BLS AG erkennen wir dreiteilige
Triebzüge,
die für Strecken mit dem Charakter einer
Nebenbahn
gebaut wurden. Zwar wurden die ersten Triebzüge
RABe 525 um einen
zusätzlichen Teil verlängert, aber das reichte gerade im Aaretal nicht
aus. Die schweizerischen Bundesbahnen SBB setzten zuvor
Pendelzüge
aus fünf Wagen ein. Diese konnten mit einem vierteiligen Triebzug
RABe 525 gerade noch
ersetzt werden.
So kam es, dass im Bereich der
S-Bahn
Bern die Anzahl der Fahrgäste um bis zu 43,5% zugenommen hat. Die
Triebzüge
der BLS AG konnten die Anzahl Reisenden auch in
Mehrfachtraktion nicht mehr aufnehmen. Zudem wurden im Schwarzwassertal neue Wohngebiete geschaffen, die auf dieser Nebenbahn den Verkehr massiv ansteigen liessen. Hier konnte man nicht mit verlängerten Zügen arbeiten. Die Anlagen waren seinerzeit für 100 Meter
lange Einheiten ausgelegt worden. Ein Problem, das besonders bei
Privatbahnen
immer wieder zu beobachten war, denn oft wurde nach dem vorhandenen
Verkehr gerechnet. Die Folgen wären hohe Kosten beim Ausbau
der
Infrastruktur
gewesen. ver-längerte
Bahnsteige
waren dabei noch das geringste Problem. Bei den
Stationen
reichte oft auch die Länge für Kreuzungen nicht mehr aus. Das bedeutete
einen grösseren Ausbau und damit verbundene Kosten. Gelder, die nicht so
einfach zu beschaffen waren. Wie so oft, sollte die neue
Kapazität
vorhanden sein, als das Problem erkannt wurde. Verlängern konnte man die Züge auch nicht
auf anderen Strecken, denn an den kleineren
Stationen
hatten längere Züge schlicht keinen Platz. Mit zwei
RABe 525 war man im
Aaretal schon am Limit angelangt. Trotz der immer wieder bemängelten engen
Bestuhlung, reichte der Platz im Zug besonders im Raum Bern nicht mehr
aus. Daher mussten neue Ideen gesucht werden. Diese waren an anderen Orten
bereits umgesetzt worden und zeigten den Erfolg.
Mögliche Züge gab es nur im Grossraum
Zürich und die waren mit zwei Ebenen ausgerüstet worden. Solche Züge gab
es seinerzeit bei der Bödelibahn, aber seither bei der BLS AG nicht mehr.
Jedoch konnten nur solche Züge die Lösung bringen. Daher machte man im Jahre 2005 mit
gemieteten Wagen der CFL und zwei
Lokomotiven
Versuche mit
Doppelstockwagen.
Die in der Schweiz vorhandenen Züge aus dem Raum Zürich konnten nicht
verwendet werden, weil auch dort solche Züge nicht im Überfluss vorhanden
waren. Zudem konnten mit den Wagen der CFL auch eigene Lokomotiven
verwendet werden, denn die Reihe
Re 485 hatte die passenden Einrichtungen. Obwohl die Versuche erfolgreich waren,
entschied man sich beim bestehenden
Rollmaterial
zu bleiben. Der Grund dafür war klar, denn die Züge waren relativ neu und
mussten noch finanziert werden. Das ging nur, wenn man sie entsprechend
auslastete. Der Unmut der Fahrgäste erhöhte sich daher immer mehr, denn
Platz schuf man damit keinen. Die Situation veränderte sich nicht. Im
Gegenteil, es wurde immer schlimmer. Besonders auf den Linien nach Biel, Thun
und Schwarzenburg gab es immer grössere Probleme. Neue Wohngebiete im
Schwarzwassertal führten zu einem Anstieg der Fahrgäste, der weit über dem
Durchschnitt lag. Die ehemalige kleine
Nebenbahn
entwickelte sich zu einem grossen Problem für die BLS AG, welche einfach
zu wenig
Rollmaterial
hatte. Zudem passte dieses nicht mehr zum Verkehr auf den Strecken im Raum
Bern.
Der bisher dazu vorgesehene Hoflieferant
der Bahn konnte bei dieser Sorte Fahrzeugen jedoch nicht mithalten. Ohne
eine Neuentwicklung ging es schlicht nicht. Gerade das Berner Oberland sollte von diesen Zügen nichts zu spüren bekommen. Die BLS AG musste das Rollmaterial im Raum Bern erneuern, ob sie wollte oder nicht. Die im Oberland noch eingesetzten Modelle
der Bau-reihe RBDe 565
sollten dann von den frei werdenden
Triebzügen
abgelöst werden. Wobei natürlich nicht eine direkte
Ablösung
erfolgte, denn mehr
Ver-bindungen,
benötigten auch deutlich mehr Züge. Die Entwicklung der hier vorgestellten Triebzüge ob-lag jedoch weder bei der BLS AG, noch bei den Schweizerischen Bundesbahnen SBB. Beide mussten nach den neuen Regeln die
ge-wünschten Fahrzeuge International ausschreiben. Das war per Gesetz von
einigen Jahren geregelt worden und das bekannte
Pflichtenheft
wurde durch einen Wunschzettel ersetzt. Auch wenn dieser mehrere Seiten
umfasste, der Wunschzettel passte. Dabei waren die
Staatsbahnen
in diesem Punkt etwas eher, als die BLS AG, welche aber auch eigene Ideen
umsetzen wollte. Dabei halfen den beiden Bahnen die neuen Systeme mit
Baukasten. Mit anderen Worten, die beiden Bahnen nutzen den gleichen
Katalog und wählten dabei bei den vom Hersteller angebotenen Baugruppe
jeweils andere aus. Die Folge davon war, dass sich die
Triebzüge
optisch kaum gleichen sollten.
|
||||
|
Navigation durch das Thema |
Nächste | |||
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | |
|
Copyright 2023 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
||||
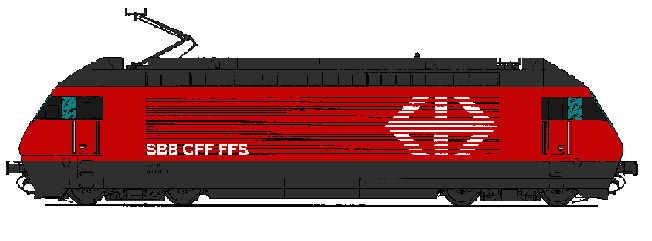 Auch
wenn die in der Tabelle oben aufgeführten technischen Daten identische
Fahrzeuge vermuten lassen, gab es zwischen den
Auch
wenn die in der Tabelle oben aufgeführten technischen Daten identische
Fahrzeuge vermuten lassen, gab es zwischen den
 Die
Bahnen in der Schweiz waren bei der Bevölkerung schon immer sehr beliebt.
Das zeigte sich in grossen
Die
Bahnen in der Schweiz waren bei der Bevölkerung schon immer sehr beliebt.
Das zeigte sich in grossen
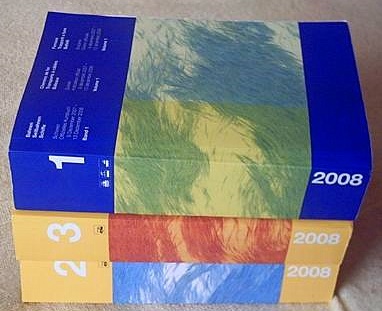 In
der Schweiz wurde kurz nach dem Jahr 2000 ein neuer
In
der Schweiz wurde kurz nach dem Jahr 2000 ein neuer
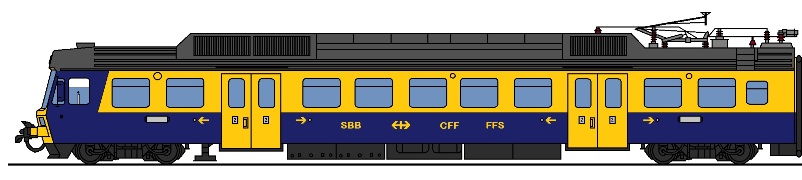 Die
neuen Fahrzeuge für die
Die
neuen Fahrzeuge für die
 Bewegt
sich das Fahrzeug nun unter der
Bewegt
sich das Fahrzeug nun unter der
 Jedoch
brachte die
Jedoch
brachte die
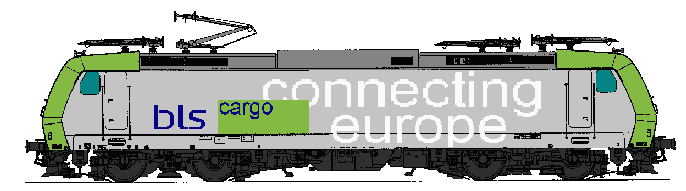 Bei
der Direktion der BLS AG musste man nach Lösungen für das Problem suchen.
Die Fahrgäste reklamierten immer öfters den fehlenden Sitzplatz. Nur gab
es im Raum Bern keine passenden Fahrzeuge.
Bei
der Direktion der BLS AG musste man nach Lösungen für das Problem suchen.
Die Fahrgäste reklamierten immer öfters den fehlenden Sitzplatz. Nur gab
es im Raum Bern keine passenden Fahrzeuge. Bei
der BLS AG musste man sich Gedanken über die Beschaffung neuer Züge
ernsthafte Gedanken ma-chen. Diese sollten auf den Strecken der
Bei
der BLS AG musste man sich Gedanken über die Beschaffung neuer Züge
ernsthafte Gedanken ma-chen. Diese sollten auf den Strecken der