|
Betriebseinsatz 1924 - 1938 |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Auf eine
Inbetriebsetzung,
wie bei anderen Baureihen verzichte ich. Die Fahrten waren nicht gross
anders, als bei anderen
Lokomotiven.
Bei der Reihe Ae 3/6 II wurde dazu die Nummer 10 401 herangezogen. Das war
eigentlich gar nicht so überraschend, galt sie doch als eigentlicher
Prototyp,
der noch nach den Ideen des Herstellers entstanden war. Ab der nächsten
Nummer hatten jedoch bereits die Schweizerischen Bundesbahnen SBB auf das
Modell Einfluss genommen.
Gerade bei der elektrischen Ausrüstung zeigte sich, dass die Abstufung bei den niederen Stufen sehr grob ausgefallen war. Die neue
Lokomotive
nahm einen richtigen Satz nach vorne, wenn es losging. Ein Effekt, der ihr
schnell die Bezeichnung «Gumpesel» einhandelte. Die Probefahrten für Fahreigenschaften wurden auf der Strecke zwischen Zug und Arth-Goldau ausge-führt. Diese Strecke war wegen den vielen Kurven ideal für solche Versuche und zudem war dort die Fahrleitung schon montiert worden. Ein Punkt, der damals durchaus auch bedacht
wer-den musste, denn die Strecken waren oft gar noch nicht bereit und
manche
Brücke
für die neuen Un-geheuer schlicht zu schwach. Da musste gut geplant
werden. Sehr zur Überraschung vieler Fachleute,
zeigte sich die Maschine der MFO auf diesem Abschnitt von ihrer besten
Seite. Trotz dem veralteten
Stangenantrieb,
waren die festgestellten Fahreigenschaften der
Lokomotive
sehr gut. Es waren daher nicht alle Punkte missraten und daher wurde
eigentlich aus der Erfahrung der Versuche heraus, die Ausrüstung mit einem
anderen
Transformator
verändert. Ein Punkt, der für eine gute Lokomotive sorgen sollte. Wegen der Panikbestellung waren jedoch
bereits die ersten
Lokomotiven
dieser Baureihe im Bau und konnten daher nicht mehr verändert werden. Die
von den Schweizerischen Bundesbahnen SBB gewünschten Änderungen konnte
daher erst ab der Nummer 10 421 umgesetzt werden. Ein Punkt, den es damals
auch bei den beiden anderen Herstellern gab. Besonders erwähnt werden muss
da die Reihe Ae 3/5, die in Form
der Ae 3/6 III besser werden sollte.
Dort hatte man bereits die entsprechenden
Erfahrungen mit elektrischen
Lokomotiven
machen können und war daher bereit. Nun sollte aber auch die Werkstätte in
Biel mit dem Unterhalt von elektrischen Lokomotiven begin-nen. Ihr
zugeteilt wurde dabei die Baureihe Ae 3/6 II. Ab dem Werk in Oerlikon wurden die ersten vier Lokomo-tiven nicht weit verschoben. Sie landeten im Depot Zürich. Dort wurden sie vorerst noch abgestellt, da die verfüg-baren Strecken noch nicht vorhanden waren. Die Zeit nutzte das
Depot
um das Personal zu schulen, was in Anbetracht der Tatsache, dass kein
Handbuch existierte keine einfache Sache war. Gerade das betroffene
Loko-motivpersonal
äusserte sich in dieser Angelegenheit eher kritisch. Luzern bekam seine ersten Ae 3/6 II im Jahre 1925. Auch dort standen anfänglich die Strecken noch nicht bereit. Jedoch wurden die Maschinen ab Luzern auch nach Arth-Goldau geschickt. Sie fuhren daher im Wechsel mit den
Lokomotiven
vom Gotthard auf diesen Abschnitten. Was der Reihe Ae 3/6 II an
Zugkraft
fehlte, machte sie mit dem Tempo wieder wett. Die Fahrten dienten auch
gleich der Schulung, denn auch hier gab es kein Handbuch. Mit dem durchgehenden
Fahrdraht
zwischen Basel und Luzern wurden auch die ersten
Lokomotiven
im Basel und Olten stationiert. Damit standen dort die Maschinen für diese
Strecken bereit. Wir müssen dabei jedoch bedenken, dass die Züge damals
noch die alte Linie am Hauenstein benutzten. Gerade diese steile
Bergstrecke
sollte der hier vorgestellten Baureihe auch die Bezeichnung «Trimbacher
Frontlenker» einhandeln.
Besonders die vom Gotthard bereits
verdrängten Ce 6/8 II machten
sich hier nützlich. Am Gotthard konnte man diese abgeben, da dort die
neuen Ce 6/8 III in
Betrieb genommen wurden. Diese konnten etwas mehr ziehen. Die Maschinen ab Olten befuhren natürlich auch die neu elektrifizierte Strecke nach Bern. Dort ange-kommen ging es anschliessend weiter nach Thun. Dort bestand die Fahrleitung schon lange und man war um jede Lokomotive froh, denn mit wenigen Ausnahmen verkehrten dort die Maschinen aus dem Versuchsbetrieb. Die waren wirklich gemütlich unterwegs,
denn das Aaretal sollte zur Rennbahn werden und da war mit 40 km/h nichts
zu wollen. Auch wenn in diesen ersten Jahren die
Maschinen der Reihe Ae 3/6 II dringend benötigt wurden, zeig-te sich
schnell, dass die Baureihe Ae 3/6 I der BBC etwas besser gelungen war. Von
der
Leistung
her entsprach sie dem Modell der MFO und was für die Exemplare aus
Münchenstein sprach, war dass diese Maschinen mit 100 km/h verkehren
konnten. Im Gegensatz dazu begnügte sich die Maschine aus Oerlikon mit 90
km/h. 1926 wurden die
Dienstpläne
neu sortiert. Für uns lohnt sich ein genauer Blick, denn es standen alle
Maschinen bereit. Die Schweizerischen Bundesbahnen SBB hatten 60
Lokomotiven
der Baureihe Ae 3/6 II und die mussten verteilt werden. Dabei wurden fünf
Standorte mit den neuen Lokomotiven bedacht. Es kam daher zu grossen
Verschiebungen. So bekam Winterthur die Nummern 10 401 bis 10 406 und
Zürich das Modell 10 407, sowie die Nummern 10 411 bis 10 413.
Mit dem Abschnitt bis Rorschach kamen auch
die steileren Ab-schnitte im Osten in den Plan der Reihe Ae 3/6 II. Ab
Winterthur kamen sie jedoch auch nach Romanshorn. Vorerst blieben sie auf
den
Hauptstrecken,
da es nur da
Fahrdrähte
gab. Besonders zu erwähnen ist, dass die Maschine der MFO im Wechsel mit jener der BBC eingesetzt wurde. Die beiden Bau-reihen waren sich wirklich sehr nahe und so konnte man diese Lösung wählen. Das Modell aus Oerlikon hatte eigentlich
nur das kleine Pro-blem, dass es mit 90 km/h nicht ganz so schnell
vorwärts ging, wie mit der Ae 3/6 I, die etwas schneller über die Strecke
fah-ren konnte. Zumindest dann, wenn diese das auch zugelassen hat. Im
Kreis
II bekam Olten die Nummern 10 408 bis 10 410, sowie 10 439 bis 10 449.
Dort änderte sich an den Einsätzen eigent-lich auch nicht viel. Die
Maschinen kamen regelmässig nach Biel und Bern. Sie wurden jedoch auch den
beiden
Nebendepots
Solothurn und Aarau zugeteilt. Weiter in Richtung Westen stiessen auch
diese Maschinen nicht vor und so blieb es. Auch hier teilte man sich die
Arbeit mit der Reihe Ae 3/6 I. Basel hatte die Nummern 10 414 bis 10 438
erhalten. Die
Lokomotiven
verkehrten vor den
Schnellzügen
nach Luzern, aber auch nach Zürich. Jedoch gingen die schwersten Züge in
Richtung Luzern bereits an die neue Baureihe
Ae 4/7 verloren. Die hatte einfach
etwas mehr
Zugkraft
und das war in den 26‰ steilen
Rampen
des Hauensteins wichtig. Aber auch hier, gab es die Kombination mit der
Reihe Ae 3/6 I, die immer noch ausgeliefert wurde.
Jedoch kam es auch zu Einsätzen ins Tessin,
was bemerkenswert ist, da diese
Lokomotiven
keine
elektrische
Bremse besessen haben. Das bedeutete, sie mussten in beiden
Richtung vor einem Zug ver-kehren. Jedoch trat Luzern auch ein paar Maschinen an das Nebendepot in Arth-Goldau ab. Ab dort verkehrten die Maschinen nach Zug und Erstfeld. Jedoch kam damals bereits ein Nahgüterzug in Richtung Süd-bahn dazu. Es war somit ein erster gemischter Einsatz
für die
Lokomotiven,
die hier sogar ohne die Baureihe Ae 3/6 I auskamen, denn die waren auf den
schnellen Strecken besser aufgehoben. Jedoch war die Ae 3/6 II immer noch
schneller, als die Maschinen vom Gotthard. Die nächsten beiden Jahre sollte sich an
diesen Einsätzen nicht viel ändern. Es kamen immer mehr neue Strecken
dazu, so dass der anfängliche Überbestand eliminiert wurde. Die Maschinen
verkehrten vor Zügen des
Fernverkehrs,
machten sich vor
Regionalzügen
nützlich und in der Zentralschweiz bespannte sie auch leichte
Güterzüge
auf flachen Abschnitten. Die Fahrten nach dem Tessin sollten jedoch selten
der Fall sein, denn meistens beliess man es am Berg bei den alten
Maschinen. Bereits 1928 wurden die Karten neu gemischelt. Die
Baureihe sollte nun die grösste Verteilung erfahren. Wenn wir mit den
Kreisen beginnen, dann fällt der Kreis I auf, denn dort fuhren lediglich
die aus Olten kommenden
Lokomotiven
nach Thun. Weiter in den West kamen
sie nicht und nur einige Lokführer des
Depots Biel waren auf diesen
Modellen kundig. Doch auch die fuhren damit ausschliesslich in Richtung
Osten und der Heimat entgegen.
Jedoch wurden auch Maschinen nach Aarau entsandt, welche auch auf
der
Südbahn verkehrten. Zwi-schen Basel und Luzern waren die Maschinen aus
Olten kaum mehr anzutreffen, denn dort ging die Post anders ab, wie wir
erkennen, wenn wird diese beiden Standorte ansehen. Basel konnte noch die Nummern 10 425 bis 10 434 behalten und in Luzern änderte sich schlicht nichts. Bei den Diensten, die täg-lich 382 Kilometer betrugen, war-en die meisten Schnellzüge ver-schwunden. Diese mussten an die schnelleren und stärkeren
Ae 4/7
abgetreten werden. Wenn es wirklich schwere Züge waren, leisteten auch die
Maschinen ab Olten
Vorspanndienst über den Hauenstein. Doch damit sind wir beim
Kreis II und in Luzern noch nicht fertig. So richtig stolz waren die Liebhaber der Reihe Ae 3/6
II, wenn diese in Luzern vor die
Lokomotive
Ae 4/7 gespannt wurde. Das war
nicht so selten der Fall, denn der Anstieg der Strecke von Emmenbrücke
nach Rothenburg hatte es in sich. Dort war dann auch die grosse
Ae 4/7
schnell am Anschlag. Das
Depot Luzern stellten dann eine
Vorspannlokomotive, welche danach oft bis Olten mitlief um zusätzliche
Halte zu vermeiden. Basel verlor die Nummer 10 435 und das
Depot Olten
musste die Nummer 10 447 abtreten. Beide
Lokomotiven tauchten ab 1928 in
einem zweitägigen Umlauf für das
Depot Bellinzona auf. Die beiden neu im Tessin
stationierten Maschinen wurden auf Bellinzona und Chiasso
aufgeteilt. Dabei erreichte der Dienst 1 ab Bellinzona die
Bahnhöfe Luzern
und Chiasso. Nach einer Strecke von 450 Kilometern endete die Fahrt
letztlich wieder im heimatlichen Depot.
Der Tagesdienst brachte nicht viele Kilometer
und dank den etwas flacheren Abschnitten konnte auch mit bescheidener Last
gefahren werden. Nur wenn es nach Bellinzona ging, musste das
Sicherheits-bremsverhältnis erfüllt sein. Obwohl die Maschinen ab Luzern und Arth-Goldau regelmässig nach Erstfeld und noch weiter in den Süden fuhren, war das Depot von Erstfeld nicht mit Ae 3/6 II bestückt worden. Dort konnte man
mit
Lokomotiven ohne
elektrische
Bremse nichts anfangen und so können wir
etwas vorgreifen und klar feststellen, dass sich daran bis zum Schluss
nichts ändern sollte. Geändert wurde hingegen die Stationierung im
Kreis
III, der nun noch ausstehend ist. Das
Depot Zürich musste die meisten Ae 3/6 II
ab-geben. So kamen die Nummern 10 401 bis 10 405 nach St. Gallen und die
Nummern 10 406 bis 10 409 nach Rorschach. Einzig die Nummern 10 410 bis
10 412 blieben in Zürich. So bleiben noch die Nummern 10 413 bis 10 416,
welche im Depot Romanshorn stationiert wurden. Daher waren sie im
Kreis
III auf vier verschiedene Standorte aufgeteilt worden und die konnten
damit nicht alle Züge decken. So verkehrten die
Lokomotiven im Osten auf nahezu
sämtlichen Strecken die mit
Fahrleitung versehen waren. Daneben kamen auch
vereinzelt Maschinen der Reihe Ae 3/6 I zum Einsatz. Zürich hatte keine
andere Wahl und so wurden die verbliebenen Ae 3/6 II gleich in Umläufen
verplant, die eigentlich für die Reihe Ae 3/6 I vorgesehen waren. So
blieben immer noch vereinzelte
Schnellzüge im
Dienstplan, auch wenn auch
hier die
Ae 4/7 ihr Unwesen trieben.
Damit wurde diese Baureihe
in der Schweiz zur schnellsten elektrischen
Lokomotive mit
Stangen-antrieb.
Selbst hinter den verbliebenen
Dampfma-schinen der Reihe
A 3/5 musste sie
sich nicht mehr verstecken. Die MFO-Maschine wurde zum Renner, der ihr
einen neuen Namen einhandelte. Wegen den verhältnismässig kleinen
Triebrädern bekam
der
Stangenantrieb eine recht hohe Tourenzahl. Man sah der Maschine
richtig an, wie sie sich abnabelte. So nervös wurde sie nun mit einem
Salamischneider verglichen, denn dort bewegte sich das Messer gleich
schnell. Nicht überliefert worden ist der Sound den diese Maschinen jetzt
machten und wie es im
Führerhaus schüttelte. Scheinbar bekam es den
Kollektoren
nicht allzu schlecht. Als Fazit der ersten Jahre kann festgestellt werden,
dass die
Lokomotive die meisten Strecken, die mit
Fahrleitung versehen
wurden, befuhren. In Richtung Westen war sie jedoch auf den Strecken
westlich von Bern und Biel völlig unbekannt. Selbst die
Probefahrt nach
einem Aufenthalt in der
Hauptwerkstätte führte die Maschinen in Richtung
Grenchen und Lyss. So könnte man meinen, dass die Positionen bezogen
waren. Doch bereits ab 1929 kam es zu erneuten
Verschiebungen. Die
Lokomotiven mit den Nummern 10 451 und 10 455 wurden
in Luzern abgezogen und neu nach Rapperswil verschoben. Dort waren nun
zahlreiche Strecken elektrifiziert worden und da konnte man diese
Maschinen gut gebrauchen.
Schnellzüge waren ab Rapperswil jedoch dünn
gesät, so dass sich die tapferen Maschinen zunehmend auch mit
Güterzügen
zu beschäftigen suchten.
Diese
waren wesentlich freizügiger einzuteilen, als die Modelle, die nicht über
diese
Bremse verfügten. Es zeigt sich jedoch, dass es damals doch noch
Un-terschiede zum
Flachland gab. Es sollte nicht lange so bleiben. Bereits ein Jahr später kehrten die ersten Maschinen wieder zurück nach Luzern. Zudem wurden die Dienste nun auf-geteilt.
Lokomotiven die über die neue
Sicherheitssteuer-ung verfügten, wurden in einmännigen Diensten geführt.
Die restlichen verblieben in den bisherigen zweimännigen
Dienstplänen. Auf
die Zuordnung der Nummern hatte das natürlich grosse Auswirkungen und so
wurde mit einzelnen Nummern gearbeitet. Zwar kamen die Maschinen immer noch ab Luzern ins
Tessin, aber es kehrten keine
Lokomotiven dorthin zurück. Die neuen
Modelle mit
elektrischer
Bremse hatten diese Strecke fest im Griff. Andere
Strecken hatten jedoch die Baureihe Ae 3/6 II nicht im Griff. Daher
mussten mit den ersten elektrifizierten
Nebenstrecken Beschränkungen
ausgesprochen werden. Diese befanden sich im
Kreis III, so dass sowohl die
Seetalstrecke, als auch der Gotthard befahren wurden. Ein Verbot wurde für die Strecken von Bäretswil nach
Bauma und für den Abschnitt von Bischofszell Nord nach Hauptwil
ausgesprochen. Dort kamen die
Brücken einfach nicht mit den hohen
Achslasten dieser Baureihe klar. Etwas besser war der Abschnitt Thalheim –
Ossingen, denn dort ging es alleine. Als
Vorspannlokomotive war hingegen nur ein
Triebwagen zugelassen. Sie sehen, es war immer noch nicht an einen
freizügigen Einsatz zu denken und diese Verbote sollten bleiben.
Darunter
befanden sich vermehrt auch längere
Güterzüge. Daher mussten die
Lokomotiven mit der
Güterzugsbremse ausgerüstet werden. Erneut kam es zum
kleinen Umbau. Die Baureihe Ae 3/6 II verkehrte nie westlich von Bern und Biel/Bienne. Mit der Zuteilung von Yverdon als verant-wortliche Hauptwerkstätte änderte sich das nur für den Unterhalt. Die
Probefahrt
nach einem Aufenthalt in der Werkstätte musste vom
Oberlokführer des
Depots Lausanne
durchgeführt werden. Es gab schlicht keinen Lokführer, der auf dieser
Maschine geschult worden wäre. Das wäre auch nicht leicht gewesen, da alle
Notizen in Deutsch verfasst wurden. So still und leise war die Maschine auch wieder
nicht. Oft wurde sie abgezogen und geschmückt um an Feierlichkeiten
teilzunehmen. Am 14. August 1934 führte sie daher den Eröffnungszug auf
der Strecke von Luzern über Langnau nach Bern. Dort konnte nun auch
elektrisch gefahren werden. Es gab für die Maschinen von Luzern neue
Arbeit, die natürlich gerne gesehen wurde. Das auch wegen der Tatsache,
dass kaum neue Modelle ausgeliefert wurden. Die Wirtschaftskrise sorgte dafür, dass sich die
Dienstpläne beruhigten. Es kam kaum zu Verschiebungen. Ein
Depot, das zu
viele
Lokomotiven hatte, versuchte zwar diese abzustossen, jedoch gab es
keine Abnehmer, denn diese hatten selber Maschinen, die verschwinden
sollten. Selbst das einzige grosse Depot der Kreise II und III, das noch
nie Ae 3/6 II stationiert hatte, winkte dankend ab. Dort hatte man zwei
arbeitslose Giganten im Stall.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2020 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Die
ausgiebigen
Die
ausgiebigen
 Die
Zuteilung zur
Die
Zuteilung zur
 Die
Die  Diese
dem
Diese
dem
 Als
letztes
Als
letztes
 Im
Im
 Die zweite ab Chiasso eingesetzte Maschine ersetzte
eine Dampflokomotive und übernahm lediglich deren Arbeit. Dabei fuhr sie
nach Lugano und verrichtete dort den
Die zweite ab Chiasso eingesetzte Maschine ersetzte
eine Dampflokomotive und übernahm lediglich deren Arbeit. Dabei fuhr sie
nach Lugano und verrichtete dort den 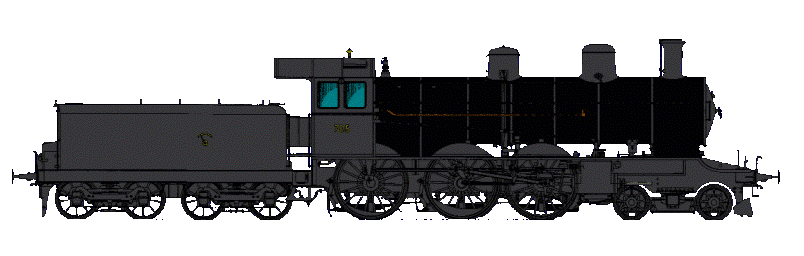 1928 sollte das letzte Jahr sein, wo die Reihe Ae 3/6
II mit 90 km/h verkehrte. Auf das Jahr 1929 wurde die
1928 sollte das letzte Jahr sein, wo die Reihe Ae 3/6
II mit 90 km/h verkehrte. Auf das Jahr 1929 wurde die
 Auch die anderen Maschinen in Luzern wurden
ab-gezogen, so dass die Zentralschweiz von dieser Baureihe befreit wurde.
Auch das Tessin gab seine Ae 3/6 II wieder ab. Dort erwartete man die
ersten Maschinen der neuen Baureihe
Auch die anderen Maschinen in Luzern wurden
ab-gezogen, so dass die Zentralschweiz von dieser Baureihe befreit wurde.
Auch das Tessin gab seine Ae 3/6 II wieder ab. Dort erwartete man die
ersten Maschinen der neuen Baureihe
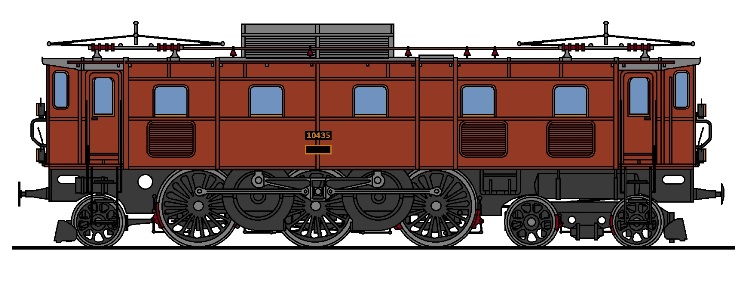 Jedoch gab es in der Ostschweiz auch Lichtblicke. Die
Ma-schinen erreichten mit Konstanz regelmässig einen deut-schen
Jedoch gab es in der Ostschweiz auch Lichtblicke. Die
Ma-schinen erreichten mit Konstanz regelmässig einen deut-schen