|
Umbau in Am 4/4 |
|||||||||||
| Navigation durch das Thema | |||||||||||
|
Kurz nach 1980 erkannten die Schweizerischen Bundesbahnen SBB,
dass bei einem Ausfall der Stromversorgung keine Züge mehr verkehrten. Die
vorhandenen Modelle mit
Dieselmotor
waren zu sehr in den Aufgaben gebunden, dass sie schnell bereit gestellt
werden konnten. Zudem waren die schweren Züge oft nur durch die grossen
Modelle der
Baureihe
Bm 6/6 zu schleppen. Diese wurden
aber auch im schweren
Verschub
benötigt.
Die etwas kleinere Reihe Bm 4/4
war kaum in der Lage die Lasten alleine zu ziehen. Hier sollten in den
nächsten Jahren neue
Diesello-komotiven
beschafft werden. Jedoch war man sich dort noch nicht mit dem Typ einig. Schwere Gleisumbauzüge, der Einsatz im Ver-schub und wo es ging noch als Reserve vor dem Hilfswagen war für die Serie Bm 6/6 zu viel. Wenn dann noch Reisezüge mit Dieseltraktion geführt werden mussten, ging es schlicht nicht mehr mit der Menge. Auch wenn diese Unter-brüche planbar waren,. Die
raren Maschinen mussten zugeführt wer-den. Es fehlte in der Schweiz an
leistungs-fähigen
Diesellokomotiven
und die sollten be-reits vorhanden sein. In der Not blickte man über die Grenzen. Dabei waren die Baudienste sehr eifrig und die sonst für Beschaffung zuständige Abteilung Zugförderung wurde übergangen. Wer einfach sucht, der wird oft fündig und das war in Deutschland. Dort wurden die Modelle der Baureihe BR 220 aus dem Verkehr genommen. Die Deutsche Bahn DB hatte leistungsfähigere Baureihen. Auf die alten Diesellokomotive konnte man daher verzichten.
Wie so oft, wenn unerfahrene Leute sich mit etwas befassten, gab
es Punkte die blendend waren. Bei der BR 220 war das die für Schweizer
schier gigantische
Leistung.
So hätte man das Problem gleich an der Wurzel packen können. Jedoch war
die spätere
Baureihe
Am 841 schon weit fortgeschritten.
Der Handel war daher kaum nötig, denn wenn es nur um wenige Jahre ging,
boten sich Mieten an. Doch dann hätte die Zugförderungen mitgeredet.
Nur schon dieser Zwischenhandelt zeigt, wie unerfahren die Leute
waren, denn der Zwischenhändler sorgte für einen deutlich höheren Preis,
als das direkt der Fall ge-wesen wäre. Einen Weg der vermutlich die
Abteilung Zugförderung dank den Erfahrungen gewählt hätte.
Schliesslich wurde im Oktober 1986 der Liefervertrag
unterschrieben. Darin war umschrieben worden, dass im Kaufrecht sieben
Lokomotiven
der
Baureihe
BR 220 und somit von ehemaligen V 200 beschafft wurden. Diese sollten die
Lücken bis zur Auslieferung der geplanten Baureihe
Am 841 füllen. Dabei wurde
der erforderliche Umbau und die Instandstellung in Deutschland und dort
bei der Regentalbahn AG in Viechtach Bayern vorgenommen.
Genau genommen kamen die Maschinen mit den Nummern 220 013 bis
017, 053 und 077 in den Umbau. Aus diesen sollten die Modelle der neuen
Baureihe
Am 4/4 werden und die Betriebsnummern wurden nach den helvetischen Normen
vorgenommen. Es waren dies die Nummern 18 461 bis 18 467. Die Reihenfolge
der ursprünglichen Modelle in Deutschland wurde dabei beibehalten und
lediglich die recht grossen Lücken wieder aufgefüllt.
Es wurde zudem beschlossen, dass die Arbeiten nur zum Teil bei der
Regentalbahn AG vorgenommen wurden. Sowohl die Anschriften, als auch die
Bauteile des
Funkes
und der
Zugsicherung
sollten in der Schweiz vorgenommen werden. Das Problem beim Funk und bei
der Zugsicherung war, dass diese nicht in jedem Fall zum in Deutschland
üblichen
Lichtraumprofil
passten. Daher montierte man diese erst in der Schweiz. |
|||||||||||
|
Arbeiten bei Regeltalbahn AG |
|||||||||||
|
Kommen wir zu den Arbeiten, die von der Regentalbahn AG
vorgenommen wurden. Nach Ankunft der
Lokomotiven
wurde eine
Hauptrevision
vorgenommen. Diese mit einer
Revision
R3
vergleichbaren Arbeiten wurden aber auch für die verlangten Anpassungen
genutzt. Es waren also intensive Arbeiten, die nicht in vollem Umfang von
den Leuten der relativ kleinen Bahn vorgenommen werden konnten. Wir müssen
genauer hinsehen.
Das
betraf natürlich auch die
Antriebe
mit den
Diesel-motoren.
Diese speziellen Arbeiten mussten ausserhalb vergeben werden, denn die
erforderlichen Kenntnisse waren nicht vorhanden und für so eine kleine
Serie lohnte sich das auch nicht.
Die
Antriebe
mit den
Getrieben
und die
Dieselmotoren
der
Bauart
Maybach wurden durch das Ausbesserungswerk der Deutschen Bahn DB in
Nürnberg vorgenommen. Dieses Werk entsprach den in der Schweiz geläufigen
Hauptwerkstätten.
Es waren also Leute am Werk, die über die Erfahrungen mit den Komponenten
verfügten. Viele andere Reihen der DB besassen ähnliche Antriebe und daher
waren die Arbeiten kein so grosses Problem. Dabei erfolgte dort eine normale Revision der Antriebe und der Dieselmotoren und es wurden keine Anpassungen vorgenommen. Mit anderen Worten der hier nötige Umbau fand nicht statt, denn die Maschinen wurden in dem Zustand übernommen, den sie nach dem Betrieb der Deutschen Bahn DB hatten. Daher kamen wieder die gleichen Bauteile in die Lokomotiven, die während dieser Zeit bei der Regentalbahn AG behandelt wurden.
Nicht mehr benötigte Komponenten wurden einfach nur ausgebaut. Das
umfasste die
Zugsicherung
und die
Dampfheizung.
Letztere wurde in der Schweiz bereits seit vielen Jahren nicht mehr
genutzt und daher konnte auf die Anlage ohne Probleme verzichtet werden.
Das damit die
Dieselmotoren
aber nicht mehr vorgeheizt werden konnten, wurde eine
Vorwärmanlage
installiert, die mit dem
Dieselöl
betrieben werden konnte.
Beim neuen Einsatz sollten sie in erster Linie in der Nacht verwendet werden und daher musste gegen den Lärm angekämpft werden und das war gar nicht so einfach. Bei
Dieselmotoren
sind die
Abgase
das grosse Problem und daher wurden dort bereits
Schalldämpfer
verbaut.
Diese
Schalldämpfer
wurden verbessert und auch die Auslässe für die
Abgase
wurden neu gestallten. Diese waren nach den Arbeiten auf dem Dach zu
erkennen. So sollte der Lärm reduziert werden und die Schweizerischen
Bundesbahnen SBB gaben dabei einen bestimmten Wert vor. Gerade dem
Lärmschutz wurde in der Schweiz schon immer eine grosse Bedeutung
angemessen. Wir erinnern uns an die Reihe
Bm 4/4, die sehr leise war.
Die Ergebnisse der Massnahmen mussten verifiziert werden. Dabei
wurden die damit verbundenen Messungen von einer dritten Firma
vorgenommen. Diese unabhängige Lösung sollte verhindern, dass es zu
Differenzen kommen konnte, denn hier waren die Vorstellungen sehr weit
entfernt. Das Gutachten ergab, dass die Arbeiten den erhofften Erfolg
brachten und daher konnten die weiteren Maschinen so umgebaut werden.
Zum Schluss wurde dann noch der Anstrich erneuert. Dieser wurde
nach den Regeln der Schweizerischen Bundesbahnen SBB ausgeführt. Es war
daher zu sehen, dass diese Angaben nicht so genau erfolgten, wie das
üblich war. So wurden die
Puffer
mit einen weissen Rand versehen. Eine Massnahme, die zwar bei der
Regentalbahn AG bekannt war, die aber in der Schweiz nicht umgesetzt
wurde. Es war ein Farbtupfer vorhanden. |
|||||||||||
|
Arbeiten der HW Biel |
|||||||||||
|
Der Zustand der
Lokomotiven
bei Ankunft warf viele Fragen auf. Sie hatten einen neuen Anstrich, der
jenem der Schweizerischen Bundesbahnen SBB entsprach, aber es gab schlicht
keine Hinweise. Die Lokomotive war nackt und kannte keine Beschriftungen.
Damit kann man sich fragen, ob denn niemand wissen durfte, dass man die
Modelle auf recht dubiosen Wegen gekauft hatte? Jedoch verriet nur schon
der Weg, was es damit auf sich hatte.
Letztere konnte wegen den neuen Bauteilen nicht früher eingebaut
werden. Der Grund lag in der Tatsache, dass die Magnete gegen die Mitte
verschoben wurden und sich so seitlich stark verschieben konnten und das
ging in Deutschland nicht. Bei den heute international einsetzbarem Modellen, sind die Magnete immer an den Drehgestellen zu finden. Damit gibt es keine grossen Probleme mit den Zulassungen. Die nun als Reihe Am 4/4 geführten Maschinen konnten nach den Massnahmen nicht mehr in Deutschland einge-setzt werden.
Wie so oft, wurde ein kleines Bauteil dafür verantwortlich
gemacht. Mit der
Zugsicherung
konnte in der Schweiz ohne Probleme gefahren werden. Verändert wurden auch die akustischen Signalmittel. Die gut funktionierenden Hörner wurden durch einfache Lokpfeifen ersetzt.
Die helvetisierte
Lokomotive
bekam also die passende Landesprache. Damit wurde sie etwas leiser und für
die Ohren der Anwohner gewohnter. Ob man die komische Lokomotive so gut,
wie es nur ging tarnen wollte, denn eine neue
Lokpfeife
ist nun wirklich keine notwendige Arbeit einer
Hauptwerkstätte.
Eher wegen den Ersatzteilen, wurde auch das
Steuerventil
ersetzt. Das von der Firma
Westinghouse
stammende Bauteil war ein Problem beim Unterhalt, denn niemand kannte
diese Steuerventile. Mit dem Einbau eines aus Oerlikon stammenden Modell
wurde das umgangen. Damit hatten die
Lokomotiven
nun die üblichen
Bremsen
erhalten. Die
R-Bremse
blieb und nur im Bereich der
Personenzugsbremse
gab es einen höheren Wert.
Auch dort waren einfach ungewohnte Lösungen vorhanden und das
Lokomotivpersonal
hatte sich an die Modelle aus Oerlikon gewöhnt. Daher machte man kurzen
Prozess und baute einfach die alten Modelle aus und nahm ein paar
Exemplare aus dem
Lager.
Die
Vor-heizanlage
wurde dabei auch verändert. Da die Lokomotive über keine Anschriften verfügte, wurden diese noch aufgetragen. Dazu wurde weisse Farbe verwendet und die Anschriften aufgeklebt. Seitlich wurden an der Lokomotive die Anschriften der Bahn angebracht.
Diese bestand aus dem Signet und den Abkürzungen in den drei
befahrenen Landesprachen. Es war eine Lösung, die auch bei anderen
Fahrzeugen des Baudienstes üblich war und so konnte man die Modelle
zuordnen. An den beiden Seiten und bei den Fronten wurden schliesslich noch die Nummern angebracht. Diese lauteten 18 461 bis 18 467 und damit waren sie klar als Modelle mit Dieselmotor ausgewiesen worden.
Spannend dabei war eigentlich nur, dass die Maschinen sehr nahe
zur Nummerngruppe der
Baureihe
Bm 4/4 lagen. Das war aber
wegen der vergleichbaren
Achsfolge
erforderlich und von der erwähnten Baureihe gab es keine neuen Exemplare
mehr.
Zum Schluss kommen wir zur Bezeichnung. Die weiterhin für 140 km/h
ausgelegte Maschine schaffte die Bedingungen für die
Zugreihe R
nicht. Daher musste das Tempo auf 120 km/h verringert werden. Damit war
der Buchstabe R in der Bezeichnung weg und die
Lokomotiven
wurden als Am 4/4 geführt. Mit 120 km/h sollten es aber die schnellste
Diesellokomotiven
in der Schweiz sein, denn diese waren hier kaum als Sprinter unterwegs.
|
|||||||||||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |||||||||
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | ||||||||
|
Copyright 2025 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||||||||||
 Ein
Nachbau dieser
Ein
Nachbau dieser
 Um
den Verkauf so gut es ging an den Fachstellen vorbei zu lotsen, wurde der
Handel über die in Lichtenstein an-sässige Firma Jelka Establishment aus
Schaan vermittelt.
Um
den Verkauf so gut es ging an den Fachstellen vorbei zu lotsen, wurde der
Handel über die in Lichtenstein an-sässige Firma Jelka Establishment aus
Schaan vermittelt.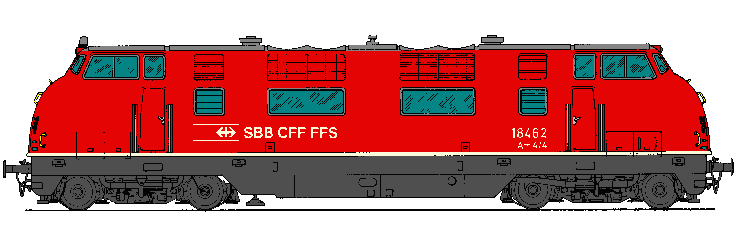 Bei
einem Punkt wurden jedoch Anpassungen vorge-nommen. Die
Bei
einem Punkt wurden jedoch Anpassungen vorge-nommen. Die
 Nach
Ankunft in der
Nach
Ankunft in der
 Wir
gross die Probleme mit den
Wir
gross die Probleme mit den