|
Betriebseinsatz |
|||||||||||
| Navigation durch das Thema | |||||||||||
|
Wenn wir nun zum Betriebseinsatz kommen, dann müssen wir
berücksichtigen, dass die Maschinen in zwei Ländern eingesetzt wurden und
sie ihre Karriere nicht in der Schweiz begannen. Um etwas von der
Betriebsgeschichte zu erfahren, müssen wir zuerst nach Deutschland
blicken. Dabei werden wir aber eher allgemein bleiben, denn die genauen
Dienstpläne
sind nicht so wichtig, denn es geht ja um die Modelle in der Schweiz.
Die neuen Maschinen dienten als direkter Ersatz für die
Dampflokomotiven. Man wechselte also nur die
Lokomo-tive
und nicht das Konzept der Strecken. Eine Massnahme, die wegen dem grossen
Streckennetz mit geringen Kosten möglich war.
Die neuen
Diesellokomotiven
wurden im ganzen Land auf den nicht elektrifizierten Strecken eingesetzt.
Wo eine
Fahrleitung
montiert wurde, setzte man auch bei den Bahnen in Deutschland die
passenden
Lokomotiven
ein. Die neuen Maschinen brachten für die Anwohner einen Vorteil, denn der
Rauch und der Russ waren nicht mehr vorhanden. Die frisch gewaschene
Wäsche entlang der Strecken blieb nun auch weiss.
Bedingt durch diesen Einsatz kamen die
Lokomotiven
auch auf den Strecken nahe der Schweiz zum Einsatz. Dabei war gerade die
Strecke zwischen Lindau und München im
Dienstplan
zu finden. Teilweise kamen diese zugkräftigen Maschinen aber auch auf der
Schwarzwaldbahn zum Einsatz. Daneben waren auch viele andere Strecken
enthalten und mit den
Diesellokomotiven
konnten mehr Züge geführt werden, da nicht frisches Wasser gefasst werden
musste.
Ab dem Jahre 1962 kamen die verstärkten Modelle der Baureihe V
200.1 in den Betrieb. Diese waren für die steigungsreichen Strecken nahe
der Schweiz besser geeignet und so wurden die älteren Modelle nach einem
kurzen Einsatz im Süden des Landes bereits wieder verdrängt. Sie sehen,
dass es auch hier nur um die
Leistung
ging, denn nur so konnten auch höhere Geschwindigkeiten ausgefahren
werden, was nicht neu ist.
Zu finden waren die Modelle der Reihe V 200 in nahezu allen
Betriebswerken im Norden. Die
Lokomotiven
hatten ihre Regionen gefunden und daran sollte sich so schnell auch nichts
mehr ändern. Die steileren Abschnitte gehör-ten den stärkeren Modellen. Als man in Deutschland auf die neuen Bezeichnungen mit den sechsstelligen Nummern für die neuen Computer um-stellte, wurde aus der ehemaligen V 200 die Baureihe 220. Die kräftigeren Modelle mutierten zur Reihe BR 221.
An den Einsätzen änderte sich damit jedoch nichts mehr. Die
Positionen waren bezogen worden und nur vereinzelt mussten Maschinen
umziehen, denn auch in Deutschland wurden neue
Fahrleitungen
montiert.
Weniger Strecken ohne
Fahrleitung
und neue
Baureihen,
die auch eine elektrische
Zugsheizung
hatten, führen dazu, dass die
Lokomotiven
vermehrt vor
Güterzügen
ver-kehrten. Jedoch konnten sie sich auch dort nicht mehr vor der grossen
Zahl neuer Modelle erwehren. Ab dem Jahr 1978 wurden daher die ersten
Maschinen abgestellt und nicht mehr verwendet. Es gab keine passenden
Strecken mehr und auch sonst fehlte es an
Leistung.
Offiziell ausgemustert wurden die
Lokomotiven
der
Baureihe
220 im Jahre 1984. Jedoch erfolgte kein sofortiger Abbruch. Die nicht ganz
30 Jahre alten Maschinen waren schlicht noch zu jung für den
Schneidbrenner. Auch wenn es keine Einsätze mehr gab, es bot sich die
Möglichkeit, die Lokomotiven zu verkaufen. Dabei kamen Modelle nach
Italien und sieben Stück davon sogar in die Schweiz, wo man nicht mit
solchen Maschinen rechnen konnte.
Obwohl
dieselhydraulische Maschinen für den Ein-satz angepasst werden
müssen, glaubten die Käu-fer, dass das kein Problem sei. Dumm, wenn der
Käufer nur Erfahrungen mit
dieselelektrischen Lös-ungen hatte, denn dort ist viel möglich. Die Umbauarbeiten wurden in den Jahren 1987 und 1989 vorgenommen. Dabei wurden die alten Ma-schinen zuerst an die Regentalbahn AG überstellt. Diese sollte die Hauptrevision und erste Anpass-ungen vornehmen.
Es stellt sich die Frage, warum man die Arbeiten nicht der eigenen
Hauptwerkstätte
übertrug. Ver-mutlich sollten die neuen
Lokomotiven
so gut es ging geschmuggelt werden. Ob man sich da wirk-lich sicher war?
Nach Abschluss der Arbeiten wurden erste
Probe-fahrten
auf der Regentalbahn AG ausgeführt. Diese dienten der Kontrolle und auch
den Lärmmessungen. Das Modell war einfach zu laut für Schweizer Ohren und
musste daher leiser werden. Die alte Maschine musste nur noch schnurren
und das natürlich auch mit der Kontrolle einer externen Firma. Die machte
für die Arbeiten auch wieder Kosten geltend und das verteuerte die
Lokomotiven.
Man wusste in gut informierten
Kreisen
schnell, dass dieser Handel alles andere als logisch war. Gekauft wurden
sie über einen Zwischenhändler, revidiert von einer eher unerfahrenen
Gesellschaft und dann noch Kontrollen durch externe Firmen. Der Schrott
aus Deutschland wurde für die Schweiz vergoldet. Ob da wirklich alles mit
rechten Dingen zuging, darf bezweifelt werden, denn es wäre wirklich viel
einfacher gegangen.
Danach knurrte die
Lokomotive
nach Biel, wo sie schnell in der
Hauptwerkstätte
verschwand. Nicht nachvollzieh-bar ist, warum die Anschriften und Nummern
nicht ange-bracht wurden. Diese alleine hätten die Überführung kaum
verhindert.
Auch wenn wir es mit einer erprobten Maschine zu tun haben, die
erste wurde intensiven
Versuchsfahrten
unterzogen. Begonnen hatten diese im November 1987. Neben Fahrten zur
Bestimmung der Einstellungen, fanden auch erste Schulungen für das
Personal dieser Fahrten statt. Auch dieses musste sich an die andere
Bedienung gewöhnen. Besonders der
dieselhydraulische
Antrieb
war ausgesprochen ungewohnt bei Anfahrten in Steigungen.
Die
Lastprobefahrten
fanden zwischen Biel/Bienne und Reuchenette statt. Die Strecke war in der
Nähe der
Hauptwerkstätte
und mit den Steigungen konnte sie mit dem Gotthard mithalten. Ideal für
die neue
Diesellokomotive,
die aber bei den durchgeführten
Probefahrten
kaum je langsam fahren musste und das war bei diesem
Antrieb
durchaus ein Problem. Wie gross es sein würde, wusste man schlicht noch
nicht.
Als die zweite Maschine bereit stand, kam es zu den Fahrten in
Vielfachsteuerung.
Dazu wurden zwei Maschinen der Reihe Am 4/4 verbunden und vor einen Zug
mit beladenen Wagen der
Gattung
Xas gespannt. Am Schluss des mit neuem
Schotter
beladenen Zuges befand sich dann noch eine
Lokomotive
der
Baureihe
Re 4/4 II. Sie simulierte mit
der
elektrischen
Bremse unterschiedliche Lasten und konnte den Zug auch
abschleppen.
Damit wurde die Tatsache bezeichnet, dass nur direkt betroffenes
Personal geschult werden soll. Andere Bereiche mussten jedoch nicht
berücksichtigt wer-den. Der Aufwand minderte sich. Sämtliche Maschinen sollten im Kreis I stationiert werden. So falsch war diese Idee nicht, denn die meisten grossen Maschinen der Reihe Bm 6/6 waren in den grossen Rangierbahnhöfen stationiert worden.
Insbesondere der Raum Basel und das Tessin waren gut bestückt. So
schied der
Kreis
II aus und ähnliches galt auch für den Kreis III, der auch genug
Bm 6/6 hatte. Das auch weil
hier noch eine Strecke ohne
Fahrdraht
vorhanden war. Die Maschinen der Reihe Am 4/4 wurden an mehrere Standorte verteilt. So bekamen die Depotinspektionen in Bern und Lausanne je zwei Exemplare.
Die noch verbliebenen drei Maschinen kamen jedoch an die Standorte
Biel/Bienne, Brig und Genève. Ge-rade ganz im Westen war eine schnelle
Lokomotive
nicht schlecht, da die Strecke nach La Plaine nicht passend elektrifiziert
wurde. Sonst war der
Hilfswagen
die Hauptarbeit.
Was für das Personal galt, wurde auch im Unterhalt umgesetzt.
Dieser sollte im
Depot
Bern erfolgen. Das bedeutete, dass die
Lokomotiven
immer wieder zwischen den Standorten verschoben wurden. Dabei wurden sie
oft in
Schleppfahrt
überführt und eine der beiden in Bern stationierten Maschinen übernahm die
Aufgaben der normalen Maschine am betreffenden Standort. Das war bei fest
zugeteilten Modellen immer wieder der Fall.
Das ging soweit, dass nicht mit den üblichen Regelungen gearbeitet
werden konnte, denn die Bauteile passten nicht in die systematisierten
Register. So sorgten die Am 4/4 schon früh für einen grossen Aufwand. So richtig in Betrieb kamen die Maschinen jedoch nie. Wenn der Hilfswagen nicht benötigt wurde, blieb auch die Lokomotive stehen. Das wirkte sich natürlich auf die Kilometer aus. Für
die geringe Laufleistung waren die Modelle doch zu teuer beschafft worden.
Daher suchte man Arbeit und die gab es nicht so oft, wie man meinen
könnte, denn vor schweren
Bauzügen
sah man sie überraschend selten und das war eine geplante Aufgabe. Am 17. März 1991 wurden wieder Versuchsfahrten mit der Lokomotive unternommen. Jetzt ging es überraschend weit in den Osten.
Es wurde untersucht, ob mit den Maschinen aus Deutsch-land die
Strecke von Etzwilen nach Rielasingen mit der Reihe Am 4/4 befahren werden
könnte. Die ehemalige V 200 sollte dabei wieder einmal deutschen Boden
unter die Füsse bekommen. Jetzt einfach als Modell aus der Schweiz.
Der Grund für diese Fahrten war die Rheinbrücke bei Heimishofen.
Diese war schon recht alt und so mussten zum Schutz die
Meterlast
verändert werden. Mit den kurz ausgefallenen
Diesellokomotiven
der Schweizerischen Bundesbahnen SBB ergaben sich Probleme. Die Reihe Am
4/4 war in dem Punkt wegen der grossen Länge gut aufgestellt. Zu einem
Einsatz kam es jedoch nicht, da auch
Bm 6/6 und
Bm 4/4 mit
Schutzwagen genommen werden konnten.
Wegen der Versorgung dieser in Italien befindlichen Strecke kam es zur Situation, dass ganze Abschnitte ohne Spannung waren.
Das galt insbesondere für den Abschnitt neben der Bau-stelle, da
auf dieser Strecke die beiden
Geleise
noch nicht getrennt worden waren. Die Arbeiten sollten dieses Pro-blem
lösen.
Solche Arbeiten sind von langer Hand geplant. So war klar, dass
der
Güterverkehr
eingestellt werden soll. Die Züge wurden über den Gotthard umgeleitet,
oder einfach abgestellt. Das war jedoch mit den
Reisezügen
nicht möglich. Diese sollten trotz der Arbeiten geführt werden und dabei
kam ein spezielles Konzept zum Einsatz, bei dem die elektrische
Lokomotive
mitgeführt wurde. Die
Diesellokomotive
arbeitete nur bei fehlender
Spannung.
Neben den Am 4/4 kamen als thermischer
Vorspanndienst auch Modelle aus Italien zum Einsatz. Sie schleppten
den Zug im unterbrochenen Abschnitt, danach übernahm wieder die
elektrische Maschine und der Zug konnte wieder schneller verkehren. Die
zwar nicht mehr benötigte Maschine blieb bis zum nächsten planmässigen
Halt am Zug und das waren die
Bahnhöfe
von Brig und Domodossola. Erstmals konnte die Am 4/4 zeigen, was sie
konnte.
Speziell war die Situation in Genève. Die auf der Strecke nach La
Plaine eingesetzten
Triebwagen
funktionierten eher schlecht. Wenn dann keine mehr für den Einsatz bereit
stand, wurde auf
Diesellokomotiven
umgestellt. Auch wenn die Reihe Am 4/4 mit der
Höchstgeschwindigkeit
von 120 km/h schneller war, kam sie sehr selten vor dem speziellen Zug zum
Einsatz. Das Problem war, dass man in La Plaine den Zug umfahren musste.
Es waren immer noch die alten
Getriebe
verbaut und diese hatten wirklich eine lange Zeit hinter sich. Ersatzteile
dafür waren nicht so leicht zu be-schaffen. So gab es immer wieder einen
längeren Aufenthalt in der Werkstatt. So schlimm war das jedoch nicht. Die Baureihe war für den Einsatz vor den Bauzügen schlicht nicht geeignet. Mit den hydraulischen Getrieben konnten die langsamen Geschwindigkeiten nicht so gut gehalten werden, als das mit den Modellen aus der Schweiz der Fall war.
Hier zeigte sich der Vorteil des
dieselelektrischen
Antrieben,
denn der hatte mit den sehr geringen Geschwindigkeiten keine Probleme und
konnte sie lange halten.
Das wirkte sich natürlich auf die Laufleistungen aus. Bei allen
sich in der Schweiz befindlichen Modellen lagen die Am 4/4 am Schluss. Die
Maschinen wurden wirklich nur in Betrieb genommen, wenn es nicht anders
ging. Eine gute Karriere sah anders aus. Insbesondere dann, wenn diese
Situation bereits kurz nach der Auslieferung eintrat. Ausser den erwähnten
Abstechern gab es kaum Bereiche, wo damit gearbeitet werden konnte.
Wie so oft, in solchen Situationen konnte sich das Personal nicht
zurück halten. Die
Lokomotiven
wurden schlicht nur als aufgemöbelter Schrott bezeichnet. So schlimm der
Name für die Lokomotive war, er stimmte. Die Maschinen standen damals in
Deutschland und warteten auf den Schrotthändler. Diesem entronnen, etwas
frische Farbe drauf und dann ging es in den Export. Wirklich beliebt waren
diese Modelle bei niemandem.
Der spezielle Zug machte dabei in Erst-feld halt und so konnten die noch jungen Heizer das komische Gefährt etwas ge-nauer ansehen.
Es war der Tag, als ich in eine Am 4/4 kam. Es sollte auch gleich
der letzte ge-wesen sein. Was die
Lokomotive
im Tes-sin suchte, entzieht sich meiner Kennt-nis. Der Zug fuhr nach
Luino. Bereits im Jahre 1994 ging es mit dem Einsatz zu Ende. Die Baureihe Am 841 kam in Betrieb und so hatte man Modelle mit hoher Leistung. Wenn diese auch nicht so hoch war, wie bei der Reihe Am 4/4.
Die aus Spanien kommenden neuen Ma-schinen funktionierten
immerhin. Die Folge davon ist klar, bis im Jahr 1996 waren alle Modelle
der Reihe Am 4/4 der
Ausrangierung
zugeführt worden. Nur, was damit geschehen soll, war noch offen.
Der Edelschrott, wie man meinte, könnte ja verkauft werden. So
wäre das finanzielle Debakel nicht so gross. In der Schweiz gab es
schlicht niemand, der sich an den
Lokomotiven
die Hände verbrennen wollte. Die Technik und die Auslegung für schnelle
Züge passte einfach nicht in die Schweiz, denn dort wurden solche Züge
schon seit Jahren elektrisch geführt. Daher erfolgte die
Ausschreibung
international, wo man sich mehr Chancen ausrechnete.
Es kam zum Verkauf und so wurden die erneut ausrangierten
Lokomotiven
zwischen dem 28. Februar 1995 und 30. November 1996 verkauft. Dabei
kehrten alle nach Deutschland zurück. Die Geschichte der Baureihe Am 4/4
endete daher in dem Moment, wo die geschleppten Maschinen die Schweiz im
Raum Schaffhausen wieder verliessen. Die Geschichte endet hier, denn zu
Hause, wird auch wieder mit der alten Bezeichnung gearbeitet.
|
|||||||||||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |||||||||
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | ||||||||
|
Copyright 2025 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||||||||||
 Gebaut
wurden die
Gebaut
wurden die
 Mit
zunehmender Zahl von V 200.1 wurden die älteren Ma-schinen in den Norden
des Landes verdrängt. Dort waren flachere Strecken vorhanden und damit
konnten sie besser eingesetzt werden.
Mit
zunehmender Zahl von V 200.1 wurden die älteren Ma-schinen in den Norden
des Landes verdrängt. Dort waren flachere Strecken vorhanden und damit
konnten sie besser eingesetzt werden. Auf
dubiosen Wegen kam es im Jahre 1986 zu einem Kauf von sieben Maschinen für
den Einsatz in der Schweiz. Die ehemalige Gemischtzugloko-motive sollte
dabei für
Auf
dubiosen Wegen kam es im Jahre 1986 zu einem Kauf von sieben Maschinen für
den Einsatz in der Schweiz. Die ehemalige Gemischtzugloko-motive sollte
dabei für 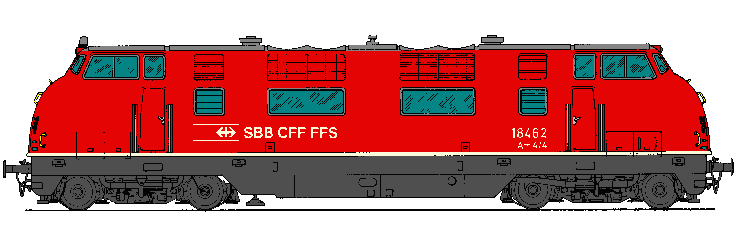 Am
28. August 1987 wurde die erste
Am
28. August 1987 wurde die erste
 Bei
den aus Deutschland stammenden
Bei
den aus Deutschland stammenden
 Der
schwere Unterhalt sollte in der
Der
schwere Unterhalt sollte in der
 Zu
einem ersten grossen Einsatz für die
Zu
einem ersten grossen Einsatz für die
 Auch
sonst mied man die
Auch
sonst mied man die
 Um
doch noch einen Lichtblick in der Karriere zu finden, dann kann der
Aus-flug einer Maschine ins Tessin erwähnt werden.
Um
doch noch einen Lichtblick in der Karriere zu finden, dann kann der
Aus-flug einer Maschine ins Tessin erwähnt werden.