|
Beleuchung und Steuerung |
|||||||||||
| Navigation durch das Thema | |||||||||||
|
Das
Bordnetz
für die
Beleuchtung
und die Steuerung ist bei einer
Diesellokomotive
umfangreicher, als das bei elektrischen Modellen der Fall ist. Hier
mussten nicht nur
Ventile
geschaltet werden, denn nur mit diesem Netz konnte der
Dieselmotor
gestartet werden. Erst wenn von den beiden Motoren einer lief, war davon
die Versorgung gesichert. Vorher musste also eine Quelle auf dem Fahrzeug
vorhanden sein.
Das war der Anlasser. Für die Versorgung dieses Bauteils, aber auch für die verbaute Be-leuchtung musste ein von den Dieselmotoren unabhängiges Bordnetz geschaffen werden. Wie bei Triebfahrzeugen üblich wurden dazu Bleibatterien verwendet. Bei diesen konnte eine Zelle eine Spannung von zwei Volt abgeben.
Diese mit einer Säure versehenen Elemente hatten sich bei den
Fahrzeugen durchgesetzt. Sie bedingten eine gewisse Wartung und mussten
von Zeit zu Zeit ersetzt werden. Das sorgte dafür, dass sie leicht
zugänglich sein mussten und das war hier nicht so leicht möglich, wie bei
anderen
Baureihen. Die in vorgefertigten Behältern verbauten Zellen wurden so geschaltet, dass bei der Loko-motive insgesamt eine Spannung von 110 Volt entstand. Zudem wurde hier die Kapazität auf einen Wert von 300 Ah festgelegt.
Die im Vergleich zu den Modellen in der Schweiz recht hohe
Spannung
war keine grosse Überraschung. Insbesondere in dem Fall, dass bei
Diesellokomotiven
auch in der Schweiz eine Spannung in dieser Höhe gewählt wurde.
Wenn wir bei der hier vorgestellten
Baureihe
nach dem Grund für diese Wahl suchen, dann finden wir diese in Deutschland
auch bei anderen Baureihen. Hier musste diese zudem gewählt werden, weil
die
Batterien
nicht nur für die Versorgung der Steuerung und der
Beleuchtung
benötigt wurde. Vielmehr mussten mit diesen
Bleibatterien
auch die
Dieselmotoren
gestartet werden. Alleine das verlangte nach einer grossen
Kapazität
bei den Batterien.
Damit konnte der zweite Motor bereits ab dem
Ladegerät
gestartet werden. Der Grund dafür lag bei den
Batterien,
denn trotz der hohen
Leistung
konnten sie nur einen Motor starten. Der Start eines Dieselmotors belastete die Bleibatterien sehr stark. Hin-zu kam, dass dabei bereits einige Beleuchtungen und die Steuerung aktiv waren. Ohne diese sah das Personal in der Nacht nicht, wie der Motor gestartet wird.
Licht war daher auch hier ein wichtiger Bestandteil dieses
Bordnetzen.
Auch wenn der
Maschinenraum
gut erhellt wurde, die
Inbetriebnahme
konnte auch mit einer bescheidenen
Beleuchtung
der Anlagen erfolgen. Wie bei allen Fahrzeugen üblich gab es mehrere Lampen. So wurde in den beiden Führerständen Licht für den Raum und die Anzeigen be-nötigt.
Für Arbeiten in der Nacht musste auch der
Maschinenraum
mit Lampen erhellt werden. Speziell bei diesen war, dass sie auch ohne die
Steuer-ung verfügbar waren. So konnten die wichtigen Arbeiten mit Licht
er-ledigt werden und wir können uns den Lampen aussen zuwenden.
Bei der
Stirnbeleuchtung
musste eine Anpassungen vorgenommen werden, denn die
Lokomotive
konnte nicht alle erforderlichen Bilder zeigen. Bei den unten über den
Puffern
montierten Lampen musste nichts verändert werden, mit den beiden unten
montierten weissen Leuchten, konnten die Bilder gezeigt werden. Das galt
auch für die drüber montierten roten Lampen, die für das
Zugschlusssignal
und das Warnsignal
benötigt wurden und gerade hier gab es das Problem.
Es handelte sich um die typischen Doppellampen, die so-wohl weiss,
als auch rot zeigen konnten. So war es nun möglich, alle in der Schweiz
gültigen
Signalbilder
zu erstellen. Wenn wir uns nun den Kernbereichen der Steuerung zuwenden, sind wir auch gleich bei der Bedienung. Diese fand in einem der beiden Führerstände statt und daher sollten wir einen davon ansehen.
Der Zugang erfolgte über eine der Türen und dann öffnete sich ein
hellgrau gestrichener schlichter Raum. An beiden Seitenwänden waren
Sitzgelegenheiten mon-tiert worden und anhand der Bedienelemente konnte
man erkennen, dass der Lokführer rechts sass.
Im überraschend kleinen
Führerpult
war die Arbeits-fläche mit den Bedienelementen und an vorderen Rand eine
Reihe Schalter vorhanden. Rechts davon befanden sich dann noch die
Bremsventile.
Anzeigen und
Instrumente
waren in einer Konsole unter dem
Frontfenster
angeordnet worden. All diese Teile des Führerpultes fanden in einem
ungewohnt kleinem Bereich Platz und Schreibflächen gab es nicht. Der
grösste Bereich des Raumes war ungenutzt.
Mit der Schalterreihe konnten die
Dieselmotoren
gestartet werden. Daneben wurde das Licht geschaltet und natürlich die
Erzeugung von
Druckluft
aktiviert. Es waren als die grundlegenden Schaltungen in diesem Bereich
vorzunehmen, denn nur wenige Handgriffe fanden im
Maschinenraum
statt und das oft auch nur, wenn es sich um Störungen handelte. Für diese
war schlicht keine Diagnose vorhanden, der Fahrer musste das Problem
suchen.
Somit wurde auch in Deutschland nicht losgefahren, ohne dass man
wusste, dass man bremsen kann. Gerade bei einer rund 80 Tonnen schweren
Lokomotive
ist das wichtig, denn so ein Teil hält man nicht einfach zurück, wenn es
ins rollen kam. Die Bremsbedienung der Knorrventile lasse ich weg, denn letztlich reagierten die Bremsen auf die gleiche Weise, wie bei den Modellen in der Schweiz. In der direkten Bremse wurde der Druck erhöht und in der automatischen Bremse der Luftdruck abgesenkt.
Diese erfolgte sogar in den gleichen Schritten, denn auch die
Stellungen war von der
UIC
geregelt worden. Nur so war gesichert, dass die Wagen überall gleich
reagierten. Mit Abschluss der Bremsprobe konnte mit der Lokomotive losge-fahren werden. Auch hier musste dazu zuerst die Fahrrichtung eingestellt werden.
Mit dem in der Mitte des
Führerpultes
montierten Bedienhebel wurde anschliessend
Zugkraft
aufgebaut. Es war jedoch kein eigentlicher
Steuerkontroller,
sondern nur ein Steuergriff verbaut worden. Mehr fand auf den kleinen
Führerpult auch keinen Platz mehr, es war wirklich sehr klein ausgefallen. Dieser auch Drehzahlregler genannte Griff, erhöhte die Drehzahl der Dieselmotoren in sechs Schritten. Diese Fahrstufen erscheinen ge-ring, aber sie wurden dynamisch geschaltet und das ergab eine feinere Regulierung.
Die Umschaltung der
Getriebe
erfolgte automatisch und damit auch die Anpassung der Drehzahlen bei den
Motoren. Der Lokführer stell-te die
Fahrstufen
ein und wartete dann, bis deren Ergebnis erreicht wurde.
Mit dem nun fahrenden Fahrzeug aktivierte sich die
Sicherheitsfahrschaltung,
die besser unter der Abkürzung
Sifa
bekannt ist. Das auf der
Lokomotive
verbaute System war von der
Bauart
RZM. Es arbeitete mit einem beim
Führerpult
montierten
Pedal.
Dieses musste niedergedrückt werden. Wurde das unterlassen, erfolgte ein
Warnton und nach zehn Sekunden wurde eine
Zwangsbremsung
eingeleitet. Mit dem Pedal konnte diese aufgehoben werden.
Die schweizerische Lösung montierte man erst nach Ankunft in der
Schweiz. Das Problem war, dass mit den Bauteilen der Schweiz die
Zulassung
für die Fahrt an die Grenze erloschen wäre. In der Schweiz konnte man
da-mals ohne
Zugsicherung
fahren. Soweit zu den wichtigsten Punkten der Steuerung. Je-doch verfügten die Maschinen auch über eine Vielfach-steuerung und diese wurde beibehalten.
So müssen wir hier etwas genauer hinsehen, denn eines war bereits
zu Beginn klar, das System passt zu keiner anderen
Lokomotive
und passende
Steuerwagen
gab es auch nicht. Es war eine auf diese
Baureihe
beschränkte Lösung vorhanden. Zumindest so lange, bis es wieder nach
Deutschland ging.
Eingebaut wurde die
Vielfachsteuerung
der
Bauart
1949. Sie war für den Betrieb von mehreren
Lokomotiven
ausgelegt worden, konnte aber auch die Signale von einem
Steuerwagen
übertragen. Daher war auch ein Einsatz in den
Wendezügen
möglich. Diese entsprachen den in der Schweiz üblichen
Pendelzügen,
wo die Lokomotive ab einem speziellen Wagen bedient wird. Die
Vielfachsteuerung liess den Betrieb von mehreren Maschinen zu.
Bei der
Dampfheizung
beschränkte man sich nur auf die Wagen. Es war also immer die
Lokomotive
bei den Wagen für deren
Heizung
zuständig. Soweit ent-sprach alles einem gezogenen Zug. Das sich unter dem rechten Puffer in einer Blinddose befindliche Kabel wurde in der Steckdose der anderen Lokomo-tive eingesteckt. Damit das immer ging, waren diese Steckdosen links montiert worden.
Es war also eine einfache
Verbindung
vorhanden. Danach konnten die
Lokomo-tiven
ab einer Maschine bedient werden. Auch wenn es ein massives Kabel war, mit
dieser
Vielfachsteuerung
konnten nur wenige Daten übermittelt werden.
So musste jede
Lokomotive
selber einge-schaltet werden. Es war also nicht mög-lich, die
Dieselmotoren
der ferngesteu-erten Lokomotive zu starten. Es wurden nur die Stellungen
des
Fahrschalters
übermittelt. Durch die automatische Regelung der Dieselmotoren und der
Getriebe,
konnte jedoch jede Lokomotive diese Signale nach den eigenen Regeln
umsetzen. Eine Störung führte nur dazu, dass im bedienten
Führerstand
eine Warnlampe leuchtete.
Mehr war nicht, es war also ein eher einfaches System. Wenn wir
dieses jedoch mit den in der Schweiz um diese Zeit vorhandenen
Vielfachsteuerungen
vergleichen, war auch nicht viel mehr vorhanden. Da aber elektrische
Modelle gesteuert wurden, mussten auch mehr Funktionen übertragen werden.
Bei den hier vorgestellten Modellen reichte das und die Einrichtung wurde
in der Schweiz für zwei
Lokomotiven
genutzt.
Obwohl mit den
Lokomotiven
hohe
Zugkräfte
vorhanden waren, wurde verzichtet. Im Vergleich lag die
Anfahr-zugkraft im Bereich der Reihe
Re 4/4 II und diese wurde mit
so einer Einrichtung versehen. Wobei oft die erste Maschine betroffen ist.
Umgekehrt war jedoch ein
Gleitschutz
vorhanden. Der war sicherlich sinnvoll, denn es konnte ja hohe
Bremskräfte
erzeugt werden. Diese konnten leicht zu blockierten
Rädern
führen. Die Einrichtung war jedoch nicht so aufgebaut worden, wie das in
der Schweiz der Fall war. Vielmehr erfolgte nur eine
Warnung
und das Personal musste reagieren. Einfache Systeme, die beim Bau
vermutlich auch dazu genutzt wurden um die Kosten gering zu halten.
Nach den Fahrten ging der Vorrat beim
Dieselöl
zu Ende und im Winder auch das Wasser im
Kessel.
Daher musste vor einer Abstellung in einem Betriebswerk zuvor noch die
Tankstelle aufgesucht werden. Während dort das Dieselöl in die
Tanks
gepumpt wurde, konnten Kontrollen am Fahrzeug vorgenommen werden. Wie bei
der Strasse gab es diese Falle, die den Griff arretierte. Der Unterschied
bestand nur darin, dass mehr
Diesel
gefördert wurde.
Die
Beleuchtung
und die Steuerung beenden wir zusammen mit der Bedienung mit der Trennung
einer
Doppeltraktion.
Nachdem angehalten wurde, trennte man alle
Verbindungen
und verbrachte das Kabel wieder in
Blinddose.
Danach mussten die
Lokomotiven
einzelnen ausgeschaltet werden. Wobei das natürlich nur erfolgte, wenn
beide abgestellt wurden. Damit wird es nun Zeit, was man denn nach der
Lieferung noch machen musste.
|
|||||||||||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |||||||||
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | ||||||||
|
Copyright 2025 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||||||||||
 Die
Lösung mit dem grossen Schlüssel um die
Die
Lösung mit dem grossen Schlüssel um die
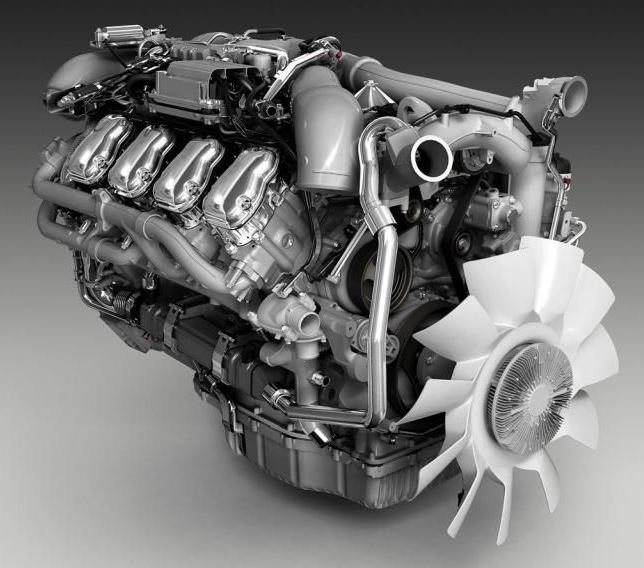 Auf
der
Auf
der
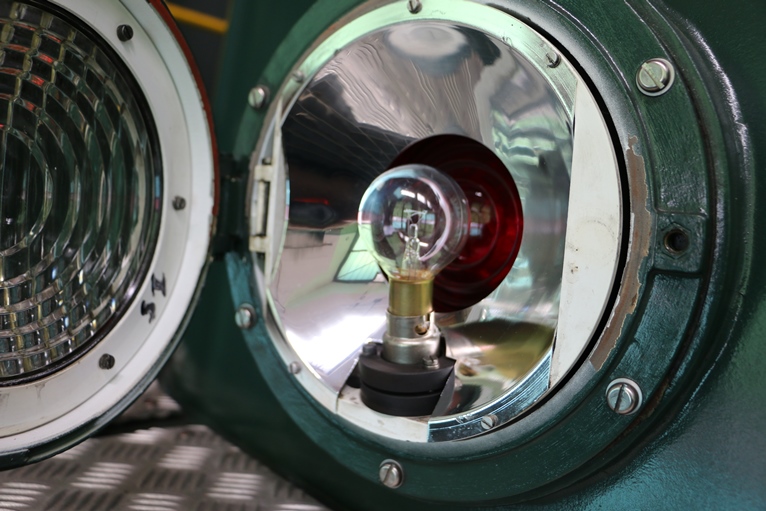 Bei
der oben im Bereich des Daches mittig montierten dritten Lampe musste eine
andere Lösung eingebaut werden. An Stelle der ursprünglich vorhandenen
Leuchte mit weissem Licht kam ein Modell der Schweizerischen Bundesbahnen
SBB zum Einbau.
Bei
der oben im Bereich des Daches mittig montierten dritten Lampe musste eine
andere Lösung eingebaut werden. An Stelle der ursprünglich vorhandenen
Leuchte mit weissem Licht kam ein Modell der Schweizerischen Bundesbahnen
SBB zum Einbau. Nachdem
die
Nachdem
die
 Man
kann eigentlich nur so viel sagen, die
Man
kann eigentlich nur so viel sagen, die
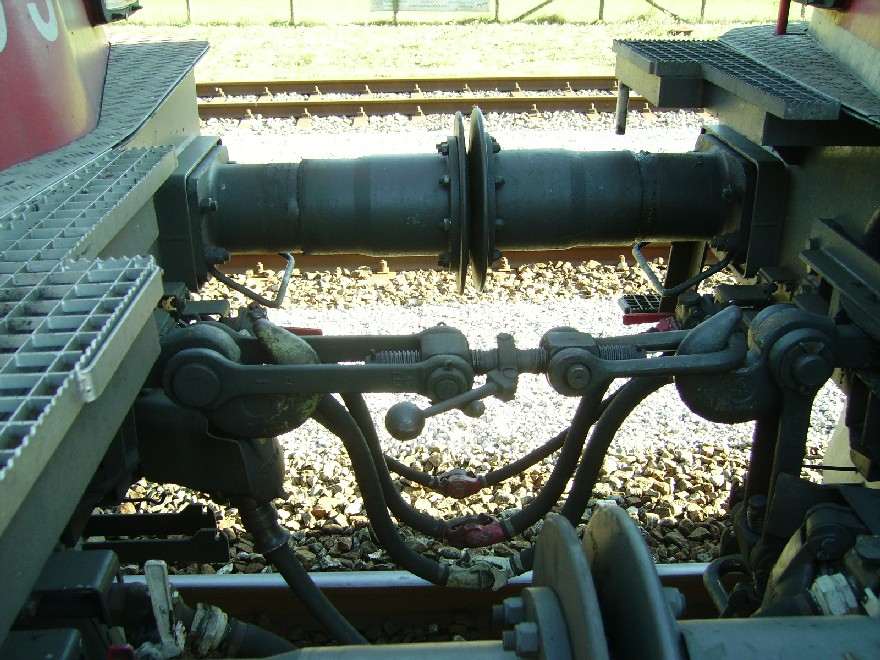 Eingerichtet
wurde das System einfach. Die beiden
Eingerichtet
wurde das System einfach. Die beiden
 Wir
alle rechnen damit, dass eine
Wir
alle rechnen damit, dass eine