|
Betriebseinsatz Teil 1 |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Jede
Lokomotive legte die ersten Kilometer geschleppt in
Güterzügen
zurück. Nach der Endmontage wurde sie geprüft und anschliessend über das
Anschlussgleis
der Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik SLM dem Kunden
übergeben. Somit hatte jede den Beginn der Karriere in Winterthur. Es
folgte anschliessend die Verteilung auf die einzelnen Bahndienste und die
Abgabe für den
Rangierdienst
der Betriebsführung.
Vielmehr wurden die dringend benötigten
Lokomotiven an diverse Orte in der ganzen Schweiz verteilt.
Wer eine Reise unternehmen musste, wurde noch im Werk für die
anschliessende
Schleppfahrt
vorbereitet. Zur Erinnerung sei erwähnt, dass die geschleppte Lokomo-tive mit 100 km/h überführt werden durfte. Eingereiht in den Güterzügen ergaben sich so keine Beschränkungen. Einziger Punkt, der beachtet werden musste, war in den grossen Rangierbahnhöfen zu beachten. Die geschleppte
Diesellokomotive
durfte die
Ablaufberge
nicht befahren. In eigener Fahrt, war dies jedoch kein Problem, da nun die
Talbremsen
nicht aktiviert wurden. Die Lokführer der Güterzüge wurden auf der neuen Bau-reihe Am 841 jedoch nicht ausgebildet. Für sie war es ein-fach eine besondere Last, die mitgenommen wurde. Diese
Anhängelast
wurde jedoch am
Endbahnhof
vom Be-dienpersonal übernommen. Es kamen dabei Lokführer der Baudienste,
aber auch solche der
Betriebsführung
in den Einsatz. Meistens betraf das jene Leute, die bereits auf der
Baureihe
Bm
4/4 geschult wurden. So war auch vorgesehen, dass jede neu
ausgelieferte Am 841 an ihrem Ziel die dort verkehrende
Bm 4/4 ersetzte. Diese war von
den Bereichen gemietet worden und wurde anschliessend wieder
zurückgegeben. Jedoch sollten wir uns nun endlich den Zielen der neuen
Maschinen zuwenden. Die Frage stellt sich, wer denn als erster beglückt
wurde. Dabei stand nicht einmal die Reihe
Bm 4/4 im Vordergrund, denn es
musste noch ein anderes Modell weg.
Die aus den Beständen der Deutschen Bahn DB
stammen-den ehemaligen V 200 waren daher die ersten Modelle, die
verschwanden. Oft auch durch eine freigestellte
Bm 4/4 abgelöst. Die neuen
Lokomotiven waren dabei sowohl im Bereich des Baudienstes,
als auch bei der
Betriebsführung
zu finden. Weitere Maschinen dieses Typs sollten jedoch nicht mehr in den
Kreis
I kommen. Die dort eingesetzten und verhassten Modelle der Reihe Am 4/4
wurden daher nicht direkt ersetzt. Vielmehr gab es nun in den anderen
Kreisen einige
Bm 4/4 vorrätig, die nun an den
Kreis I abgetreten wurden. Moderne Modelle waren im Westen immer wieder
selten. Danach ging es mit den ausgelieferten
Lokomotiven wild durch die Standorte. Wurde ein Standort
gemäss Planung mit mehreren Modellen ausgerüstet, bekam dieser zuerst nur
eine Maschine. Das war bei Auslieferungen von neuen
Diesellokomotiven
immer wieder gewählt worden. Es führte jedoch dazu, dass die Verteilung
der Nummern sehr unübersichtlich wurde. In der Folge des Einsatzes kam es
daher immer wieder zu Bereinigungen. So erreichte die
Lokomotive der Reihe Am 841 innerhalb der Schweiz sehr
schnell eine grosse Verbreitung. Begünstigt wurde dies durch die Tatsache,
dass es dem Hersteller gelang eine kurze Lieferfrist einzuhalten. Der in
Spanien für die beiden
Drehgestelle
benötigte
Flachwagen
befand sich praktisch nie im Stillstand. So kamen laufend neue Maschinen
in der Schweiz an, die dann umgehend auf die Standorte verteilt wurden.
Die restlichen Modelle kamen daher in die
Kreise
II und III. Welche Nummer letztlich wo war, ist ei-gentlich nebensächlich,
denn wie schon erwähnt, es gab eine wilde Verteilung. Die Verteilung im Kreis II umfasste mehrere Stand-orte. In der Auflistung werden die Standorte in der Reihung der Auslieferung erwähnt. So waren in Solothurn, Basel, Olten Hammer, Bellinzona, Arth-Goldau, Pratteln und Luzern Maschinen der Baureihe Am 841 stationiert worden. Am Schluss gab es darunter auch Orte mit
mehreren Maschinen dieses Typs. Jedoch fällt auf, dass viele klassische
Depotinspektionen
nicht aufgeführt wur-den. Der Grund lag in der Tatsache, dass die
Abgabe der neuen Baureihe an die Baudienste und die
Betriebs-führung
erfolgte. Deren Standorte deckten sich nicht immer mit den
Depotinspektionen.
Deutlich zeigte das der Kanton Uri mit dem
Depot
Erstfeld. Dort blieb es bei der Maschine
Bm 4/4 für den
Hilfswagen.
Der Grund war, dass es keine passenden Baudienste gab und, dass der
Rangierdienst
in Altdorf durch das Depot Erstfeld abgedeckt wurde. Auch in der Region Chiasso waren keine
Modelle der Baureihe Am 841 vorhanden. Das war kein Fehler, denn der
Baudienst für den Gotthard war in Bellinzona zu Hause. Der konnte die
neuen Modelle mit der guten
elektrischen
Bremse und der jetzt auch möglichen
Vielfachsteuerung
sehr gut nutzen. Die steilen
Rampen
waren oft für die Reihe
Bm 4/4 eine Herausforderung.
Besonders, wenn es an einen grossen Umbau der Strecke ging.
Der jedoch die Grösse dieses
Kreises
aufzeigte. Auch hier wur-den die
Lokomotiven den Baudiensten und der
Betriebsführung
übergeben. Daher stellt sich jetzt die Frage, warum es nicht die
Depots
waren? Die Depotinspektionen stellten die Lokomotiven für den Strek-kendienst, daher fand man hier die elektrischen Maschinen und die Triebwagen. Auch der Rangierdienst in den grossen An-lagen wurde von den Depots übernommen. Aus diesem Grund befanden sich die
Baureihen Em 3/3,
Bm 4/4 und
Bm 6/6 dort. Die Ausmietung
dieser Maschinen an die Bau-dienste und an die
Betriebsführung
entfiel nun, da dort eigene Modelle vorhanden waren. Die
Lokomotiven wurden nach ihrer Stationierung den geplan-ten
Arbeiten zugeführt. Diese Einsätze bestanden aus un-spektakulären aber
dennoch nicht minder wichtigen Aufgaben, wie dem
Rangierdienst
in vereinzelten
Bahnhöfen.
Dabei kam das aber nur in den Bahnhöfen vor, wo die Rangierarbeiten von
der
Betriebsführung
durchgeführt wurden. Diese gab es, denn je nach Ort, übertrug man die
Aufgabe einem anderen Bereich. Auch wenn die neuen Maschinen der Baureihe
Am 841 immer wieder in den grossen
Rangierbahnhöfen
zu sehen waren, die Arbeit dort wurde mit Modellen der nahen
Depotinspektion durchgeführt. Eine gewachsene Regelung, die jedoch
nicht immer übersichtlich war. Daher können wir die Liste auch nicht der
Betriebsführung
zuschlagen, denn viele Maschinen der Baureihe Am 841 waren in einem
Bahnhof
für den Baudienst vorgesehen.
Die dort zu sehenden Maschinen der Reihe Am
841 gehörten daher dem Baudienst. Wer es jetzt noch nicht versteht, gehört
einer grossen
Gruppe
an. Es waren jedoch gewachsene Strukturen, die nicht verändert wur-den. Der Baudienst setzte die starke Loko-motive bei Umbauten vor den langen Bauzügen ein. Die Fahrten zum Bahn-hof, wo neu beladene Wagen abgeholt wurden, konnten so reduziert werden. Die Bauarbeiten verliefen daher zügi-ger, was dazu führte, dass die Strecke schneller dem Betrieb übergeben wer-den konnte. Die
Lokomotive war daher meistens auf Strecken zu Hause, wo sie
auch abgestellt wurde und darauf wartete, dass die Arbeiten weitergehen
wür-den. Daran änderte sich kaum etwas, denn die
Lokomotive war klar für diesen Zweck beschafft worden. Aus
der Reihe Am 841 wurde die Arbeitslokomotive, die auch beim Personal
Veränderungen verursachte. So fuhren bisher als Traktorführer eingesetzte
Leute plötzlich mit einer grossen Lokomotive, die selbst die Reihe
Bm 4/4 in den Schatten stellte
und neu musste das Personal auch die
Zugsicherung
und
ZUB 121
kennen lernen. Doch die Einfachheit der
Lokomotive half bei diesen Schulungen. Wobei die meisten
Leute die
Vielfachsteuerung
nur auf dem Papier kannten. Es gab nur wenige Maschinen und daher kam es
nicht zu solchen Einsätzen. Auf die Anwendung der vorhandenen
Funkfernsteuerung
wurde jedoch verzichtet, da man dort noch Bedenken im Bereich der
Sicherheit hatte. Doch es gab auch Ausnahmen und die fand man in
Bellinzona.
Besonders war dann die Steigerung der
Leistung
zu merken, denn die Reihe
Bm 4/4 konnte nicht
viel-fachgesteuert werden und arbeitete alleine, oder man benötigte zwei
Lokführer mit zwei
Lokomo-tiven. Jedoch war die Möglichkeit der Vielfachsteuerung nicht nur dort ein Segen. Auch wenn sich im Vorfeld viele gegen diese sinnlose Einrichtung stellten, wurde sie regelmässig genutzt. Wenn man so will, war lediglich die
Funkfern-steuerung
unnötig, da man dort immer noch nicht alle Bedenken zu solchen Lösungen
beseitigen konnte. Auch wenn andere Länder zeigten, dass es kein Problem
gab, in der Schweiz nutzte man diese Einrichtung noch nicht. Doch dabei sollte es nicht bleiben, die
Reihe Am 841 wurde immer wieder für andere Aufgaben abgezogen und mussten
dann oft zu zweit zeigen, was sie konnte. Besonders wenn schwere
Transporte geführt wurden, die ein Ausschalten der
Fahrleitung
bedingten, konnten nur
Diesellokomotiven
verwendet werden. Früher war das klar eine Arbeit für die Reihen
Bm 4/4 und
Bm 6/6 und damit der
Depots,
die solche Modelle hatten. Nun kam aber immer öfter auch Baureihe Am
841 zum Einsatz. Die Modernisierung hatte sich auch hier durchgesetzt.
Gerade hier war wieder der Gotthard mit seinen Steigungen dafür
verantwortlich. Wobei jetzt weniger die
Vielfachsteuerung
den Vorteil bedeutete. Die starke
elektrische
Bremse erlaubte es nun auch einen Teil der
Anhängelast
abzubremsen. Es musste deutlich weniger mit den
Bremsklotzen
gearbeitet werden.
Doch von den damit verbundenen Problemen
kannte man damals schlicht noch nichts. Lediglich die Modelle der Reihe
Re 460 verursachten am Gotthard
Probleme mit den
Bremsen. Noch sah man deren Problem nicht. Als sich
im Jahre 2000 ein Winter abzeichnete, der auch in tiefen Lagen Schnee
brachte, begannen die Probleme. Das Personal bekundete immer wieder Mühe
mit dem
Bremsweg.
So reichte der Bremsweg nicht und eine
Lokomotive der Reihe Am 841 überfuhr ab und zu ein
Zwergsignal, das halt zeigte. Als dann der erste
Prellbock
mit der Lokomotive überrannt wurde, gab man noch dem Personal die Schuld. Die Fälle mit unachtsamer Fahrweise nahm
jedoch dramatisch zu, so dass man sich die Frage stellte, ob es eventuell
nicht am Personal lag. Die Aussagen, dass die
Lokomotive schlicht nicht gebremst hätte, wurden daher
ernster genommen. Die Untersuchungen hatten dabei ergeben, dass bei kalter
Witterung und bei Schnee die
Bremsleistung
schlicht ungenügend war. Das führte dazu, dass die Lokomotive nicht mehr
über die gewohnten
Bremswege
verfügt. Auf der Strecke bot sich kein grosses
Problem, da die
Lokomotive meistens dafür verwendet wurde, um Wagen zu
ziehen. Wenn man schon einen Zug anhängt, benötigt man ja keinen
zusätzlichen Wagen mehr. Daher waren hier die Lokomotiven auch nicht von
den Vorfällen betroffen, denn die Lokführer merkten die fehlende
mechanische Bremswirkung nicht, weil dann meistens die Wagen stärker
bremsten und der Zug so zum Stehen kam.
Als Sofortmassnahme wurde daher verfügt, dass die Lokomotiven Am 841 nicht mehr alleine fahren durften. Mindestens ein Wagen musste als Brems-wagen immer mitgeführt werden. Diese erste Massnahme verhinderte schnell
erneute Vorfälle und beruhigte die Nerven der verantwort-lichen Stellen. Im Rangierdienst, wo diese Vorschrift auch galt, war der Geisterwagen hingegen hinderlich und nervte die Arbeiter entsprechend. Nur, waren ge-rade dort die Probleme aufgetreten und so nervten sich die Arbeiter vergebens, denn der Wagen diente auch ihrer Sicherheit. So gesehen war die Massnahme
gerechtfertigt. Die Stimmen, die der spanischen
Lokomotive die Schuld gaben, verstummten, als es auch bei
der Baureihe Re 460 zu Problemen
kam. Die Abklärungen benötigten eine gewisse Zeit. Die Bremssteuerung der Lokomotive musste geändert werden. So wurde im
Rangierdienst
wieder vermehrt mit den mechanischen
Bremsen
gearbeitet. Forderte nun das
Lokomotivpersonal
bei geringer Geschwindigkeit mit dem Fahrbremsschalter einer
Bremsung
an, wurde nicht die
Widerstandsbremse
aktiviert, sondern die
Klotzbremse.
Wurde schneller gefahren, änderte sich wenig. In der Folge konnte auch wieder auf den
Wagen verzichtet werden. So begann sich die Baureihe Am 841 wieder zu
einer zuverlässigen
Lokomotive zu entwickeln. Doch nun gab es auch Umstellungen
im Unternehmen, die Auswirkungen hatten. Die neue Ausrichtung der
Schweizerischen Bundesbahnen SBB erfolgte in Schritten. Den Abschluss
bildeten die
Triebfahrzeuge.
Wir können daher den ersten Teil des Einsatzes ebenfalls beenden.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2022 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Dabei
mussten die meisten
Dabei
mussten die meisten
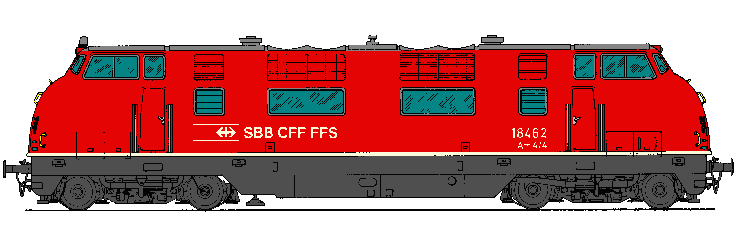 Die
ersten vier abgelieferten
Die
ersten vier abgelieferten
 Erst
mit der letzten
Erst
mit der letzten
 Damit
kommen wir in den
Damit
kommen wir in den
 Ein
Beispiel soll das etwas verdeut-lichen. Der
Ein
Beispiel soll das etwas verdeut-lichen. Der
 Die
Die
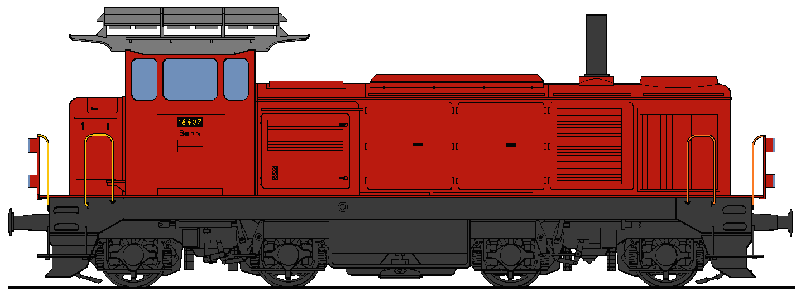 Auch
im
Auch
im
 Die
Ursache vermutete man bei der häufigen An-wendung der
Die
Ursache vermutete man bei der häufigen An-wendung der