|
Schlussworte |
|||
| Navigation durch das Thema |
|
||
|
In den 90er Jahren begann die Zeit der
Neigezüge
in ganz Europa. Bisher hatte sich eigentlich nur Italien mit diesen Zügen
befasst und die Technik anhand ihres Streckennetzes optimiert. Das heisst
aber auch, dass diese Züge kaum für sich stets folgende
Kurven
ausgelegt worden sind. Vielmehr wollte man wegen einzelnen Kurven nicht
mehr abbremsen und so die
Reisezeit
ohne Ausbauten an der Strecke verkürzen.
Zeugen dieser auch in der Schweiz
durchgeführten Versuche waren die
Einheitswagen III,
die mit akti-ver
Neigetechnik
versehen werden sollten. Probleme waren dabei jedoch die verwendeten Lokomotiven
mit den hohen
Achslasten.
Ein Problem, das bei Neigezügen
bleiben sollte. Für den Verkehr durch die Alpen mit den
vielen engen und daher langsamen
Kurven,
waren Neigezüge
die Hoffnung um noch mehr
Fahrzeit
einzusparen und den Verkehr wieder attraktiv zu gestalten. Ein Wunsch, der
sich mit den ETR 470 verwirklichen sollte und erstmals wollte man dazu bei
den Bahnen zusammen arbeiten und die Züge einer gemeinsamen Tochterfirma
übergeben. Geboren war die Cisalpino AG. Bei der Bestellung hatte man die Auswahl
zwischen mehreren Systemen. Fertige Züge gab es damals jedoch nicht zu
kaufen. Bei der Erfahrung war der italienische Hersteller jedoch führend
und er hatte bereits solche Züge gebaut und von der FS ein Auftrag für
neue Züge erhalten. Auf diesem Muster baute dieser sein Angebot auf und
unterbreitete dieses der neu gegründeten Firma, die unter starkem Einfluss
der FS stand. In erster Linie lockte dabei die
vergleichbare Serie ETR 460 der FS. Bei den Ersatzteilen hätte man auch
auf diese Züge zurückgreifen können. Ein Wunsch, der nicht neu war und der
bei anderen Baureihen schon oft erfolgreich angewendet wurde. So gesehen,
glaubte man bei der Cisalpino AG, dass man die richtige Wahl treffen
würde. So kam es zur Bestellung der ETR 470. Dies obwohl auch die ETR 460
nicht fertig erbaut waren.
Diese hatten anfänglich auch grosse Probleme und kamen nicht so richtig in Schwung. Beim ETR 470 versuchte man diese Gefahr mit
einem speziellen als Treno Zero bezeichneten Zug etwas zu bannen und die
meisten Probleme früh zu lösen. In Anbetracht der komplizierten Technik
sicherlich keine schlechte Idee. Wenn wir jedoch zu den anderen Herstellern
blicken, erkennen wir, dass diese durchaus schnell auf die italienischen
Hersteller aufgeholt hatten. So beschaffte man in Deutschland Neigezüge,
die einen vergleichbaren
Stellantrieb
hatten und die auf vereinzelten Strecken in Deutschland die
Fahrzeiten
senken sollten. Diese mit
Dieselmotoren
ausgerüsteten Züge bewährten sich auf den Strecken, da diese dem
italienischen Prinzip entsprachen. Zudem zeigten die neuartigen mechanischen
Stellantriebeb
bei den
Versuchsfahrten
schon früh gute Ergebnisse, so dass es bei der Bestellung andere
Möglichkeiten gegeben hätte. Der Vorteil der mechanischen Stellantriebe
war, dass man auf Bauteile, die bei der Rüstungsindustrie verwendet
wurden, zurückgreifen konnte. Die Ansteuerung für die Kastenneigung
entsprach schliesslich dem Panzer Leopard II. Hingegen war die junge Gesellschaft
Cisalpino AG mit der Verteilung der Aktien zu sehr nach Italien
orientiert. Ohne Zustimmung der FS ging in der Gesellschaft schlicht nicht
mehr viel. Die anderen beteiligten Bahnen hatten kaum eine Chance, andere
Anbieter bei der Bestellung ins Rennen zu bringen. Daher verwunderte es
nicht, dass die Züge aus Italien kommen sollten. Der Cisalpino AG waren
hier vermutlich sogar die Hände gebunden.
In Abstand von drei Minuten fuhren diese
und da gab es keinen Platz für einen schnellen Neigezug.
Dem Hersteller kam das gar nicht ungelegen, da so die Anzahl Fahrten mit
dem
Versuchszug
verringert werden konnte. Ein Fehler, den man bitter bezahlen musste. Ob man die vielen sich oft unmittelbar folgenden Kurven nicht sehen wollte, ist nicht bekannt. Fakt ist jedoch, die Strecke war schon immer für die vielen engen Kurven bekannt gewesen. Deswegen wurden jene am Lötschberg auch
etwas anders angeordnet. Ein Punkt, der ein seriöser Hersteller im Vorfeld
abklärt und sich mit den damit verbundenen Problemen vertraut macht. Schliesslich starteten die Neigezüge
nach einer kurzen Probezeit mit sehr viel Öffentlichkeit. Wer unter einer
solchen Überwachung startet, hat keine grossen Chancen, wenn sich
Kinderkrankheiten bemerkbar machen. Schnell hat man eine schlechte Presse
und muss kräftig an der Werbetrommel drehen um nicht ins Abseits gedrängt
zu werden. Für eine junge Gesellschaft sicherlich nicht sehr einfach.
Die Züge mussten gerade die kurvenreichsten
Strecken am Gotthard und am Lötschberg befahren. Das war für die
Neigetechnik
schlicht zu viel und so überhitzte diese sehr schnell. Der Zug hatten
jedoch ohne diese Technik Probleme mit der
Fahrzeit. Die Zylinder waren insbesondere in der Leventina dauernd an der Arbeit. Ergänzt mit schnellen Wechseln der Seite, kam die Technik arg ins schwitzen. Genau das passierte, das Hydrostatiköl wurde warm, verlor die Viskosität und konnte so den Druck nicht halten. War dann noch eine Dichtung nicht optimal,
spritzte bei 315
bar
das
Öl
aus der Leitung und der Druck fiel in sich zusammen. Jetzt konnte nur noch
eine
Zwangsbremse
viel Unheil verhindern. Dank einem knappen Bestand, war man damit beschäf-tigt, die defekten Züge wieder in Schwung zu bringen. So litt automatisch der reguläre Unterhalt, den man einfach nicht mehr ausführen konnte. Mangelhafte Verfügbarkeit der Ersatzteile
verschärfte das Problem zusätzlich. Man könnte sagen, dass die Teile so
schnell defekt waren, dass die Lieferanten nicht mehr liefern konnten.
Hingegen muss man diese auch bestellen. So kam es, wie es kommen musste. Aus den Kin-derkrankheiten wurden dauerhafte Beschwerden. Das Ansehen der neuen Züge sank damit noch mehr. Immer wieder äusserte man sich über die Neigezüge negativ. Keine leichte Aufgabe für die Arbeiter, die
nach Mög-lichkeit die beste Arbeit lieferten und dann resigniert
feststellen mussten, dass man gleich wieder flicken durfte. Frust machte
sich so schnell breit. Auch beim
Fahrplan
machten es die Bahnen der Cisalpino AG nicht einfach. So wurden die Züge
in Italien oft als niederklassig eingestuft und mussten sogar den
Regionalzügen
folgen.
Verspätungen
waren dadurch an der Tagesordnung. In der Schweiz hatten die Züge
schliesslich kaum Reserven, so dass diese Verspätung nicht aufgeholt
werden konnte. So fehlte letztlich auch der Zug für die Rückfahrt. Ein
Teufelskreis entstand.
Erst die
RABDe
500 der schweizerischen Bundes-bahnen SBB zeigten, dass es sich um
ein Problem mit dem Innenohr handelte und nicht am ETR 470 lag. Jedoch
hatte man sich auf den Zug einge-schossen und dabei sollte es bleiben. Wer an der Seekrankheit leidet, weiss genau, wie schlimm das sein kann. Man sucht in der Not einen festen Fixpunkt, den es hier kaum gab. Doch waren die Reisenden mit den Kotztüten noch das ge-ringere Problem. Auch Lokführer sind nur Menschen und können
so auch Seekrank werden. Er fand keinen Fixpunkt und so musste er den Zug
anhalten, weil es im schlecht war. Es zeigte sich, dass
Neigezüge nicht so leicht eingeführt werden konnten. Gerade die in der Schweiz eingesetzten RABDe 500 zeigten deutlich, dass auch Neigezüge optimal funktionieren können. Zwar gab es auch dort anfänglich grosse
Schwierigkeiten, die aber schnell behoben werden konnten. So
funktionierten die mit einem mechanischen
Stellantrieb
ausgerüsteten Züge schnell sehr zuverlässig. Für den ETR 470 war das
jedoch schlecht, da jetzt mit dem
ICN
verglichen wurde und dagegen schnitt er schlecht ab. Will man diese beiden Züge jedoch direkt
vergleichen, stellt man schnell fest, dass sie eigentlich nicht in die
gleiche Generation der Züge gehören. So wurde der ETR 470 mit einer
älteren Technik bestückt, die erst mit den mechanischen
Antrieben
und deren guten Funktion, als veraltet angesehen werden kann. Auch hier
fehlte der Cisalpino AG vielleicht der Mut zur neuen Technik und damit zu
einem fortschrittlicheren Zug.
Die Folge war, dass dieses ausgeschaltet
werden musste. Warum
ZUB 121
im Modus für Italien nicht durch die Steuerung deaktiviert wurde, ist wohl
das Geheimnis des Her-stellers, der das hätte wissen müssen. Je länger die ETR 470 im Einsatz mit den Problemen, die aus mangelhaftem Unterhalt und zu schwachen Teilen bestanden, zu kämpfen hatten, desto mehr verloren sie an Ansehen. Die Bezeichnungen Pannolino und
Schrottolino zeigen sehr gut auf, wo der allgemeine Bürger die Probleme
des Zuges sah. Besser informierte
Kreise
sahen vielleicht noch die Bemühungen der Firma Cisalpino AG, die wirklich
mit den Ersatzteilen kämpfte. Die Schweiz, die sich eine nahezu perfekt
funktionierende Eisenbahn leistete, konnte sich nie mit dem italienischen
Zug anfreunden. So stellten die Fahrgäste schnell fest, dass im Wagen
bestimmte Kanten nicht stimmten, die Tische etwas durchhingen und dass man
schnell wusste, was für ein Geschäft auf dem WC verrichtet wurde. Zudem
hatte die allgemeine Luft den typischen italienischen Charme, den auch
nicht alle begrüssten. So konnte sich bei den Leuten die grosse
Liebe nie so richtig entfalten. Entweder hasste man den Zug oder man
verteufelte ihn, wenn man ihn nur schon sah. So gab es gespaltene
Lager
bei den Fahrgästen. Jedoch war die Verteilung klar zu Gunsten der
negativen Äusserungen. Will man einem Zug diese Deutung abnehmen, muss man
ihn perfekter als perfekt betreiben. Das war bei der komplizierten und
nicht besonders geeigneten Technik nicht leicht.
Kommt es dann bei einer ungewünschten Stelle zu einem Brand, kann man, ob man will oder nicht, dem Zug kein gutes Zeugnis ausstellen. Nur, Brände bei Zügen gab es immer wieder
und diese en-deten teilweise für die Züge folgenschwer. So kann man dem Zug durchaus auch etwas Positives zugestehen, denn die Brände, die oft viel Rauch erzeugten, aber nicht an der Struktur Schaden anrichteten, waren glimpflich. Passieren solche Vorfälle innert kurzer
Zeit, werden schnell Forderungen gestellt, die natürlich nicht umgesetzt
werden konnten. Wer stellt einen nahezu neuen Zug ab, der einfach mal mit
einer
Bremse
Probleme hatte? Niemand, denn dann würden keine Züge mehr fahren. Die relativ kurze Betriebszeit der Züge
verhinderte, dass sie in eine umfassende Erneuerung kamen. Dort hätte man
Mängel beseitigen können und womöglich ein gut funktionierendes Fahrzeug
schaffen können. Nur kam es nicht dazu, weil die Schweizerischen
Bundesbahnen SBB unter dem Kapitel einen Strich ziehen wollten. Weg mit
den Zügen, die nur Sorgen machen und andere Lösung anbieten. Nur so leicht
war das nicht. Was die FS mit ihren Zügen machte,
interessierte in der Schweiz niemand. Man liess verlauten, dass man sie in
Italien einsetzen würde. Dort funktionierten die ETR 470 seit Beginn
einwandfrei. Wenn dann eine etwas höhere
Spannung
und erst noch
Wechselstrom
kam, begann die Technik schwächen zu zeigen. Es war klar zu erkennen, dass
man zwei
Stromsysteme
nicht so leicht verbinden konnte, denn das wurde hier noch versucht.
Mich störten dabei die wenigen auf dem Dach
vor-handenen Aufbauten und die
Front,
die nicht so recht zur Farbgebung passen wollte. Das sahen andere
natürlich anders und man könnte hier lange diskutieren. Meine Reisen mit dem Zug waren nicht selten und sie funktionierten immer und von Pannen oder ernsthaften Störungen bekam ich im Zug nichts mit. Dabei verkehrte der Zug in den meisten Fällen sogar pünktlich und kam auch rechtzeitig am Ziel an. An die durchhängenden Tische gewöhnte man
sich mit der Zeit und die Fugen, die nicht genau passten, tolerierte man.
Als Reisender gelte ich jedoch durchaus als zufriedener Fahrgast. Es gab bei mir aber auch die andere Seite, die als Berufsmann und die sieht dann immer wieder anders aus. Wer mit einem Güterzug im Bahnhof warten muss, weil sich weit hinten der verspätete Neigezug nähert, ist nicht voller Lob darüber. Schliesslich hing nicht selten der
Feierabend
davon ab. Anders gesehen, konnte man aber auch zufahren, weil der Zug eben
zu spät war und nicht vorgelassen werden muss. Ab und zu bemerkte man die Störung des
Zuges und dann stand alles still. Schliesslich passierte es gerade im
einspurigen Abschnitt. Diese Wartezeit nervte immer wieder und wurde auch
entsprechend kommentiert. Nur, man ist auch nur Mensch und der ist, wie
der Neigezug
vom Typ ETR 470 nicht ganz vollkommen. Aber im Gegensatz zu den
unvollkommenen Menschen endete die Zeit der Neigezüge vom Typ ETR 470
jedoch recht schnell.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
||
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2023 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
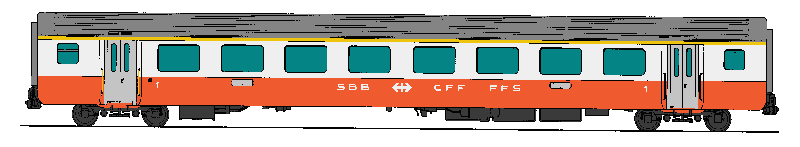 Auch
andere, passiv arbeitende Systeme wurden vor Jahren überall geprüft und
konnten sich mit Ausnahme der Talgo in Spanien nie so richtig durchsetzen.
Auch
andere, passiv arbeitende Systeme wurden vor Jahren überall geprüft und
konnten sich mit Ausnahme der Talgo in Spanien nie so richtig durchsetzen.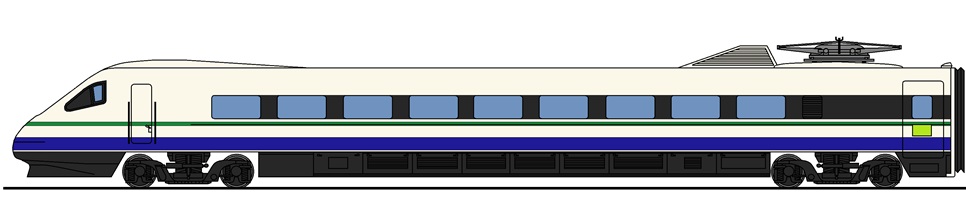 Bei
einem solchen Start, kann man nur Probleme erwarten. Vergleiche könnte man
mit den
Bei
einem solchen Start, kann man nur Probleme erwarten. Vergleiche könnte man
mit den
 Dass
mit dem
Dass
mit dem
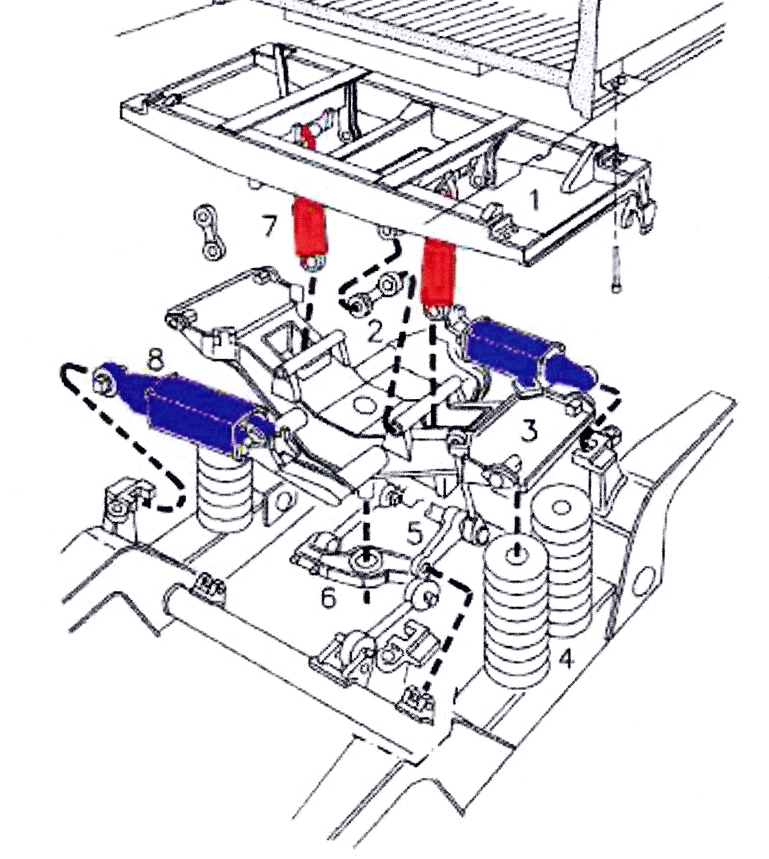 Mit
zunehmender Betriebszeit bemerkte man schnell, dass die für Italien und
das dortige Streckennetz ge-bauten Züge nicht unbedingt in die
kurvenreiche Schweiz passten.
Mit
zunehmender Betriebszeit bemerkte man schnell, dass die für Italien und
das dortige Streckennetz ge-bauten Züge nicht unbedingt in die
kurvenreiche Schweiz passten. Letztlich
kämpften auch die Fahrgäste mit dem Zug. Immer wieder berichteten Leute,
dass es ihnen im
Letztlich
kämpften auch die Fahrgäste mit dem Zug. Immer wieder berichteten Leute,
dass es ihnen im  Als
ob das alles nicht genug war. Die in den beiden Ländern entwickelten und
einge-führten
Als
ob das alles nicht genug war. Die in den beiden Ländern entwickelten und
einge-führten
 Die
vielen Mängel, die der
Die
vielen Mängel, die der  Persönlich
gesehen kann ich dem Zug jedoch kein schlechtes Zeugnis ausstellen. Zwar
konnte ich mich nie so richtig mit dem Aussehen anfreunden. Wobei hier
sicherlich auch andere Meinungen zulässig sind.
Persönlich
gesehen kann ich dem Zug jedoch kein schlechtes Zeugnis ausstellen. Zwar
konnte ich mich nie so richtig mit dem Aussehen anfreunden. Wobei hier
sicherlich auch andere Meinungen zulässig sind.