|
Umbauten und Änderungen |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Mit den Umbauten und Änderungen kommen wir zu dem Punkt, der aufzeigt, wie
gut ein
Triebfahrzeug
gebaut worden war. Da bei den
Triebzügen
RABDe 12/12 nicht so viele Neuerungen umgesetzt wurden, wie bei anderen
Baureihen, durfte man ein gutes Fahrzeug erwarten. Schnelle grosse
Aktionen mit einem Umbau blieben daher aus, was deutlich zeigt, dass den
Herstellern ein ausgesprochen gutes Fahrzeug gelungen war.
Ein Lokführer griff nicht zu einer anderen Stufe, wenn das Tem-po kurz mal
5 km/h unter dem erlaubten Wert lag. Kleine Änder-ungen bei den Neigungen
wurden jetzt ausgeglichen. Damit haben wir bereits eine erste mögliche Schwachstelle gefunden. Hinzu kam, dass es Baugruppen gab, die für einen Umbau vorgesehen waren. Damit stellt sich natürlich sofort die Frage, ob umgebaut wurde.
Bei den
Triebzügen
RABDe 12/12 sehen wir uns diese Änder-ungen daher in der Reihenfolge der
Vorstellung an. Daher begin-nen wir auch hier mit dem Aufbau des Kastens
und das ist schnell erledigt, der wurde nicht verändert.
Etwas anders sah das bei der
automatischen Kupplung
aus. Verkehrte der
Triebzug
im Winter durch Schneefall, wurde die weisse Pracht durch den Fahrtwind
gegen die
Kupplung
gepresst. In den offenen Anschlüssen und in den mechanischen Aufnahmen
entstand so eine Schneeschicht. Wollte man nun zwei
Triebzüge
kuppeln, wurde der Schnee durch die Kräfte zu Eis. Durch den Platzbedarf
konnte es passieren, dass sich die Kupplungen nicht verbanden.
Um das Problem ohne eine grundsätzliche Abdeckung, wie sie bei den
Triebzügen
RAe TEE II verwendet wurde,
zu lösen, musste anders vorgegangen werden. Die hier vorgestellten Modelle
wurden so oft gekuppelt, dass auch eine leichte Abdeckung nicht ideal war.
Es blieb daher nur noch die Lösung mit einer
Heizung.
Diese erwärmte die
Kupplung
so, dass der Schnee schmolz und anschliessend als Wasser abfliessen
konnte.
Die Schweizerischen Bundesbahnen SBB rüsteten die neuen
Triebzüge
RABDe 8/16 ebenfalls mit
automatischen Kupplungen
aus. Die älteren Ausführungen sollten mit der neuen
Kupplung
zumindest mechanisch kompatibel sein und so mussten sie angepasst werden. Bei den Laufwerken gab es Probleme mit den Antrieben. Also Probleme ist etwas übertrieben. Die Baureihe neigte in diesem Punkt zu einem grösseren Aufwand beim Unterhalt. Das war natürlich finanziell keine gute Angelegen-heit.
Die Probleme dabei waren eigentlich nicht neu, da auch andere Baureihen
mit diesem
Antrieb
versehen worden waren. Dort war jedoch die Belastung nicht so hoch, wie
hier mit den vielen Beschleunigungen mit hoher
Zugkraft. Es gab Schwingungen, die dazu führen konnten, dass der Mitnehmer schlicht zerstört wurde. Im Unterhalt war dieser nicht so leicht zu ersetzen, da man den Radsatz ausbauen musste.
Dabei stellte sich heraus, dass diese Schwingungen von den im
Antrieb
ver-bauten
Schraubenfedern
kamen. Die kurze Schwingungsdauer dieser
Federn hatte dramatische Auswirkungen auf die
Baugruppen und
Dämpfer
konnten nicht verbaut werden.
Aus diesem Grund wurden die
Federn durch
Gummifedern
ersetzt. Diese ab 1973 erfolgte Anpassung hatte bei der
Re 4/4 II zu grossen Erfolgen
geführt. Hier erhoffte man sich die gleichen Effekte. Wie hoch die
Belastung war, zeigte sich hier, auch die ersten Gummifedern wurden sehr
schnell verschliessen. Daher baute man eine andere Ausführung ein. So
konnten letztlich die Probleme so gemildert werden, dass der normale
Einsatz möglich war.
Bei Auslieferung fand sich die Nummer des Fahr-zeuges nur seitlich am
Mittelwagen. Das wurde ge-ändert und die Betriebsnummer neu an der
Front
mit grossen weissen Ziffern angeschrieben. So konnte das Personal die
abgestellten Züge leichter finden.
Mit dem Wechsel zum Bereich mit der
Druckluft
und den
Bremsen
kommen wir zu einem Punkt, der durchaus grössere Sorgen bereitet hatte.
Dabei kann hier eigentlich kein Punkt hervorgehoben werden. Jedoch waren
die Probleme auch nicht so gross, dass man einen kompletten Umbau der
ganzen Anlage hätte in Betracht ziehen müssen. Wir beginnen mit dem
Kompressor,
der gut funktionierte, aber er nervte auch die Kunden.
Grundsätzlich war das keine grosse Sache. Hier wurde der
Kompressor
jedoch unter dem Abteil der ersten
Wagenklasse
eingebaut. Kam noch hinzu, dass dieser wegen dem grossen Verbrauch bei der
Druckluft
sehr oft lief. Die Reisenden dort schätzten das nicht gerade und viele
davon hatten grossen Einfluss. Daher wurde versucht das Problem mit
anderen Gummielementen und weiteren Massnahmen nachhaltig zu verbessern.
Fazit dieser vielen Arbeit war, dass Geld verbraucht wurde, um das Problem
letztlich nicht zu lösen. Die
Triebzüge
hatten deshalb ihren Übernamen «Mirage» zu recht bekommen. Sie waren
schnell und laut. Alles was bei einem Kampfflugzeug auch vorhanden war.
Die angepasste
Ventilation
während der Auslieferung bracht in diesem Punkt schlicht keine
Veränderung. Der Name blieb und war einfacher als dieses blöde RABDe
12/12.
Auch hier war das eine direkte Folge des grossen Bedarfs bei der Druckluft, denn war der Luftstrom zu schnell, blieb zu wenig Zeit, um das Wasser ausscheiden zu können.
Das erfolgte dann später und damit dort, wo man tunlichst Wasser vermeiden
sollte. Eingefrorene
Bremsen
sind nicht lustig. Um das Problem zu Beheben wurden ab 1974 neue Luft-trockner verbaut. Diese konnten deutlich mehr Feuchtig-keit aus der Luft ziehen. So viel, dass auch die Luftöler anders arbeiten mussten.
So konnte das Problem mit der
Druckluft
gelöst werden. Jedoch stellt sich auch heraus, dass die meisten
Anpass-ungen ab 1974 erfolgten und daher nur wenige Jahre nach der
Auslieferung. Es gab also Probleme, wenn auch nur kleinere.
So richtig böse waren aber die Störungen bei den
Bremsen.
Verzögerte der
Triebzug
und die
elektrische
Bremse reichte nicht aus, wurde durch die
EP-Bremse
Druckluft
in die
Bremszylinder
geführt. Dadurch wurden die
Bremsklötze
gegen das
Rad
gepresst. Bei schlechtem Zustand der
Schienen
erfolgte das jedoch in einem so hohen Tempo, dass die Räder zu stark
gebremst wurden. Das war für den
Gleitschutz
schlicht zu viel.
Die Flachstellen mussten im Unterhalt mit grossem Verschleiss behoben
werden. Damit eine Verbesserung erzielt werden konnte, griff man zu einem
Trick. So wurde die Füllzeit der
Bremszylinder
um wenige Sekunden verlängert. Das reichte, dass nun der
Gleitschutz
die Zeit hatte, um entsprechend zu reagieren. Das Problem mit den
verschliffenen
Radreifen
konnte so gemildert werden. Der Betrieb bot aber genug Chancen und den
Triebzug
zu verschleifen.
Der Ort war die Rückwand der beiden
Führerstände.
Diese waren beim Bau des
Triebzuges
nach den Lösungen der
Triebwagen
RBe 4/4 aufgebaut worden und
daher reichte die Verglasung nicht ganz bis an die Decke. Das nutzten nun findige Reisende dazu, den Lokführer mit allerlei Gegenständen zu bewerfen. Das mochte für die Leute lustig sein, für den Lokführer war es nervig.
Für den fahrenden Zug waren aber solche Aktionen ge-meingefährlich, denn
fiel der Lokführer wegen einem Wurfkörper aus, konnten die Verursacher nur
noch hof-fen, der der Zug vor dem Unglück zum Stillstand kam. Die
geschlossene Wand brachte die Lösung für das Problem. Kommen wir nun zur der Frage, die Sie vermutlich seit Beginn dieses Abschnittes beschäftigt. Reichte die Kühlung des Transformators aus, oder mussten die beim Bau gemachten Vorbereitungen genutzt werden?
Es ist schnell erklärt, der
Transformator
machte zwar immer wieder Sorgen, aber die
Kühlung
war dafür nicht verantwortlich. Sowohl die
Ölpumpe,
als auch der
Kühler
wurden daher bei diesen
Triebzügen nie eigenbaut. Wie schon erwähnt, die Hüpfersteuerung arbeitete sehr viel. Das führte dazu, dass die Kontakte einem grossen Verschleiss unterworfen waren.
Der Wechsel band den Zug jedoch an ein
Depot.
Daher wurden die Kontaktplatten im Lauf der Jahre durch neue Modelle
ersetzt. Diese sollten dank Zusätzen wie Brom, länger im Betrieb bleiben,
als die alten Ausführungen. Trotzdem die
Hüpfer
mussten immer wieder kontrolliert werden.
So waren die an den
Fronten
montierten
Heizsteckdosen
vermutlich nie genutzt worden. Zumindest ab 1970 konnte man das auch nicht
mehr, denn ab dann wurden diese Dosen ausgebaut. Der
Triebzug
konnte daher nur noch ab
Fahrleitung
mit eingeschalteten
Hauptschaltern
erwärmt werden. Wirklich nur eine Einpassung, die wegen einer nicht ganz
durchdachten Idee im
Pflichtenheft
vorgenommen werden musste.
Verändert wurde ab 1982 die
Beleuchtung
der Abteile. Diese war beim Bau des Zuges mit
Glühbirnen
ausgeführt worden und wirkte veraltet. Daher wurden neue Lampen montiert,
die mit Leuchtstoffröhren arbeiteten. Der Innenraum wurde so etwas kühler
ausgeleuchtet, hatte jedoch auch einen deutlich geringeren Bedarf an
Energie. Die
Batterien
hielten etwas länger durch, wenn der Lokführer am suchen der Störung war.
Die komplizierte Lösung für die
Geschwindigkeitssteuerung
und mangelhafte Leitungen führten anfänglich immer wieder zu grossen
Problemen. Der Techniker vom Hersteller war nahezu rund um die Uhr am
beheben von Störungen. Die Folge davon war, dass kaum mehr ein Stang
gleich aufgebaut war. Sie sehen, es gab durchaus Baustellen, die nicht so
schnell gelöst werden konnten. Gerade bei der Steuerung waren die
Auswirkungen gross.
In der Folge ist die Leittechnik für die Steuerung veraltet, wenn der Zug gerade einmal richtig in Betrieb genommen wurde.
Daher mussten immer wieder neue Baugruppen ein-gebaut und die Steuerung so
verbessert werden. Dabei werden wir nur zwei Punkte genauer an-sehen. Schon vorher haben wir bei den Problemen mit den Bremsen erfahren, dass der verbaute Gleitschutz nicht optimal am arbeiten war. Um seine Reak-tionszeit sehr kurz zu halten, musste eine neue Lösung her.
Dank der elektronischen Regelung des neuen Schleuder- und
Gleitschutzes
konnte die Wirkung verbessert werden, weil die Reaktionszeit geringer
wurde. Damit bestätigen sich hier aber auch die Hinweise von vorher.
Ein eher tragisches Ereignis brachte einen weiteren Umbau. Nach einem
schweren Zugunglück in Rheinweiler wurde schnell eine gestörte Messung der
Geschwindigkeit angenommen. Auch die RABDe 12/12 hatten damit immer wieder
Probleme. Da diese aber auch der
Geschwindigkeitssteuerung
diente, konnte bei einem gestörten Geber der
Triebzug
einfach unkontrolliert losfahren. War der Lokführer dann nicht am
Arbeitsplatz, kam es zum Unfall.
Mit den vielen kleinen Anpassungen wirkt der
Triebzug
mit Problemen behaftet. Viele der erwähnten Punkte betrafen jedoch den
Unterhalt. Grosse Störungen blieben oft aus. Trotzdem mussten die
Schweizerischen Bundesbahnen SBB sich Gedanken über die Zukunft machen.
Ein Flickwerk bei der Technik und ein veraltetes Innenleben führten dazu,
dass die Triebzüge RABDe 12/12 zur Modernisierung aufgeboten wurden. Das
ist aber ein eigenes Kapitel.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2023 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
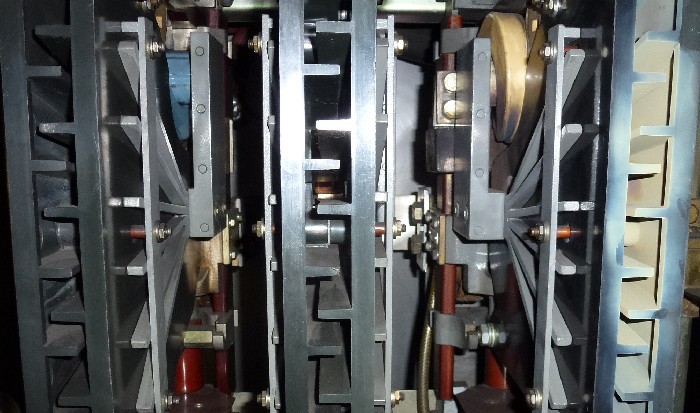 Jedoch
hatte der Wechsel der Steuerung von der Regelung mit Befehlen auf eine
solche mit Geschwindigkeiten grosse Auswirk-ungen. Die
Jedoch
hatte der Wechsel der Steuerung von der Regelung mit Befehlen auf eine
solche mit Geschwindigkeiten grosse Auswirk-ungen. Die  Ab
1973 wurden die
Ab
1973 wurden die
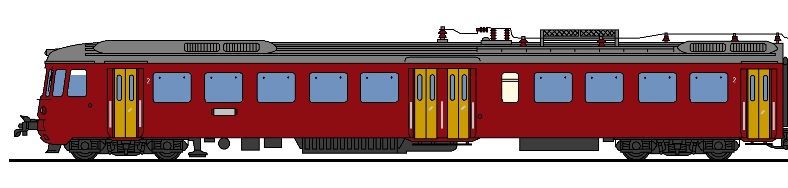 Nicht
angepasst wurde der Anstrich der
Nicht
angepasst wurde der Anstrich der
 Ein
weiteres Problem war der
Ein
weiteres Problem war der
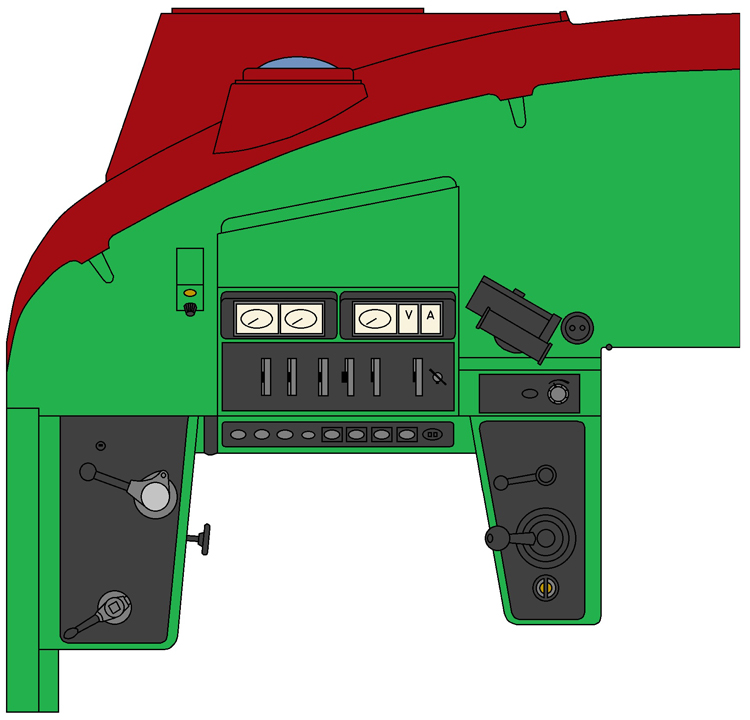 Im
Innenraum wurde auch eine Anpassung vorgenommen. Dabei ist klar, dass die
Sitze, wenn sie verschliessen wa-ren, ersetzt werden mussten. Die
Anpassung hier war eher unscheinbar, aber dabei nicht unwichtig.
Im
Innenraum wurde auch eine Anpassung vorgenommen. Dabei ist klar, dass die
Sitze, wenn sie verschliessen wa-ren, ersetzt werden mussten. Die
Anpassung hier war eher unscheinbar, aber dabei nicht unwichtig. Die
im ursprünglichen
Die
im ursprünglichen 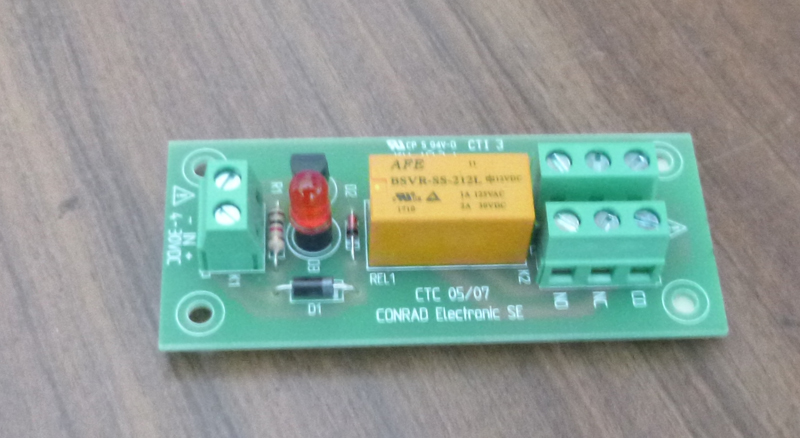 Es
zeigte sich, dass der vermehrte Einsatz von elektronischen Bauteilen nicht
nur Vorteile brachte. Die Techniken in diesem Bereich sind einem gros-sen
Wandel unterworfen.
Es
zeigte sich, dass der vermehrte Einsatz von elektronischen Bauteilen nicht
nur Vorteile brachte. Die Techniken in diesem Bereich sind einem gros-sen
Wandel unterworfen.