|
Bedienung des Triebzuges |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Die Bedienung eines
Triebzuges
unterschied sich damals von jener einer
Lokomotive,
oder einem
Triebwagen.
So wurden die mehrteiligen Fahrzeuge mit mehr Personal besetzt. Hier kam
jedoch noch hinzu, dass mehrere solche Züge verbunden werden konnten. Beim
Lokführer und der Vorstellung der Steuerung haben wir ja bereits erfahren,
dass dazu die
Vielfachsteuerung
eingebaut worden war. Noch nicht gelöst haben wir das Problem
Zugführer.
Auch im Hinblick auf die neue
S-Bahn,
sollte diese Besatzung jedoch vermindert werden. Mit anderen Worten, es
gab neben dem Lokführer noch einen
Zugführer
für vier Fahrzeuge. Auf die bisherige systematische Kontrolle der
Fahrkarten
wurde bei diesen
Triebzügen verzichtet.
Auf so komplizierte Betriebsformen wollen wir uns noch nicht einlassen.
Wir packen die Bedienung in kleinen Schritten an und daher wird vom
Personal zuerst nur ein Exemplar in Betrieb genommen. Wobei sich bei
mehreren
Triebzügen nur der Aufwand erhöhte, da man die
vorgestellten Handlungen bei jedem Modell machen musste. Das konnte
durchaus auch einen längeren Fussmarsch durch die Fahrzeuge bedeuten.
Wir beginnen mit der Übernahme des
Triebzuges
am Morgen. Dabei wurden bereits beide Angestellten benötigt. Der Lokführer
übernahm in der Regel den Zug als erste Person. Dabei führte er eine
Aussenkontrolle durch, die auch bei den anderen Reihen vorgeschrieben war.
Es sollte damit nur sicher gestellt sein, dass vor der Fahrt alle Punkte
korrekt waren. Mit Schäden sollte keine Werkstatt verlassen werden, denn
dort sollten diese behoben werden.
In das Fahrzeug gelangte man über eine der Aussentüren. Da der
Triebzug
noch nicht in Betrieb war, konnten diese ohne grosse Probleme geöffnet
werden. Dazu musste die Falle gedrückt und dann der Flügel nach aussen
gezogen werden. Einzig das unterste Trittbrett war etwas hoch, da dieses
ja für
Bahnsteige
und nicht für ein
Gleisfeld
ausgelegt war. Je nach Beschaffenheit des Boden eine Kletterpartie,
besonders für kleine Leute.
Die ersten Funktionen waren Aktiv und so gingen ein paar Lampen an. Eine
bescheidene Ausleucht-ung, die den Einsatz der
Handlampen
nicht ver-hinderte. Für den Lokführer wichtiger, war das gut hörbare
zischen.
Fehlte dieses wurde es im Fahrzeug mehr oder weniger Laut. Es hing davon
ab, wie sich der Lokführer beherrschen konnte. Es war nun Handarbeit
angesagt. Dabei fand sich die
Handluftpumpe
schnell. Nur mussten viele Schritte befolgt werden. Wir ersparen uns hier
die Details. Es mussten Kontrollen vorgenommen werden, danach die beiden
Hauptschalter
von Hand rein und zum Schluss Pumpen, bis der Bügel oben ist. Das konnte
dauern.
Das Modell RT12 besass das Zählerwerk für die Kilometer, eine mechanische
Uhr und der Farbstreifen mit der Auf-zeichnung der Fahrdaten. Das zweite
Modell R12 besass jedoch die Farbscheibe mit der Restwegaufzeichnung. Hier
waren zudem Kontakte vorhanden. Diese wurden für die von der
Geschwindigkeit abhängigen Funktion
benötigt. Das waren die Umschaltung der
Ventilation,
aber auch die Ausschaltung der
elektrischen
Bremse bei 40 km/h.
Die Anzeige dieser
V-Messer
war zwar vorhanden, jedoch blickte auf der Fahrt niemand mehr drauf. Bevor
wir diese beginnen können, müssen wir einen der beiden
Führerstände
aufsuchen. Welcher das war, hing von der
Zugsicherung,
deren Prüfung und der späteren Fahrrichtung ab. Das
Lokomotivpersonal
wusste schnell, ob es Glück hatte und sich alles am gleichen Ort befand.
Wenn nicht, es waren nur 75 Meter zum anderen Ende.
Beim betreten des
Führerstandes
fiel dem Personal schnell auf, dass viele Merkmale von der
Lokomotive
Re 4/4 II übernommen worden
waren. Dazu gehörte der mit Schichtholzplatten belegte Boden, die
hellgrünen Wände aus Stahl und die weisse Decke aus
Holz.
Neue Wege bei der Gestaltung des Führerstandes wurden nicht begangen, was
sich auch auf die verbaute Sitzgelegenheit auswirkte. Der einfache Stuhl
konnte kaum dem Körper angepasst werden.
Um den
Triebzug
in Betrieb nehmen zu können, musste sich der Lokführer auf eben diesen
Stuhl setzen. Damit stellte er automatisch seine Füsse auf dem in einer
Nische eingebauten
Pedal
ab. Dessen Bedienung war bekannt und sie entsprach anderen Modellen.
Jedoch befand sich unterhalb des leicht schräg montierten Pedals eine
Schaltleiste. Wurde diese mit der Zehenspitze nach unten gedrückt, öffnete
sich der
Rückspiegel.
Im Gegensatz zu den anderen Baureihen betrachten wird hier das
Führerpult
und sehen uns dabei die Funktionen an. Der Grund dafür ist simpel, denn
bis auf die Bedienung der
Fahrschalters
waren alle Punkte auf die gleiche Weise aufgebaut worden, wie das bei der
Lokomotive
Re 4/4 II, oder
dem
Triebwagen
RBe 4/4 der Fall gewesen war.
Somit ist die Reihenfolge soweit bekannt, denn wirklich wichtig war die
Sache mit dem Tempo.
Näher gegen den Lokführer gerichtet befand sich das
Ventil
FD 1, das für die
Rangierbremse
genutzt wurde. Etwas weiter weg wurde ein FV3b als
Führ-erbremsventil
eingebaut. Dieses füllte jedoch nur im besetzten
Führerstand
die
Hauptleitung. Mit dem Führerbremsventil kommen wir zur obliga-torischen Bremsprobe. Dazu wurde der Zugführer benötigt. Dieser kontrollierte die Klotzbremse des Triebzuges.
Das ging einfach, da ja mit der
Rangierbremse,
wie mit der allenfalls noch angezogenen
Handbremse
nur das vorderste
Drehgestell
gebremst wurde. Doch dazu war es sinnvoll, wenn der
Triebzug
ein-geschaltet war und damit kommen wir in den Bereich vor dem Lokführer. Der Bereich vor dem Lokführer teilte sich in drei Bereiche auf. In der unteren Reihe über den Beinen waren einige Meldelampen und Leuchttaster vor-handen.
Neben der Taste zur Umgehung der
Zugsicherung
bei
Rangierfahrten,
befanden sich hier auch die
Meldelampen
und Tasten für die Türsteuerung. Aber auch die Lampe mit dem Signal für
den erteilten Abfahrbefehl war in dieser Leiste montiert worden. Dabei
sind die Türen spannend.
Mit der gelben Taste wurde die
Einstiegstüren
frei gegeben. In dem Moment, wo diese gedrückt war, leuchtete sie gelb und
die Türen konnten geöffnet werden. Dabei war weder eine weitere
Sicherung,
noch eine Vorwahl der Seite vorhanden. Mit anderen Wort, ein Reisender
konnte auf beiden Seiten eine Türe öffnen, auch wenn der Zug noch fuhr.
Daher sollte sie erst unmittelbar vor dem Stillstand des Fahrzeuges
gedrückt werden.
Das durfte er jedoch erst machen, wenn er vom
Zugführer
den damals erforderlichen Abfahrbefehl bekommen hatte. Bei vier Zügen war
das jedoch weder optisch noch akustisch möglich. Da-her war seitlich an
den Zügen ein Schalter vorhanden. Drehte der Zugführer mit seinem Schlüssel den Schalter, leuchtete in der Meldeleiste eine grüne Lampe auf. Das war die Meldung für den Abfahrbefehl. Der Lokführer musste nun nach einer kurzen Wartezeit die Türen mit einem Druck auf die rote Taste schliessen.
Mit der Unterstützung von
Druckluft
knallten sie zu. Die heute üb-lichen Vorkehrungen, wie
Einklemmschutz,
oder
Lichtschranken,
gab es damals noch nicht.
Die gelbe Taste wurde gelöscht und gelöst. Die rote Lampe löschte, wenn
die letzte
Einstiegstüre
geschlossen war. Waren alle Türen geschlossen und die rote Lampe gelöscht,
durfte mit dem Zug losgefahren werden. Die Einstiegstüren wurden durch die
nun anstehende
Druckluft
im geschlossenen Zustand gehalten. Ein kräftiger Reisender konnte sie mit
viel Kraft aufdrücken. Jedoch führte das dazu, dass im
Führerstand
das rote Licht an ging, wie man so schön sagt.
Oberhalb dieser Meldeleiste, war der von den vorherigen Baureihen her
bekannte
Verriegelungskasten vorhanden. Hier fand der Lokführer die
Steuerschalter um die Steuerung zu aktivieren, den
Stromabnehmer zu heben
und um den
Hauptschalter einzuschalten. Weiter waren auch die Schalter für
die
Beleuchtungen und den
Kompressor vorhanden. Bedient wurden sie wie bei
den anderen Baureihen. Dabei halfen die Symbole.
Eine in der Meldeleiste montierte Lampe zeigte den Zustand
an. Leuchtete diese nicht, hatte einer der
Hüpfer geöffnet. Dabei wurde
aber auch der
Triebzug ausgeschaltet, so dass sie nur ein Hinweis war. Blieben noch die vor dem Fenster montierten Manometer und Instrumente. Diese wurden bei diesem Fahrzeug noch mit der Anzeige für die Geschwindigkeit ergänzt.
Neben der üblichen Anzeige der aktuell gefahrenen
Geschwindigkeit, war noch ein Bogen mit der vom Lokführer gewählten
Geschwindigkeit vorhanden. Da wir diese Steuerung später noch genauer
ansehen, wenden wir uns den anderen Anzeigen zu, denn die waren im
üblichen Rahmen.
Um das
Führerpult abzuschliessen, müssen wir den rechten Korpus
betrachten. Auf diesem waren der
Quittierschalter für die
Zugsicherung und
der Schalter für die
Wendeschalter vorhanden. Diese wurden auf die gleiche
Weise bedient, wie das bei anderen Baureihen der Fall war. So oder so fiel
der Blick in diesem Bereich auf den
Fahrschalter, denn dieser war etwas
anders aufgebaut worden, wie das bei der Reihe
Re 4/4 II der Fall war.
Bevor wir aber die Handhabung des
Fahrschalters ansehen, noch ein paar
Hinweise. Die
Triebzüge besassen bekanntlich eine
Geschwindigkeitssteuerung, daher wurden die dort erlaubten Werte wichtig.
Diese wurden dem Lokführer mit den Signalen und dem
Dienstfahrplan
mitgeteilt. Damit dieser leicht eingesehen werden konnte, war in der Ecke
zwischen dem rechten Korpus und den Anzeigen ein
Fahrplanhalter mit
Beleuchtung montiert worden.
Für die
Umschaltung in den Bremsbetrieb musste dieser Griff jedoch nicht angefasst
werden, denn diese aktivierte sich mit den
Fahrschalter, der sich darunter
befand. Alle von der Baureihe Re 4/4 II her bekannten Funktionen des Fahrschalters können wir in diesem Fall schlicht vergessen. Ein wichtiger Unterschied war, dass der Hebel nicht nach hinten bewegt werden konnte.
Das war eine
Folge der hier verbauten
Geschwindigkeitssteuerung. Diese Regelung
bewirkte, dass ein ganz anderer Fahrstil angewendet werden musste. Der
Fahrschalter half dabei dem Personal mit seinem Aufbau. Der nach vorne verschobene Fahrschalter bewirkte, dass sich die entsprechende Anzeige beim V-Messer verschob. Je weiter nach vorne der Griff gedrückt wurde, desto höher stieg die Marke in der Anzeige.
Jedoch
konnte mit dem
Fahrschalter kein Wert eingestellt werden, der die
Höchstgeschwindigkeit von 125 km/h überstieg. Der im
Schleuderschutz
vorhandene
Überdrehzahlschutz wirkte auch nur, wenn der Zug ausgeschaltet
rollte.
Der Triebzug löste die bisher aktive Stillhaltebremse und baute
Zugkraft
auf. Wie hoch diese war, hing davon ab, bei welcher Stelle sich die Marke
befand. Wie hoch aber die maximale Zugkraft war, konnte der Lokführer
nicht bestimmen, denn das wurde jetzt durch die Steuerung übernommen.
Reduziert wurde diese kurz bevor die eingestellte Geschwindigkeit erreicht
wurde. Danach wurde mit dieser unabhängig der Neigung gefahren.
Lag diese tiefer, musste dies jedoch in Bremswegentfern-ung vor dem
betreffenden Punkt erfolgen. Anders gesagt, beim
Vorsignal wurde die neue
Geschwindigkeit einge-stellt und der
Triebzug verzögerte auf diese, bis die
be-treffende
Geschwindigkeitsschwelle erreicht wurde. So gut die Geschwindigkeitssteuerung auch war, es gab ein Problem. Es konnte damit keine genaue Fahrt auf ein-en bestimmten Haltepunkt erfolgen. Der Lokführer hätte in dem Fall den genauen Bremsweg kennen müssen.
Auch
wenn das mit sehr viel Erfahrung vielleicht der Fall sein könnte, der
Triebzug musste auch von einem frisch geschulten Lokführer bedient werden.
Daher wurde eine spezielle Regel für diesen Fall vorgesehen. Zuerst wurde mit dem Fahrschalter die verlangte Ge-schwindigkeit auf 40 km/h eingestellt. Die Steuerung verzögerte nun mit der vorgegebenen Verzögerung auf diesen Wert.
In dem Moment, wo dieses Tempo erreicht wurde
und der
Strom an den
Fahrmotoren einen Wert von 500
Ampère unterschritt,
konnte die nächste Handlung vorgenommen werden. Dazu musste der Lokführer
im
Fahrschalter einen im Griff montierten Schalter drücken. Damit wurde der Leerlauf aktiviert. Da hatte zur Folge, dass die Steuerung die bisher vorhandene Regelung der Zugkraft aufgab.
Der
Triebzug rollte
ohne
Antrieb weiter und etwa 80 Meter vor dem Haltepunkt, wurde der Knopf
losgelassen. Der
Fahrschalter wurde auf 0 gezogen und der Triebzug
verzögerte bis zum Stillstand. In dem Moment, wo der Zug stand, aktivierte
sich automatisch die Stillhaltebremse. Der Zug konnte nicht mehr
losrollen.
Da nun nicht angehalten werden sollte,
musste der Freilauf auch auf andere Weise aufgehoben we-rden. Dazu wurde
die Marke für die V-Soll einfach im 10 km/h verstellt. Die
Geschwindigkeitssteuer-ung wurde nun wieder aktiviert. Im Fahrschalter war auch der von der Baureihe Re 4/4 II her bekannte Knopf für die Lokpfeife vor-handen. Sie wurde im üblichen Stil bedient. Da der Knopf zwei Kontakte besass, konnte die Pfeife mit zwei Tonlagen angesteuert werden.
Das bekannte Klangbild der Schweiz wurde jedoch durch
den Lokführer erzeugt. Es war daher nur die Regelung der
Zugkraft
verändert worden. Der
Triebzug war daher sehr angenehm zu bedienen. Jedoch bot der Schalter zu den anderen Baureihen noch eine weitere Neuerung. Wurde der Griff über die Stellung 0 nach hinten gezogen, aktivierte sich auf dem Triebzug die Schnellbremse.
Alternativ dazu konnte
aber auch das
Führerbremsventil dazu benutzt werden. Mit der
automatischen Bremse wurde auch gearbeitet, wenn die
elektrische
Bremse nicht genutzt
werden durfte. Es musste einfach der Leerlauf aktiviert sein.
Um die Bedienung abzuschliessen, wenden wir uns noch einmal dem linken
Korpus zu. Dort war ein
Ventil vorhanden. Wurde dieser Griff vom Lokführer
verdreht, nahmen die
Scheibenwischer die Arbeit auf. Das taten sie mit der
vorgegebenen Motivation. Also die
Druckluft bewegte die Wischer, wie deren
Kraft ausreichte. Eine Verstellschraube ermöglichte die Einstellung
zwischen kaum Bewegung und einem
Ventilator für die Scheibe.
Wir haben somit die Bedienung der Baureihe RABDe 12/12 in den Grundzügen
kennen gelernt. Es bleibt zu erwähnen, dass das auf dem
Triebzug geschulte
Personal deutlich genauer über die einzelnen Funktionen bescheid wusste.
Damit verdienten diese aber ihr Geld und das wollen wir ihnen auch gönnen.
Wichtig zu wissen ist, die
Geschwindigkeitssteuerung des Triebzuges war in
diesem Bereich eine grosse Neuerung.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2023 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
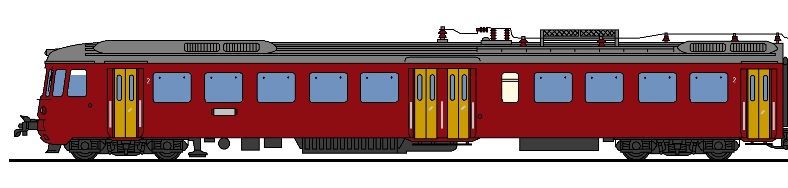 Verkehrten
vier
Verkehrten
vier
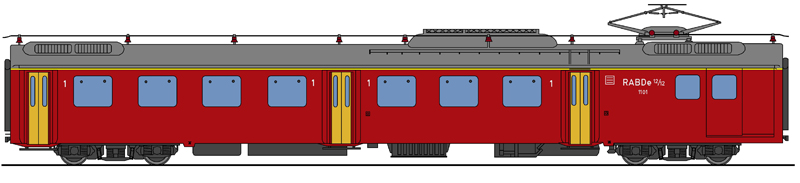 Im
Zug musste jedoch zuerst der Mittelwagen auf-gesucht werden. Dort befand
sich der Apparate-schrank mit den Hähnen zu den
Im
Zug musste jedoch zuerst der Mittelwagen auf-gesucht werden. Dort befand
sich der Apparate-schrank mit den Hähnen zu den

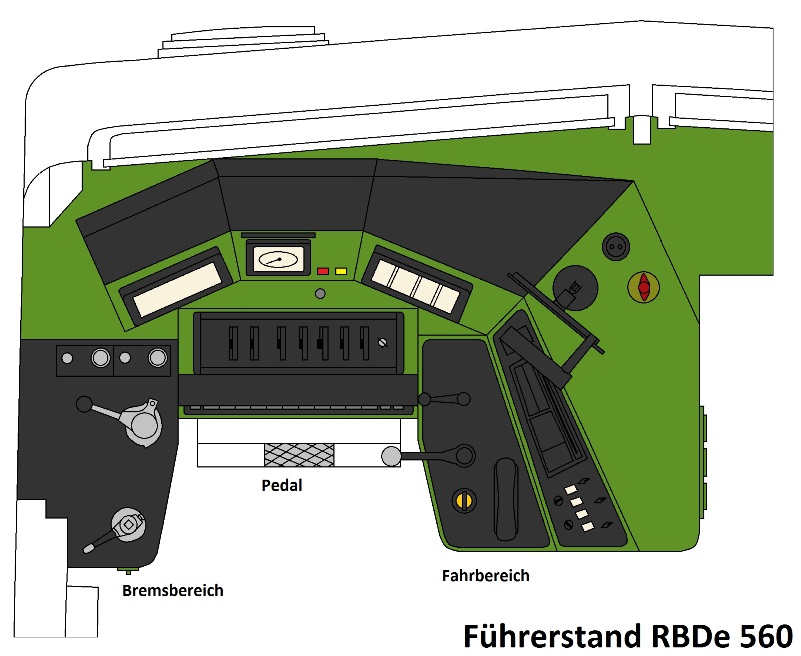 Linkerhand
befanden sich an der Wand des
Linkerhand
befanden sich an der Wand des
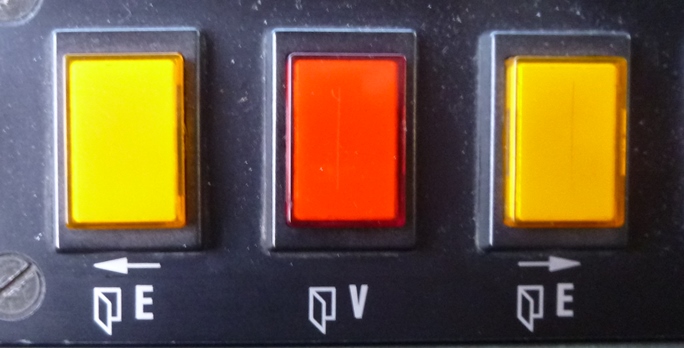 In
dem Moment, wo eine Türe geöffnet wurde, begann die zweite rote Lampe zu
leuchten. Da die
In
dem Moment, wo eine Türe geöffnet wurde, begann die zweite rote Lampe zu
leuchten. Da die
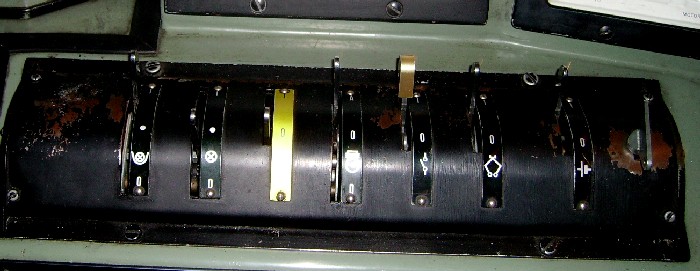 Im Gegensatz zu den anderen mit diesem
Im Gegensatz zu den anderen mit diesem
 Um mit dem Zug losfahren zu können, musste auch bei diesem
Um mit dem Zug losfahren zu können, musste auch bei diesem
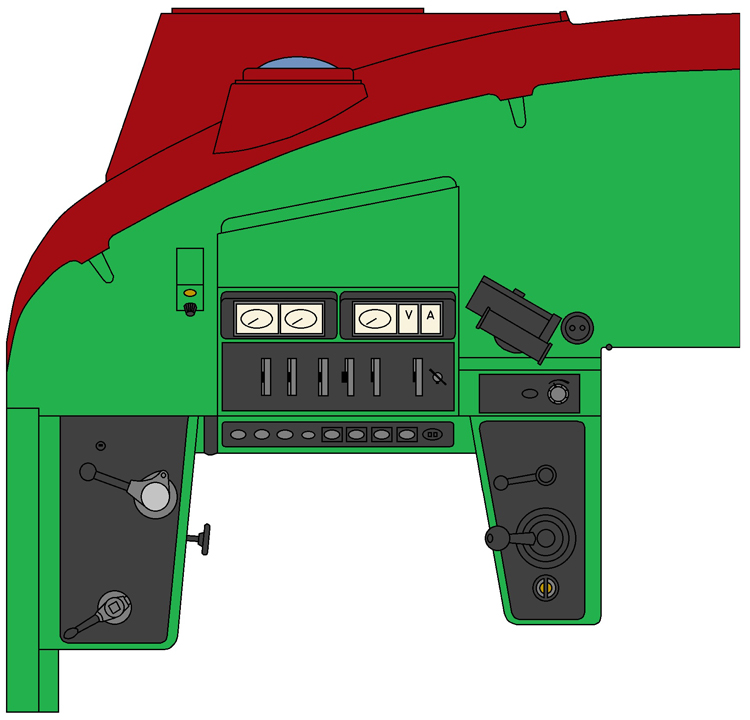 Um das Tempo während der Fahrt an einen neuen Wert anzupassen, musste
einfach mit dem
Um das Tempo während der Fahrt an einen neuen Wert anzupassen, musste
einfach mit dem
 Es gab jedoch auch während der Fahrt Situationen, bei denen der Freilauf
aktiviert werden musste. Das war bei
Es gab jedoch auch während der Fahrt Situationen, bei denen der Freilauf
aktiviert werden musste. Das war bei