|
Entwicklung und Beschaffung |
|||||||||||
| Navigation durch das Thema | |||||||||||
|
Die neuen
Pendelzüge
ersetzten nicht nur das ausgediente
Rollmaterial,
sondern bildeten eine wichtige Voraussetzung für das ins Leben gerufene
Betriebssystem
Bahn+Bus 2000.
Deshalb war man bemüht, schnell eine Lösung zu finden. Daher unterliessen
es die Schweizerischen Bundesbahnen SBB sich um eine komplette
Neuentwicklung zu bemühen. So sollte es möglich sein, dass die komplette
Serie im Jahr 2000 bereitstehen würde.
Das sind Kosten, die man sich im Direktorium der Schweizerischen
Bundes-bahnen SBB ersparen woll-te. Seinerzeit war es bei den
Dampflokomotiven üblich, dass man ein Muster nahm und dieses einfach
angepasst wurde. Diese Idee war nicht so schlecht und erlaubte günstig
produzierte
Lokomotiven.
Als Beispiel dient hier die Baureihe
C 5/6. Diese wurde nicht komplett neu
entwickelt, sondern man nutzte die vorhandenen Maschinen der Baureihe
C 4/5. Diese wurde lediglich um eine
Achse
erweitert und so die
C 5/6 geschaffen. Angepasst
werden konnte so der
Kessel,
denn dank dem längeren Rahmen, war ein längerer Kessel möglich. Solche
Beispiele gäbe es in der Geschichte der Schweizer Bahnen sehr viele. Auch in der neueren Geschichte gab es ein solches Beispiel. So war die Ableitung der RBe 4/4 der Schweizerischen Bundesbahnen SBB von den Ce 4/4 der BLS-Gruppe gut zu erkennen. Der Triebwagen für die Staatsbahn wurde einfach an die geänderten Bedürfnisse angepasst, dadurch kam es im Bereich der Fronten zu leichten optischen Veränderungen. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass auch umgekehrt von der Staatsbahn abgekupfert wurde.
Für den neu zu entwickelnden
Triebwagen
rückte erneut die BLS-Gruppe
in den Vordergrund. Dort verkehrte, wie auf anderen
Privatbahnen
der Schweiz, ein moderner Triebwagen. Dieser als
RBDe 4/4 bezeichnete Triebwagen war vom Konzept her so
aufgebaut worden, wie man sich das bei den Schweizerischen Bundesbahnen
SBB vorgestellt hatte. Daher nahm man den Triebwagen mit samt dem
Steuerwagen.
Trotzdem wurde der
Triebwagen,
als auch der
Steuerwagen,
der BLS-Gruppe
den Bedürfnissen angepasst und so verändert. Das
Pflichtenheft
enthielt daher mehr oder weniger nur die Abweichungen vom Muster.
Obwohl die Fahrzeuge der
Privatbahnen
in vielen Punkten den Vorstellungen der Schweizerischen Bundesbahnen SBB
entsprachen, gab es doch einige Punkte, die nicht akzeptiert werden
konnten. Diese «Mängel» sollten deshalb nicht unerwähnt bleiben. Denn
letztlich war nur diese «Mängelliste» für das leicht geänderte
Erscheinungsbild verantwortlich. Sehen wir uns daher einige Punkte der
Liste etwas genauer an.
Ein Mangel war die
Höchstgeschwindigkeit
von 125 km/h. Sie war für die Schweizerischen Bundesbahnen SBB schlicht
unakzeptabel. Gerade hier überraschte diese Haltung, waren doch fast alle
Triebfahrzeuge
der
Staatsbahnen
für Geschwindigkeiten bis 125 km/h ausgelegt worden. Nur die Baureihe
Re
4/4 II war schneller unterwegs. Doch, um diesen Umstand zu
begreifen, muss man das Netz der SBB kennen.
Viele Strecken der Schweizerischen Bundesbahnen SBB liessen
Geschwindigkeiten von bis zu 140 km/h zu. Zumindest lagen damals viele
Abschnitte über 130 km/h. Ein
Regionalzug
mit 125 km/h hätte auf diesen zudem recht langen Abschnitten zu einer
Behinderung geführt. Die ideale Geschwindigkeit für den neuen Regionalzug
lag deshalb bei 140 km/h. So gab es gegenüber den vorhandenen Fahrzeugen
eine leichte Steigerung.
So entstand der optische Unter-schied zu den Fahrzeugen der
Privatbahnen.
Die weiteren Merkmale des Kastens wurden jedoch nur geringfügig verändert,
so dass eine nahe Verwandtschaft entstand.
Im technischen Bereich waren geänderte
Antriebe
nötig, da der
Fahrmotor
nicht schneller drehen durfte. Die damit verbundenen Anpassungen ergaben
eine leichte Reduktion bei der
Zugkraft.
Im Gegensatz zu den
Privatbahnen
waren die
Triebwagen
der Schweizerischen Bundesbahnen SBB eher für flache Abschnitte ausgelegt
worden. In der Folge blieb die
Leistung
bei höherer Geschwindigkeit gleich. Eine etwas geringere
Normallast
wurde in Kauf genommen.
Beim elektrischen Bereich gab es ebenfalls eine Änderung. Die
Triebwagen
der
Privatbahnen
besassen
Widerstandsbremsen.
Die Erfahrungen der Schweizerischen Bundesbahnen SBB hatten jedoch
gezeigt, dass
Nutzstrombremsen
auch auf
Nebenlinien
problemlos eingesetzt werden konnten. Zudem konnte so Energie eingespart
werden, was die Betriebskosten senkte. Daher musste der Triebwagen für die
Staatsbahn
eine
Rekuperationsbremse
erhalten.
Die grössten Veränderungen gab es jedoch im Bereich der Steuerung.
So hatten die
Triebwagen
der
Privatbahnen
eine
Charakteristiksteuerung.
Diese war für die Verantwortlichen der Schweizerischen Bundesbahnen SBB zu
ungenau und sie erachteten sie als zu kompliziert. Zudem sollte der
Einheitsführerstand
der Baureihen RBe 4/4,
RAe TEE II,
Re 4/4 II
und Re 6/6 verwendet werden. So
konnten Kosten für die Ausbildung eingespart werden.
Diese Variante bestand bereits bei den
Triebwagen
der Baureihe RABDe 12/12 und funktionierte dort überraschend gut. Deshalb
wollten die Verant-wortlichen der Schweizerischen Bundesbahnen SBB eine
mit dem einheitlichen
Führerstand
bediente
Geschwindigkeitssteuerung. Diese musste jedoch nur bei Zugkraft funktio-nieren. Damit wurde eine Befürchtung der Industrie berücksichtigt denn bei der elektrischen Nutz-strombremse war es damals noch nicht möglich die Geschwindigkeitssteuerung sauber aufzubauen.
Das hätte zu Störungen führen können. Daher be-schloss man, dass
die
elektrische
Bremse im gewohnten Rahmen funktionierte. Probleme bei der
Bedienung sollten sich damit nicht ergeben. Übernommen wurde jedoch die Vielfachsteuerung. Bei den Triebwagen der Privatbahnen verwendete man das Kabel III der Staatsbahn. Die bisher immer wieder aufgeführte Forderung nach einer Kom-bination der unterschiedlichen Baureihen gab es beim Triebwagen nicht mehr zu beachten.
Jedoch sollte eine Möglichkeit bestehen, den neuen
Triebwagen
mit alten
Steuerwagen,
die für das System
Vst IIId
ausgelegt wurden, einzusetzen.
Da der
Steuerwagen
ebenfalls auf
IIId umgeschaltet und so für die
Fernsteuerung
der
Re 4/4 II
genutzt werden sollten, mussten Anpassungen an der
Vielfachsteuerung
vorgenommen werden. Eine Kombination mit dem Muster der
Privatbahnen
war daher nicht mehr möglich. Jedoch konnten deren Zwischenwagen bei der
Staatsbahn
eingereiht werden. Speziell dabei war nur, dass die Schweizerischen
Bundesbahnen SBB auf neue Zwischenwagen verzichtete.
Das passende Fahrzeug für die
Staatsbahnen
sollte daher einen
Steuerwagen
Bt erhalten. Die Türen sollten ebenfalls anders aufgebaut und verschoben
werden.
Die Ideen wurden schliesslich der einschlägigen Industrie
überreicht. Deren Aufgaben waren sicherlich nicht so schwer, wie bei
anderen Baureihen, jedoch mussten wegen den Änderungen viele Berechnungen
neu gemacht werden. Trotzdem wurden unterschiedliche Lösungen angeboten.
Es lag schliesslich an den Schweizerischen Bundesbahnen SBB diese zu
prüfen und letztlich die für sie beste Lösung auszuwählen und die Aufträge
zu vergeben.
Die Züge sollten aus einem
Triebwagen
RBDe 4/4 sowie einem
Steuerwagen
Bt bestehen. Es sollte somit ein komplett neuer Zug entstehen, der als
neuer
Pendelzug
bezeichnet wurde. Abgekürzt ergab das dann NPZ. Eine Bezeichnung, die dem
Zug mit unterschiedlichsten Deutungen nachlaufen sollte. Jedoch vergaben
die Schweizerischen Bundesbahnen SBB erstmals einem neuen Fahrzeug eine
spezielle Abkürzung.
Im Herbst 1981 bestellten die Schweizerischen Bundesbahnen SBB
deshalb vorerst vier
Prototypen
bestehend aus Trieb- und
Steuerwagen.
Die aufgekommene Idee doch noch Zwischenwagen zu beschaffen, wurde jedoch
wieder verworfen, wer sparen muss, kümmert sich weniger um ein
Erscheinungsbild. Die für die
Pendelzüge
verwendete Abkürzung NPZ, sollte daher zu «Nichts passt zusammen»
abgeändert werden.
Jedoch muss auch gesagt werden, dass die FFA schon Er-fahrungen
bei den
Triebwagen
für die
Privatbahnen
sammeln konnte. Das Nachsehen hatten vorerst jedoch die bekannten
Wagenbauer der Schweiz.
Bei der elektrischen Ausrüstung hatte man keine Wahl. Die MFO und
die SAAS waren beim Bau von
Triebfahrzeugen
verschwunden und geblieben war nur noch die Brown Boveri und Co BBC in
Baden. Daher wurde dieser Hersteller berücksichtigt. Er sollte die gesamte
elektrische Ausrüstung liefern und bei den
Triebwagen
auch für die Endmontage verantwortlich sein. Ein Prinzip, das schon früher
angewendet wurde und daher nicht neu war.
Die Nummern der neuen
Triebwagen
waren auf 2100 bis 2103 festgelegt worden. Die grösste Überraschung war
dabei die Startnummer 00. Erstmals bestellten die Schweizerischen
Bundesbahnen SBB Fahrzeuge und nummerierten sie beginnend bei null.
Verstanden hat das niemand so richtig, denn jeder normale Mensch beginnt
bei 1 zu zählen. Computer sind bekanntlich keine Menschen und daher begann
dort die Zählung oft bei null.
Anfangs des Jahres 1985 wurde eine erste Serie von vorerst 30
neuen Einheiten, bestehend aus je einem Trieb- und
Steuerwagen,
beschlossen. Sie unterschieden sich leicht von den vier
Prototypen.
Der mechanische Teil wurde nun von den Firmen Schindler Wagon Altenrhein
SWA und der Schweizerischen Industrie Gesellschaft SIG in Neuhausen
geliefert. Dabei war die SWA die Nachfolgerin der FFA, die bei den
Prototyen berücksichtigt wurden.
Beim elektrischen Teil blieb die BBC. Da diese jedoch im Lauf der
Ablieferung die Asea übernahm, gab es beim Hersteller der elektrischen
Ausrüstung während der Lieferung eine Änderung beim Namen. So wurden die
letzten Züge von der Asea Brown Boveri ABB ausgeliefert. Letztlich
lediglich einen geänderten Namen, wie das bei der FFA die von Schindler
übernommen wurde und daher nun als SWA geführt wurde, der Fall war.
Damit hatte man jedoch eine erste Serie, die jedoch nicht ältere
Fahrzeuge ersetzte, sondern einfach den zusätzlichen Bedarf befriedigte.
Eine Lösung für das Problem der Schweizerischen Bundesbahnen SBB war daher
noch nicht erreicht.
Die Schweizerischen Bundesbahnen SBB mussten weitaus mehr Züge
beschaffen, wollte sie den Verkehr modernisieren. Es überrascht daher
nicht, dass zwei Jahre später neue Exemplare bestellt wurden. So wurden in
zwei weiteren Serien zusätzlich 50 Einheiten beschafft. Die Nummern für
die 84
Triebwagen
waren mit 2100 bis 2183 belegt worden. Unterschiede bei diesen Serien gab
es jedoch nicht. Die Fahrzeuge hatten sich bewährt und ersetzten nun
langsam die ältesten Züge.
1989 schloss sich die
Bahngesellschaft
Le Pont – Le Brassus PBr mit zwei Fahrzeugen an die SBB-Bestellung an. Die
Fahrzeuge erhielten die Nummern 2184 und 2185 und entsprachen den
SBB-Fahrzeugen. Sie gehörten aber der
Privatbahn,
obwohl sie sogar das Farbschema der SBB erhielten. Sie erhielten, wie Sie
sicher bemerkt haben auch SBB Nummern. Lediglich die Bahnanschriften
wurden der Privatbahn angepasst, so dass sie leicht zu erkennen waren.
Das mittlerweile sehr erfolgreiche Konzept mit den NPZ stiess auch
im nahen Ausland auf grosses Interesse. So kam es, dass die Hersteller SIG
und ABB im Jahr 1991 einen
Pendelzug
nach dem Baumuster der Schweizerischen Bundesbahnen SBB an die
österreichische Montafonerbahn liefern konnten. Dieser Zug wurde
vollständig in der Schweiz gefertigt anschliessend nach Österreich
geliefert. Er erhielt bei der MBS die Bezeichnung ET 10.107.
1991 beschlossen die Schweizerischen Bundesbahnen SBB die
Beschaffung von einer vierten und letzten Serie RBDe 4/4. Diese vierte
Serie bestand aus 42 Einheiten. Sie erhielten im Gegensatz zu den bisher
abgelieferten Fahrzeugen die neue Bezeichnung RBDe 560. Die Nummern wurden
neu angelegt, so dass diese Fahrzeuge mit 560 100 bis 560 141 bezeichnet
wurden. Geändert hatten sich auch die Lieferanten, denn diese gaben sich
laufend neue Namen.
Jedoch blieb es nicht bei diesen Fahrzeugen, denn die MThB
bestellte vier baugleiche Fahrzeuge für den Einsatz nach dem Deutschen
Engen. Abgeschlossen wurde dann der Bestelleingang für diese Fahrzeuge
1994 mit vier Zügen für die SOB. Somit wurden insgesamt 139 Fahrzeuge
dieser Baureihe abgeliefert. Sie gingen an insgesamt vier verschiedene
Schweizer
Bahngesellschaften
und eine weitere Gesellschaft im Ausland. |
|||||||||||
| Jahr |
Bahngesellschaft |
Bezeichnung |
Nummern |
||||||||
|
1981 |
SBB CFF FFS |
RBDe 4/4 |
2100 – 2103 |
||||||||
|
1985 |
SBB CFF FFS |
RBDe 4/4 |
2104 – 2133 |
||||||||
|
1987 |
SBB CFF FFS |
RBDe 4/4 |
2134 – 2183 |
||||||||
|
1989 |
PBr |
RBDe 4/4 |
2184 – 2185 |
||||||||
|
1991 |
MBS |
ET 10 |
107 |
||||||||
|
1991 |
SBB CFF FFS |
RBDe 560 |
560 100 – 560 141 |
||||||||
|
1991 |
MThB |
RBDe 4/4 |
171 - 174 |
||||||||
|
1994 |
SOB |
RBDe 4/4 |
77 - 88 |
||||||||
|
Mit der letzten Serie und damit der Steigerung auf 126 Einheiten
sollte die Auslieferung eingestellt werden. Damit war es nun auch möglich,
die alten
Triebwagen
BDe 4/4 und die
Lokomotive
Re 4/4 I
aus dem
Regionalverkehr
abzuziehen. Die Erneuerung des
Rollmaterials
für die
Regionalzüge
endete damit mit der bis anhin zweitgrössten Serie in der Schweiz.
Lediglich bei der Baureihe
Re 4/4 II
war die Anzahl viel grösser. Damit wird es langsam Zeit, dass wir uns diesen Triebwagen und den dazu passenden Steuerwagen zuwenden. Die zahlreichen an andere Bahnen gelieferten Triebwagen unterschieden sich nur gering von den Modellen der Schweizerischen Bundesbahnen SBB. Die grösste Abweichung wurde später sogar bei den Staatsbahnen durch Umbauten ebenfalls erreicht. Daher werden die Modelle der Privatbahnen in diesem Artikel nicht weiter erwähnt werden.
|
|||||||||||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |||||||||
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | ||||||||
|
Copyright 2019 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||||||||||
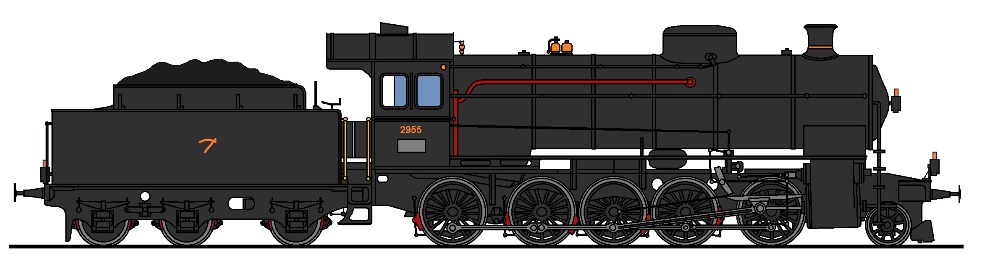 Viel
Geld und Zeit ver-schlingt immer die Ent-wicklung eines neuen Fahr-zeuges.
Ideen müssen über-prüft und letztlich muss sehr viel gerechnet wer-den.
Viel
Geld und Zeit ver-schlingt immer die Ent-wicklung eines neuen Fahr-zeuges.
Ideen müssen über-prüft und letztlich muss sehr viel gerechnet wer-den.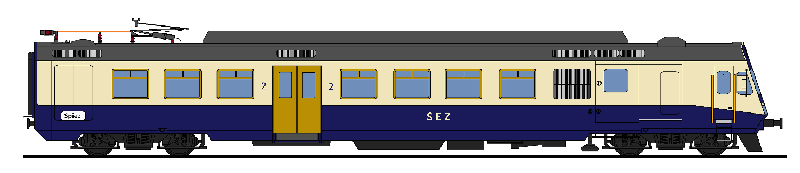 Das
Merkmal dieser Züge, dass sie nur mit einem
Das
Merkmal dieser Züge, dass sie nur mit einem  Daraus
mussten am Modell der
Daraus
mussten am Modell der
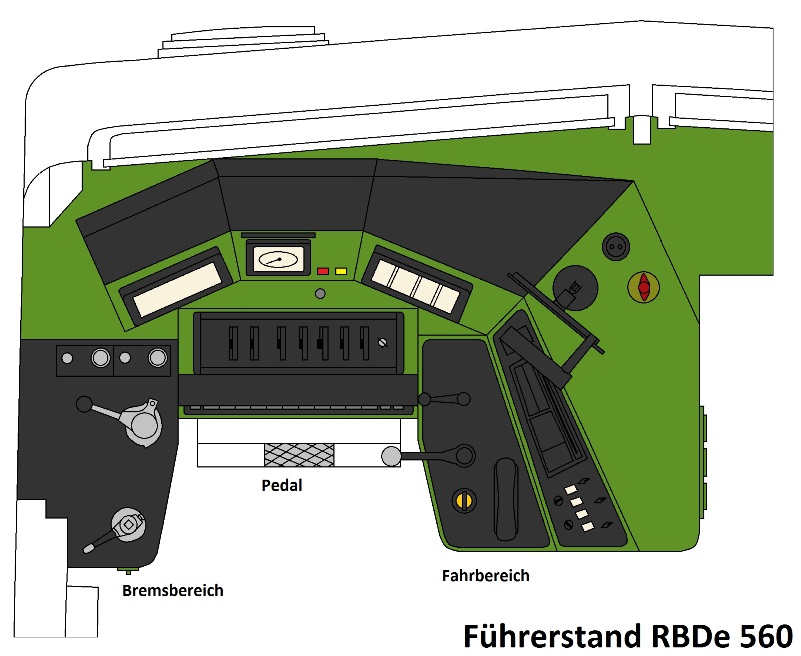 Die
eigentliche
Die
eigentliche
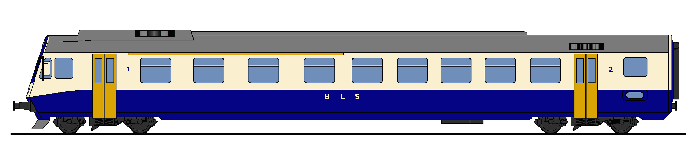 Die
bei den
Die
bei den
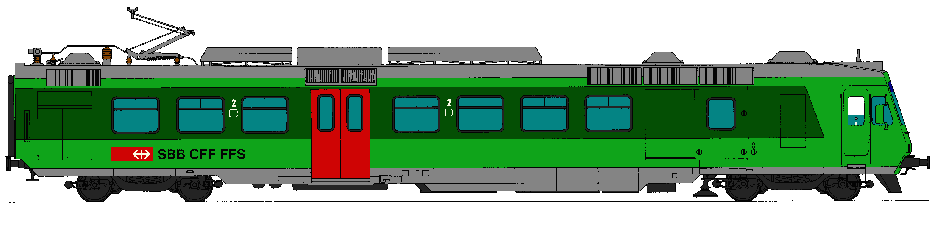 Den
mechanischen Teil, sowie die
Den
mechanischen Teil, sowie die