|
Laufwerk mit Antrieb |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Was beim Aufbau des Kastens galt, kann auch beim
Laufwerk
angewendet werden. Auch jetzt bestand die
Lokomotive
aus zwei identischen Teilen. Wir können uns daher wieder auf die halbe
Maschine beschränken. Das wurde zum Beispiel auch bei der
Achsfolge
berücksichtigt und diese offenbarte, dass das
Fahrwerk
komplizierter aufgebaut wurde, als man anhand der optischen Erscheinung
annehmen könnte. Der Hersteller hatte wirklich Angst vor den
Kurven.
Somit lagerte bei jedem Teil nur eine
Achse
fest im Rahmen. Die äussere
Triebachse
bildete jedoch mit der vorlaufenden
Lauf-achse
ein
Drehgestell. Grund genug sich dieses
Fahrwerk
etwas genauer anzusehen. Ich beginne mit der im Rahmen gelagerten Triebachse und damit mit der einzigen fest gelagerten Achse. Diese Achse wurde aus Stahl aufgebaut und geschmiedet. Aufnahmen gab es für die Lager und die beiden Räder.
Dabei wurden die
Lager,
wie es bereits bei den Dampflokomo-tiven üblich war, als innenliegende
Ausführung aufgebaut. Eine Bauweise, die bei einem
Stangenantrieb
jedoch nicht anders ge-wählt werden konnte. Auf der Achse wurden zwei identische Räder aufgezogen. Dabei kamen zur Verminderung des Gewichtes die damals üblichen Speichenräder zur Anwendung.
Als Verschleissteil wurde eine
Bandage
vorgesehen, die auch die
Lauffläche
und den
Spurkranz
umfasste. Das so aufgebaute
Triebrad
hatte einen Durchmesser von 1 270 mm erhalten. Ein eher ungewöhnlicher
Wert, der aber durch den
Antrieb
so gewählt werden musste.
Die
Achslager
waren als
Gleitlager
ausgeführt worden. Um die Reibung zu vermindern wurden
Lagerschalen
aus
Weissmetall
verwendet. Dieses Material verfügte über eine sehr gute Eigenschmierung.
Jedoch war es sehr anfällig auf grosse Hitze. Durch die sich schnell
drehende Welle wurde die Reibung deshalb zu gross. Um den Wert zu mindern
und um das
Lager
zu kühlen, musste es geschmiert werden. Dazu wurde das übliche
Öl
verwendet.
Daher war hier ein
Lager
Stahl auf Stahl vorhanden. Um die Reibung zu ver-mindern, wurde dieses
Gleitlager
ebenfalls geschmiert. Hier verwendete man als
Schmiermittel
jedoch ein
Fett. Um Schläge und Stösse nicht auf den Rahmen zu übertragen, musste die Triebachse gefedert werden. Dazu wurde unter dem Lager eine Blattfeder eingebaut, die über eine lange Schwingungsdauer verfügte.
Diese tief liegende
Federung
waren bei solchen Rahmen nicht anders möglich und sie benötigten keine
Dämpfer.
Bei der Wartung, die auch bei einer
Blattfeder
erfolgen musste, war die
Feder jedoch sehr gut zugänglich. Damit können wir zur zweiten Triebachse eines Teils der Lokomotive wechseln. Diese war jedoch nicht im Rahmen eingebaut worden, sondern sie war ein Teil eines Drehgestells.
Deshalb lagerte sie mit den üblichen
Gleitlagern
und der bei
Achsen
üblichen
Sumpfschmierung
im
Drehgestellrahmen.
Beim Aufbau dieser zweiten
Trieb-achse
gab es jedoch keinen Unterschied zur vorher vorgestellten Ausführung im
Hauptrahmen. Es wurde ein bei langen Laufwerken oft benutztes Krauss-Helmholtz-Drehgestell verwendet. Daher überrascht diese Bauweise bei dieser Maschine.
Bei dieser
Bauart
eines kombinierten
Drehgestells wurde die
Triebachse
sehr nahe beim Drehpunkt eingebaut. Dieser wurde jedoch immer noch zur
zweiten eingebauten
Achse
ausgerichtet. Spezielle Rückholfedern sorgten dafür, dass sich das
Drehgestell wieder zur geraden Gleisachse ausrichten konnte.
Gegenüber der
Triebachse
wurde jedoch der Durchmesser verringert. Dieser wurde bei der
Laufachse
mit einem Wert von 850 mm angegeben. Es war ein Wert, der auch bei den
anderen Baureihen verwendet wurde. Die Laufachse lagerte, wie die benachbarte Triebachse, so im Drehge-stellrahmen, dass sie sich nicht radial einstellen konnten. Mit anderen Worten, wir haben hier einen festen Radstand von 2 420 mm erhalten.
Er konnte jedoch nicht als den Wert für die
Lokomotive
angesehen werden. Hier lag die Besonderheit, denn das hier verbaute
Laufwerk
der Baureihe Fb 2x 2/3 hatte eigentlich gar keinen festen
Radstand
erhalten.
Beide
Achsen
des
Drehgestells wurden ebenfalls einzeln
mit
Blattfedern
versehen. Diese
Bauart
hatte sich schon bei den Dampflokomotiven bewährt und alle bisher
erfolgten Versuche mit
Beim
Krauss-Helmholtz-Drehgestell
sorgte die in eine
Kurve
einlenkende
Laufachse
durch die Änderung des Winkels dafür, dass die
Triebachse
zur äusseren
Schiene
gedrückt wurde. Da dies jedoch durch den
Spurkranz
verhindert wurde, fand nur eine radiale Einstellung statt und der ganze
Kasten wurde gegen die innere Seite der Kurve gezogen. Das bewirkte nun,
dass sich auch die zweite Triebachse in den korrekten Winkel stellte.
Wenn wir mit den heute vorhandenen Kenntnissen arbeiten, kann
gesagt werden, dass auf Grund dieses Aufbaus die
Lokomotive
ohne grössere Probleme die
Zulassung
zur
Zugreihe R
geschafft hätte. Was aber in den Kurven sehr gut war, erwies sich im geraden Gleis als Nachteil. Da es keinen festen Radstand gab, fehlte es bei den Triebachsen an einer Führung im Gleis.
Mit anderen Worten, jede
Achse
konnte sich mehr oder weniger frei im
Gleis
bewegen. Das führte unweigerlich dazu, dass die
Lokomotive
ins Schlingern gerät. Die Hersteller in Deutschland hatten scheinbar
wirklich ganz grosse Angst vor den
Kurven
in der Schweiz.
Um einen Vergleich zu ermöglichen, muss auch hier ein Blick auf
den
Achsstand gemacht werden. Das erfasste Mass von 12 450 mm galt dabei
jedoch nur, wenn sich die
Lokomotive
im geraden
Gleis
befand. Jedoch haben wir mit dem bisherigen Aufbau eher einen
ungewöhnlichen Wagen erhalten. Um ein
Triebfahrzeug
zu bekommen musste ein
Antrieb
eingebaut werden. Dieser arbeitete, wie wir schon erfahren haben, auf zwei
Achsen.
Im Vergleich zu den Dampflokomotiven waren die
Triebräder für eine
Lokomotive,
die vor
Schnellzüge
gespannt werden sollte, recht klein geraten. Da aber bei den ersten
elektrischen Maschinen die verbauten Motoren eher zu schnell drehten,
musste diese Drehzahl so oder so angepasst werden. Dazu wurden spezielle
aber sehr teure
Getriebe
verwendet. Bei der hier vorgestellten
Schnellzugslokomotive
der Reihe Fb 2 x 2/3 wurde jedoch ein anderer Weg beschritten.
Um der
Antrieb
auf die
Höchstgeschwindigkeit
der
Lokomotive
abzu-stimmen, mussten die
Räder
angepasst werden. Daher dieser be-sondere Wert beim Durchmesser der
Triebräder. Nachteilig war nur, dass die
Achslager
eine hohe Drehzahl erhalten haben. Die massgebende Höchstgeschwindigkeit von 75 km/h war daher auch davon abhängig, wie stark sich die Bandagen abgenutzt hatten. Damit die gefahrenen Werte stimmten, mussten die Anzeigen angepasst werden.
Ein Punkt, der jedoch bei allen Fahrzeugen der Fall ist.
Ausge-schlossen war jedoch, dass die erlaubte Geschwindigkeit nachträglich
noch verändert werden konnte. Schneller fahren sollte nicht so leicht
möglich sein.
Auf dem Ritzel wurde zur Übertragung des
Drehmoments
ein Exzenter montiert. Diese einfache Kurbel hatte den gleichen Teilkreis
erhalten, wie er bei den
Rädern
verwendet wurde. Die
Die geschmiedete
Lediglich bei den Kurbelzapfen dieser Blindwelle wurden Lager verwendet, die über eine Nadelschmierung ver-fügten.
Wir haben damit das
Drehmoment
aber auf die Höhe der
Triebachsen
übertragen und die
Von der Blindwelle gelangte das Drehmoment auf die bei-den Triebachsen. Die dazu erforderlichen Kuppelstangen waren horizontal eingebaut worden und sie lagerten einerseits im Gussteil der Welle, als auch im Kurbelzapfen des Triebrades.
Um die
Federung
der
Achse
auszugleichen, war in der
Um die Winkeländerungen der ersten
Triebachse
im
Krauss-Helmholtz-Drehgestell
ausgleichen zu können, musste hier ein
Lager
verwendet werden, das sich in der Längsrichtung verschieben konnte. Der
Kurbelzapfen
liess zudem zu, dass sich die
Achse
seitlich bewegen konnte. Solche speziellen
Triebwerke
waren bei allen gelenkten Triebachsen erforderlich und sie kamen zuvor
schon bei Dampflokomotiven zur Anwendung.
Damit haben wir das
Drehmoment
auf die
Triebachsen
übertragen. Dieses Moment wurde nun in den
Triebrädern
mit Hilfe der
Haftreibung
zwischen der
Lauffläche
und der
Schiene,
in
Zugkraft
umgewandelt. Ein Punkt, bei dem physikalische Gesetze gelten und die nicht
überwunden werden konnten. Mit anderen Worten, die Kraft musste auf die
Schiene übertragen werden. War sie zu gross, begann sich das
Rad
schneller zu drehen.
In der
Lokomotive
wurden die Kräfte vom vorderen Teil über die
Kurzkupplung
auf den hinteren Teil des Fahrzeuges übertragen. Dort sammelten sich die
Kräfte, die zu den
Zugvorrichtungen
geführt wurden. Der Kraftfluss im Fahrzeug endete bei den Zugvorrichtungen. Über diese wurde die Zugkraft schliesslich auf die Anhängelast übertragen. Von dieser wurde jedoch eine Gegenkraft erzeugt, die durch das Gewicht und die Reibung bedingt war.
War diese Gegenkraft geringer als die erzeugte
Zugkraft,
wurde das
Triebfahrzeug
und damit auch die
Anhängelast
beschleunigt. Je grösser die Differenz, desto schneller konnte
beschleunigt werden. Um die Adhäsion zu verbessern, musste die Reibung zwischen Rad und Schiene erhöht werden. Bereits von den Dampfmaschinen her wusste man, dass dazu Quarzsand ideal geeignet war.
Deshalb wurde auch hier eine
Sandstreueinrichtung
eingebaut. Diese wirkte zwischen den beiden
Triebachsen
unmittelbar vor die
Lauffläche.
Damit war es aber bei der führenden
Achse
nicht möglich Sand zu streuen. Ein Manko, das aber in Kauf genommen wurde.
Der
Quarzsand
wurde durch die
Sandstreueinrichtung
mit Hilfe von
Druckluft
durch die Leitungen geblasen und gelangte so über die
Sander
auf die
Schiene.
Eine Lösung, die durchaus bekannt war. Bevor wir jedoch das System mit der
Druckluft genauer ansehen, müssen wir zum Schutz der verbauten Metalle
sowohl des
Laufwerkes,
als auch die anderen Baugruppen mit einem Anstrich versehen. Zudem sollte
mit Anschriften die Erkennbarkeit des Besitzers deutlich erhöht werden.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2022 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Oft
wurde der
Oft
wurde der
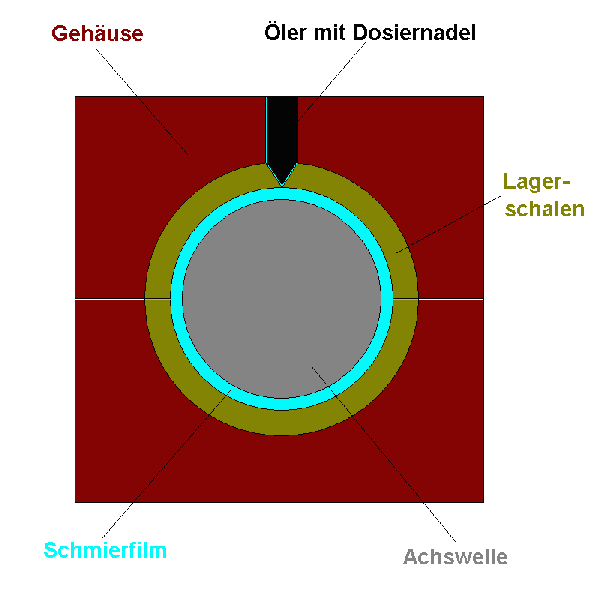 Im
Rahmen gehalten wurden die
Im
Rahmen gehalten wurden die
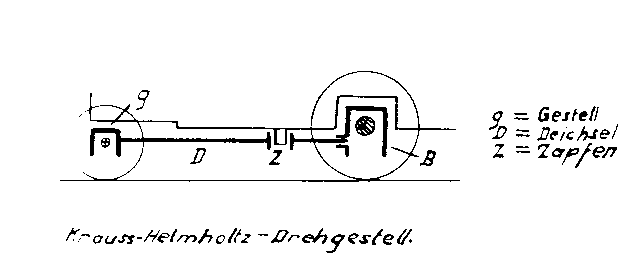 Im
gleichen
Im
gleichen
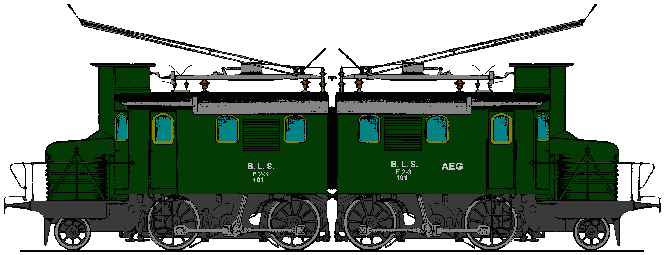 Da
dies natürlich in ähnlicher Weise auch bei der zweiten Hälfte der
Da
dies natürlich in ähnlicher Weise auch bei der zweiten Hälfte der
 Hier
wurde ein
Hier
wurde ein 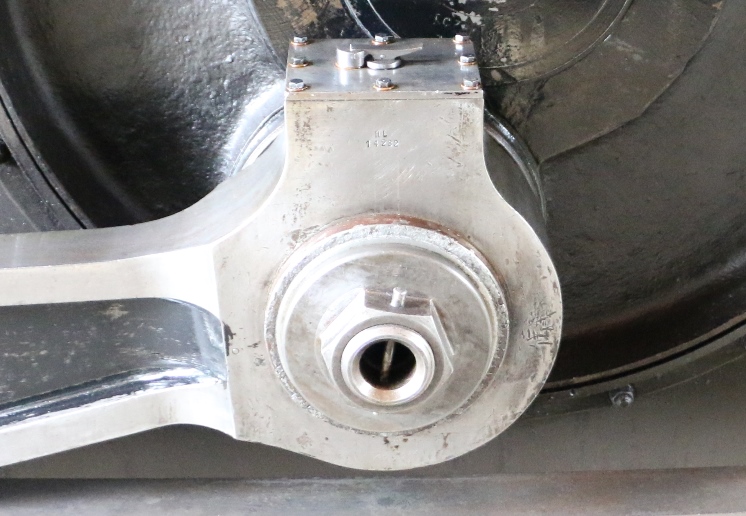 Im
Rahmen der
Im
Rahmen der
 Die
so erzeugte
Die
so erzeugte