|
Entwicklung und Beschaffung |
|||||||||||
| Navigation durch das Thema | |||||||||||
|
Das Hauptproblem war der neue
Rangierbahnhof
im Limmattal. An den anderen Orten hatte man schon
Lokomotiven
die man für die neuen Anlagen nutzen konnte. So gab es in Chiasso die
grösste Dichte an der
Baureihe
Bm 6/6, die für den schweren
Verschubdienst
gebaut wurde. Mit den beiden
Dieselmotoren
konnte ihre
Leistung
sehr gut an den Bedarf angepasst werden. Oft wurden beide Motoren nur bei
einem Rückzug benötigt.
Zwei Gleisgruppen, oberhalb vom Berg die Ein-fahrgruppe und auf der Talseite die neue Richt-ungsgruppe, die auch für die ausfahrenden Züge benötigt wurde.
Dabei konnten diese den
Ablaufberg
mit einer
Ausfahrt
unter diesem umfahren. Eine Schleife wie in Lausanne gab es nicht. Diese Ausfahrt konnte auch von den Rückzügen benutzt werden und daher war zu Beginn klar, dass elektrisch gearbeitet wurde. Nur die Ablaufzone hatte keine Fahrleitung erhalten. Das konnte man in Kauf nehmen, denn wenn ein Wagen stecken blieb, konnte auch eine kleine Diesellokomotive zur Hilfe eilen.
Schnell zeigte sich, dass diese Lösung nicht praktikabel ist, denn
die gegen den
Ablaufberg
ausfahrenden Züge behinderten den Ablaufbe-trieb.
Daher sollte der
Bahnhof
mit einer neuen
Ausfahrgruppe
auf dem Gelände der Gemeinde Dietikon ergänzt werden. In der mittigen
Richtungsgruppe
konnte so auf die durchgehende
Fahrleitung
verzichtet werden, denn die Wagen wurden mit
Förderanlagen
zu Zügen formiert. Nun war aber für den Rückzug über den Berg eine
kräftige
Diesellokomotive
erforderlich. Zumal die bereits vorhandenen Anlagen nicht umgebaut wurden.
An diese ersten Stunden im RBL erinnern auch heute noch die
wenigen
Geleise,
die mit einer durchgehenden
Fahrleitung
versehen wurden. Aus diesen kann auch die neue
Ausfahrgruppe
nicht erreicht werden. Es ist immer noch möglich diese Geleise mit Zügen
auf Seite des
Ablaufberges
zu befahren. Ein Umstand, der auch heute noch regelmässig angewendet wird,
denn es wird damit nicht der ganze Ablaufbetrieb behindert.
Ein Nachbau der bereits gut 20 Jahre alten Reihe war nicht ratsam,
denn so konnten die gemachten Erfahrungen nicht umgesetzt werden. Es
wurden also neue kräftige
Verschublokomotiven
mit sechs
Triebachsen
benötigt. Da eine neue Entwicklung mit hohen Kosten verbunden war, suchte man auch im Ausland nach geeigneten Mo-dellen. Dort waren jedoch keine passenden Maschinen zu finden, denn man arbeitete mit vierachsigen Serien.
Der in der Schweiz durchaus übliche Rückzug zur feinen Sortierung
der Wagen, wird im Ausland selten in dieser Form umgesetzt, denn die
Anlagen boten deutlich mehr Platz und so konnte der Berg umfahren werden. Bei der von den Schweizerischen Bundesbahnen SBB ver-langten Leistungsklasse waren zentrale Führerhäuser nicht üblich, denn diese waren für den Betrieb auf den nicht elektrifizierten Strecken ausgelegt worden.
Daher musste ein
Pflichtenheft
ausgearbeitet werden und dabei war auch klar, dass die Kosten gering
gehalten wer-den sollten. Für uns lohnt es sich, wenn wir einen kurzen
Blick in dieses erstellte Pflichtenheft werfen.
Verlangt wurde eine
Lokomotive
für den schwerer
Rangierdienst
an
Ablaufbergen
und für gelegentliche Hilfseinsätze bei Ausfall der
Fahrleitung.
Es waren also die gleichen Punkte aufgeführt worden, wie sie schon bei der
Baureihe
Bm 6/6 vorhanden waren, daher
konnte durchaus angenommen werden, dass die Maschinen für den Betrieb mit
Hilfswagen
vorgesehen wurden. Auch an der Anzahl der
Triebachsen
blieb man bei der alten Serie.
Für eine thermische
Lokomotive
war das ein extrem hoher Wert, denn damals konnte man noch nicht mit den
heute üblichen
Leistungen
rechnen und grosse
Dieselmotoren
benötigten noch einen entsprech-enden Platz auf dem Fahrzeug. Bei den sechs Triebachsen, die vorgesehen waren, sollte eine Achslast von 20 Tonnen nicht überschritten werden. Damit konnten die meisten Strecken befahren werden, jedoch nicht die einzige noch verbliebene ohne Fahrleitung.
Da thermische Modelle in der Regel mit halben Vorräten gewogen
wurden, kann angenommen werden, dass eine geringere
Achslast
er-wartet wurde. Wobei bei
Diesellokomotiven
das Gewicht kaum zum Problem wurde. Auf Grund dieser Angaben war eigentlich klar, dass in erster Linie eine schwere Maschine für den Verschubdienst gesucht wurde. Auch die guten Eigenschaften bei sehr langsamer Fahrt waren immer wieder aufgeführt worden. Die
höchsten
Zugkräfte
sollten auch nur in diesem Bereich erzeugt werden. Schwere ungebremste
Lasten waren im Ablaufbetrieb üblich und diese mussten von der
Lokomotive
sicher gehalten werden können.
Einige im
Pflichtenheft
aufgeführten Punkte waren aber auch allgemeiner Natur und umschrieben oft
auch die geografischen Begebenheiten. Gerade
Diesellokomotiven
arbeiteten mit zunehmender Höhe nicht mehr so gut. Bei den
Staatsbahnen
waren daher Werte vorgesehen, die bis auf 1100 Meter Höhe gelten sollten.
Erreicht wurden diese jedoch nur auf der Gotthardstrecke. Man kann hier
durchaus auch Fahrten zur Bergung annehmen.
Hier können durchaus auch die bei den starken Gefällen des Gotthards benötigten Bm 4/4 ersetzt werden.
Sie sehen, es war viel mit der neuen
Baureihe
vorge-sehen. Das es nicht so kam, war auch den Kosten geschuldet, denn
gerade in Erstfeld gab es keine Ar-beit. Speziell war, dass die Erfahrungen mit der Baureihe Be 4/4 einfliessen sollten. Diese aus einem Trieb-wagen De 4/4 entstandene Lokomotive war mit Um-richter versehen worden. Deren
Drehstrommotoren
waren gerade bei geringen Geschwindigkeiten ein grosser Vorteil. Daher war
auch klar, es sollte eine dieselelektrische Maschine geliefert werden. In
der Schweiz waren damals
Diesellokomotiven
eher elektrisch unterwegs.
Die sechsachsige
Lokomotive
sollte mit einer
Höchstgeschwindigkeit
von 80 km/h versehen werden, denn so konnte auch bei Hilfseinsätzen zügig
gefahren werden. Es war also keine reine
Rangierlokomotive
vorgesehen, auch wenn klar war, dass in erster Linie dort der Einsatz
stattfinden sollte. Auch jetzt stand die Reihe
Bm 6/6 als Muster da. Die
Typenbezeichnung wurde als Am 6/6 angenommen, und es sollten die
Betriebsnummern ab 18 521 verwendet werden.
Für den Einsatz am
Ablaufberg
im RBL sollte eine
Funkfernsteuerung
ab dem Rechner für den
Ablauf
möglich sein. Dieser konnte die Geschwindigkeit besser abstimmen, als das
mit einem Lokführer der Fall war. Man erhoffte sich damit, dass der Ablauf
schneller erledigt werden kann, denn dank optimalem Tempo musste nicht oft
angehalten werden und auch das Zurücksetzen war nicht mehr erforderlich,
weil zur rechten Zeit reagiert wurde.
Bei der neuen
Baureihe
sollte ein Wert von 85 dB (A) nicht überschritten werden. Das war gerade
bei einem zentralen
Führerhaus
nicht so leicht umsetzbar. Jedoch zeigte die Reihe
Bm 4/4, dass es möglich war.
Dieses ausgearbeitete
Pflichtenheft
wurde an die Industrie übergeben und von Beginn an war klar, dass keine
grosse Nachfrage bestand, denn die
Lokomotive
war so speziell, dass jeder Hersteller sehr viel in die Entwicklung
investieren musste. Da kaum eine grössere Serie zu erwarten war, scheuten
viele Firmen den Aufwand und reagierten gar nicht. Ein Problem, denn
eigentlich sollte ja in der Schweiz bestellt werden.
Von den eingegangenen Angeboten war auch eines von der Firma Brown
Boveri und Co BBC vorhanden. Dabei wurde jedoch nicht das Werk in Oerlikon
berücksichtigt, denn die Offerte stammte von der Niederlassung in Mannheim
und damit im nördlichen Nachbarland. Das war speziell, denn dadurch war
klar, dass auch der mechanische Teil nicht in der Schweiz erstellt werden
sollte. Die
Baureihe
war wirklich sehr speziell.
Der mechanische Teil stammte von Henschel und das war kein Zufall,
denn diese beiden Firmen hatten sich bereits vor wenigen Jahren damit
befasst, dass es mit den dieselelektrischen
Lokomotiven
auch im
Streckendienst
möglich sein sollte, gute Werte zu erreichen. Spannend dabei war, dass das
gerade in Deutschland erfolgte, wo seit Jahren als eines der wenigen
Länder mit
dieselhydraulischen Lösungen gearbeitet wurde.
Diese konnten für die neue
Rangierlokomotive
der Schweizerischen Bundesbahnen SBB genommen werden und das führte dazu,
dass bei den Konstruktion weniger Arbeit und damit geringe Kosten möglich
wurden.
Da kaum andere Angebote passten, wurde diese für die neue schwere
Lokomotive
ausgewählt. Im Jahre 1973 bestellten die Schweizerischen Bundesbahnen SBB
vorerst sechs Maschinen der
Baureihe
Am 6/6. Diese waren für den neuen
Rangierbahnhof
im Limmattal vorgesehen. Gerade dieser war auch der Grund für die
Ausschreibung
der schweren
Verschublokomotive.
Jedoch war in der Bestellung ein Punkt sehr speziell formuliert worden.
Geführt wurden diese sechs
Lokomotiven
als Prototypserie und damit war klar, dass man sich weitere Modelle
vorstellen konnte. Dass es nicht dazu kam, ist auch damit zu begründen,
dass weitere geplante
Rangierbahnhöfe
wegen der damaligen Krise nicht umgesetzt werden konnten. Besonders der in
diese Zeit fallende Preisschock bei den
Mineralölen
waren ursächlich. Wenn nicht mehr mit den Auto gefahren werden darf, kauft
man auch keine
Diesellokomotiven.
Gerade diese Ölkrise war auch ein Punkt, warum sich bei den
Schweizerischen Bundesbahnen SBB die weitere Beschaffung nicht aufdrängte.
Im Vordergrund stand nach den ersten sechs Modellen der
Baureihe
Am 6/6 der Ersatz von alten Modellen, die im
Verschub
arbeiteten. Das waren immer noch zahlreiche Maschinen der Baureihe
Ce 6/8 II und diese waren nun
wirklich mit einem recht hohen Alter im Betrieb behaftet.
Wir müssen bedenken, dass wir hier eine der ersten Serien haben,
die überhaupt gebaut wurden. Der schwere
Rangierdienst
setzte den alten Modellen schwer zu und daher mussten sie ersetzt werden.
Es war dringend, denn
Streckenlokomotiven
waren nun mal keine optimalen
Rangierlokomotiven
und die umgebauten Ce 6/8 II
kamen kaum mehr auf die Strecke, da sie zu langsam geworden waren. Mit 65
km/h konnte man wirklich kaum von schnell sprechen.
Da diese Krokodile
auf Anlagen eingesetzt wurden, wo es
Fahrleitungen
gab, stand es nicht an, eine
Diesellokomotive
zu nehmen. Daher sollte aus der Reihe Am 6/6 eine elektrische
Rangierlokomotive
abgeleitet werden und diese war nun wirklich nur für den
Verschub
vorgesehen. In der Folge war auch klar, dass eine geringere
Leistung
in Kauf genommen werden konnte. Mit der Ableitung konnten zudem die
Ersatzteile verringert werden.
Daher wurde die Industrie mit dem Bau von neuen
Lokomotiven
der
Baureihe
Ee 6/6 II beauftragt. Der Zusatz war nötig, weil die alten zwei
Prototypen
im Einsatz standen. Wenn auch nur wenige Jahre, sie waren etwas jünger als
die Krokodile und für den
schweren
Rangierdienst
gebaut worden. Aber bei einem Alter von bald 60 Jahren kann kein Nachbau
vorgenommen werden. Daher die Lösung mit dem Muster bei der Am 6/6 mit
Dieselmotor.
Wirklich neu sein sollte bei der elektrischen Lösung nur der Teil
mit der Ausrüstung zur
Fahrleitung.
Da diese nicht so viel Platz benötigte, wie der
Dieselmotor,
konnte der Aufbau verändert werden. Die
Lokomotive
sollte eleganter werden und dabei erst noch symmetrisch aufgebaut werden.
Das führte jedoch zu mehr optischen Unterschieden, als es wirklich gab. Es
war ein Nachbau der
Diesellokomotive
Am 6/6 und das war klar.
Zudem spielte es bei diesem Konzern keine so grosse Rolle in
welchem Werk gearbeitet wurde. Schon bei der
Diesellokomotive
war das klar zu erkennen und wenn es einen grossen Unterschied gab, dann
betraf das den mechanischen Teil.
Hier wurden die Arbeiten für den mechanischen Teil von der SLM
übernommen und nur die
Drehgestelle
stammten von Henschel. Es war klar, der Aufbau sollte verändert werden und
daher konnte dieser in der Schweiz erstellt werden, denn es gab keine
Probleme mit dem anderen Anbieter. Der wichtigste Teil war ja schon immer
von einer in der Schweiz ansässigen Firma geliefert worden und auch jetzt
erfolgte die Endmontage bei der BBC.
Vorerst wurden zehn
Lokomotiven
für die betriebliche Erprobung bestellt. Diese wurden als Reihe Ee 6/6 II
geführt und sie sollten die alten Modelle der
Baureihe
Ce 6/8 II ablösen.
Gleichzeitig sollte aber eine Maschine die
Diesellokomotiven
Am 6/6 im RBL unterstützen, denn nicht bei allen Aufgaben war ein
Dieselmotor
erforderlich, denn die bis zum Berg führende
Fahrleitung
konnte auch mit diesem Modell befahren werden.
Auch bei der Reihe Ee 6/6 II kam keine weitere Bestellung mehr zu
Stande. Die neuen
Rangierbahnhöfe
waren mit Maschinen besetzt worden. Ein Einsatz auf der Strecke war nun
aber für eine
Rangierlokomotive
noch seltener, als für ein Modell mit einem
Dieselmotor.
Wobei wir hier wirklich 16
Lokomotiven
haben, die sich kaum auf der Strecke zeigen sollten. Doch dazu später mehr
und wir sollten nun den Aufbau genauer ansehen.
|
|||||||||||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |||||||||
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | ||||||||
|
Copyright 2025 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||||||||||
 Mit
der neuen Anlage benötigte man
Mit
der neuen Anlage benötigte man
 Mit
der neuen
Mit
der neuen
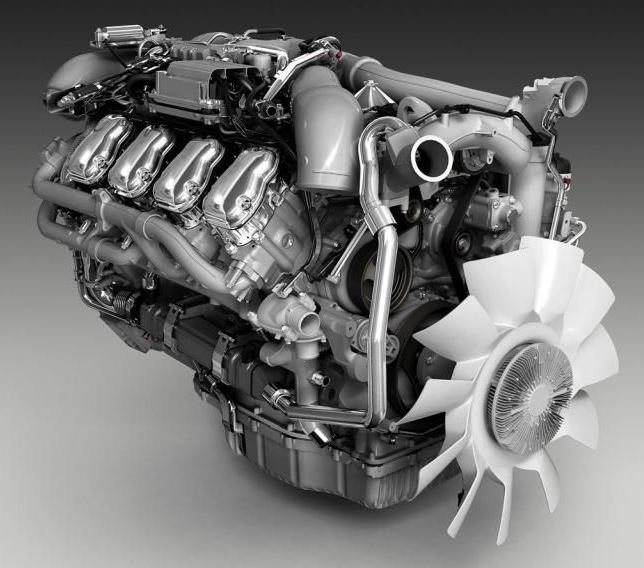 Für
den geplanten Einsatz war eine hohe
Für
den geplanten Einsatz war eine hohe  Auch
die Ausrüstung mit einer kräftigen
Auch
die Ausrüstung mit einer kräftigen
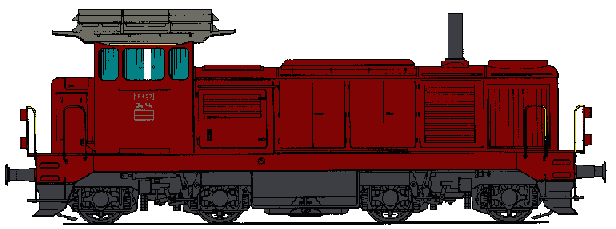 Wirklich
ein Problem bei der Entwicklung sollten die Vorgaben zum Lärm sein. Die
Schweizerischen Bundesbahnen SBB erwarteten eine ruhige
Wirklich
ein Problem bei der Entwicklung sollten die Vorgaben zum Lärm sein. Die
Schweizerischen Bundesbahnen SBB erwarteten eine ruhige
 Als
grosser Vorteil kann die vorhandene
Als
grosser Vorteil kann die vorhandene
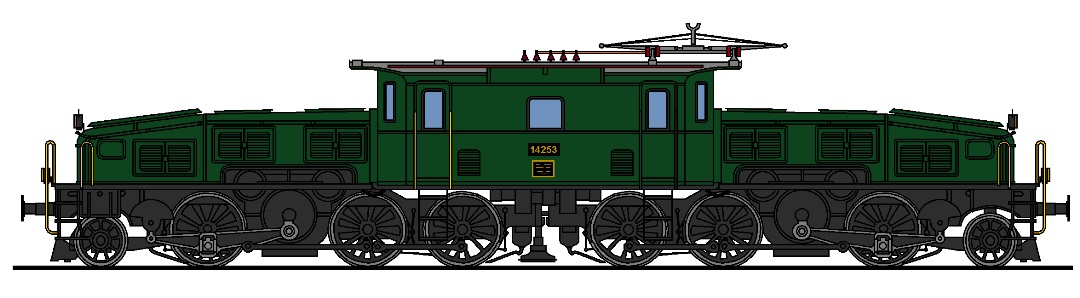
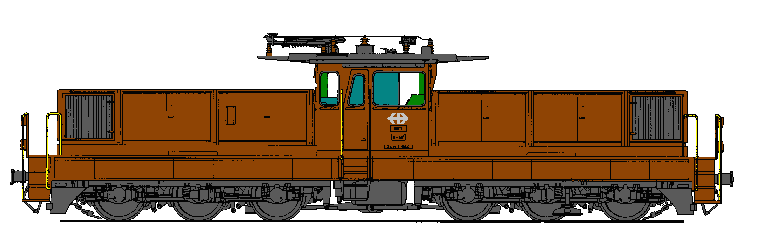 Der
Auftrag für die neue elektrische
Der
Auftrag für die neue elektrische