|
Neben- und Hilfsbetriebe |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Beginnen wir bei den Nebenbetrieben, kommen wir zu den Bereichen,
die weder direkt noch indirekt mit dem
Antrieb
zu tun hatten. Diese waren bei
Triebwagen
gegenüber den
Lokomotiven
immer etwas aufwendiger ausgeführt worden. Das lag am Aufbau und wurde
natürlich auch hier so umgesetzt. Daher lohnen sich ein paar genauere
Blicke auf diesen Bereich, der ab dem
Transformator
mit der notwenigen Energie versorgt wurde.
Am
Transformator
wurde ab der primären
Wicklung
eine
Anzapfung
für die Nebenbetriebe abgenommen. Diese hatte eine
Spannung
von 1000
Volt
erhalten und musste so aufgebaut werden, dass der Stromfluss über die
Erdung erfolgte. Daher wurden diese Anzapfungen immer an der
Primärwicklung
abgenommen. Ein Punkt der auch bei einem möglichen Einsatz unter 3000 Volt
Gleichstrom
so gelöst worden wäre.
Diese als
Zugsheizung
bezeichnete Leitung wurde mit einem Heizhüpfer geschaltet und so vom
Transformator
getrennt. Dieser
Hüpfer
sorgte dafür, dass die Leitung spannungsfrei war, wenn man die speziellen
Kupplungen
an den
Stossbalken
verbinden und trennen wollte. Die dazu benötigten Steckdosen wurden unter
dem rechten
Puffer
montiert. Jedoch verzichtete man auch hier auf das
Heizkabel,
das selten genutzt wurde.
Wurde ein solches Kabel benötigt, steckte man es in beiden
Steckdosen ein. Da diese Kabel aber beim linken
Puffer
montiert wurden, war das
Hilfsheizkabel
länger und musste an der
Kupplung
aufgehängt werden.
Soweit entsprach die
Zugsheizung
den Lösungen, wie sie bei
Lokomotiven
auch angewendet wurden. Jedoch mussten bei einem
Triebwagen
auch die Abteile für die Reisenden geheizt werden. Diese wurden daher an
der Leitung angeschlossen und zwar nach dem Heizhüpfer. So konnte auch
hier die
Heizung,
die mit den unter den Sitzen montierten
Widerständen
erfolgte, geschaltet werden. Diese Lösung war jedoch bewusst so gewählt
worden.
Der Vorteil dieser Lösung war, dass der
Triebwagen
bei einem Stilllager an einer stationären
Vorheizanlage
angeschlossen werden konnte. Damit wurden die Abteile warm, ohne dass der
Triebwagen selber betriebsbereit sein musste und über die
Zugsheizung
mit Energie versorgt wurde. Gerade der letzte Punkt war gefürchtet, so
dass kontrolliert werden musste, dass der Heizhüpfer wirklich geöffnet
war. Daher nahm man oft den Triebwagen um vorzuheizen.
Natürlich funktionierte die
Heizung
so auch, wenn der
Triebwagen
wegen einem Defekt an der Antriebseinheit abgeschleppt werden musste.
Diese Lösung war jedoch Standard und kam daher auch bei
Lokomotiven
ohne Abteilheizung zur Anwendung. Sie sehen, dass sich der Triebwagen von
der Lokomotive eigentlich nur von der Heizung der Abteile unterschied. Bei
den nun folgenden
Hilfsbetrieben
waren die Unterschiede zudem noch geringer.
Die
Hilfsbetriebe
wurden ab einer eigenen
Spule
mit
Spannung
versorgt. Durch diese Lösung konnten diese Bereiche galvanisch von der
Fahrleitung
und somit von der Hochspannung getrennt werden. Das erleichterte die
Ausführung der
Isolation.
Ein spezielles
Erdschlussrelais
überwachte diese Isolation und löste bei einem Defekt aus. So war
gesichert, dass der
Triebwagen
bei einem Defekt der Isolation schnell dem Unterhalt zugeführt wurde.
Für die
Spannung
der
Hilfsbetriebe
verwendete man eine Spannung von 220
Volt.
Dieser Wert entsprach den im Landesnetz üblichen Werten bei Gebäuden. Da
die
Frequenz
jedoch lediglich 16 2/3
Hertz
betrug, war es lediglich möglich
Widerstände
aus dem Landesnetz zu verwenden. Dazu gehörten jedoch auch die Glühbirnen,
die wegen der geringeren Frequenz nicht ganz so hell leuchteten, wie man
sich das gewohnt war.
Damit können wir zu den an den
Hilfsbetrieben
angeschlossenen Baugruppen kommen. Diese waren allesamt für den Betrieb
des Fahrzeuges wichtig, hatten jedoch nicht direkt mit dem
Antrieb
zu tun. Daher wurden diese Bereiche auch als Hilfsbetriebe bezeichnet. Ein
Ausfall einer hier angeschlossenen Baugruppe konnte daher dazu führen,
dass der
Triebwagen
nicht mehr über die volle
Leistung
verfügte. Selbst ein Ausfall war möglich.
Ein wichtiger Verbraucher war die
Ventilation.
Diese wurde mit einer eigenen
Sicherung
an den
Hilfsbetrieben
angeschlossen. Ein Ausfall in diesem Bereich führte unweigerlich dazu,
dass der
Triebwagen
nicht mehr, oder nur mir sehr geringer
Leistung
eingesetzt werden konnte. Der Grund war, dass die erforderliche
Kühlung
ausgefallen war und so nicht mehr die normalen Werte abgerufen werden
durften. Der Triebwagen musste daher abgeschleppt werden.
Die für die
Kühlung
von
Transformator
und der
Fahrmotoren
benötigte Luft wurde im Bereich des Daches angezogen und im
Ventilator
beschleunigt. Durch diese Lösung konnte relativ saubere Luft aus dem
Aussenbereich angezogen werden. Die in den seitlichen Lüftungsgittern
eingebauten
Filtermatten
reinigten und trockneten die Luft zusätzlich. Damit wurde die
Kühlluft
optimal vorbereitet, was eine optimale Kühlung garantierte.
Einzig beim Teil eins führten die Kanäle wegen dem fehlenden
Transformator
direkt zu den im
Drehgestell
montierten
Fahrmotoren.
Gerade dieser Umstand führt dazu, dass wir uns etwas genauer damit
befassen müssen. Die Ventilation wurde so aufgebaut, dass sie bei geringen Geschwindigkeiten, wo nur geringe Leistungen benötigt wurden, mit der halben Leistung arbeitete. Damit konnte der Lärm in den Bahnhöfen reduziert werden.
Um dies zu erreichen, wurden die beiden
Ventilatoren
sowohl in Reihe, als auch parallel betrieben. Jedoch war es nicht möglich
die
Ventilation
grundlegend auszu-schalten. Dazu musste das
Lokomotivpersonal
die
Schaltautomaten
jedes Ventila-tors auslösen. Fiel der Ventilator der ersten Hälfte aus, war diese Schaltung nicht mehr möglich, so dass die Ventilation nur noch mit der vollen Leistung arbeitete. Damit konnte der Triebwagen jedoch mit der halben Leistung eingesetzt werden.
Der Grund war, dass wegen der ausgefallenen
Kühlung
die
Fahrmotoren
im Teil eins keine Arbeit leisten durften. Daher mussten diese abgetrennt
werden und der
Triebwagen
verlor die halbe
Leistung. Anders sah es jedoch beim zweiten Teil des Triebwagens aus. Da hier auch die Ölpumpe des Transformators und damit auch dessen Kühlung betroffen war, war es nicht mehr möglich mit dem Triebwagen selber zu fahren.
Bei einer Fahrt, wäre der
Transformator
beschädigt werden. Jedoch konnte noch ein
Bahnhof
erreicht werden, wo eine
Hilfslokomotive
angefordert werden muss-te. Ein Ausfall des
Triebwagens
war daher die Folge.
Auch bei den anderen Baugruppen waren die Einschränkungen gross.
Einzig die im
Führerstand
angeschlossenen
Heizungen
und die Anzeige der
Spannung
in der
Fahrleitung
konnten ohne grössere Schwierigkeiten einen Betrieb des
Triebwagens
über längere Zeit ermöglich. Natürlich war das für den Lokomotivführer
nicht besonders angenehm, da ihm gewisse Informationen fehlten. Jedoch
konnte man die Reise fortsetzen, was letztlich das Ziel war.
Schlimmer stand es um die anderen Bereiche. Fiel der Erreger für
die
elektrische
Bremse aus, konnte diese nicht mehr genutzt werden. Das gab
lediglich auf den steilen Strecken Probleme. Auf den flacheren Abschnitten
konnte die Fahrt ungehindert fortgesetzt werden. Das galt auch, wenn einer
der
Fahrmotoren
nicht mehr funktionierte, da die Erregung beim Bremsbetrieb parallel
erfolgte und so sämtliche Motoren benötigt wurden.
Damit war der Kompressor das einzige grössere Bauteil, das nicht mit einer Sicherung an den Hilfsbetrieben be-trieben wurde.
Der
Schütz
sorgte dafür, dass der Druck in den
Haupt-luftbehältern
mit Hilfe eines
Druckschwankungsschalters
im benötigten Bereich gehalten werden konnte. Damit war es auch möglich, die benötigte Druckluft über die Depotsteckdose zu erzeugen. Dazu mussten die Hilfs-betriebe an den Depotstrom angeschlossen werden. Damit funktionierte der Kompressor und erzeugte die benötigte Druckluft.
Nach der Umstellung auf den normalen Betrieb stand damit die
dringend benötigte
Druckluft
zur Verfügung. So war die Angelegenheit nicht so schweisstreibend, wie mit
der
Handluftpumpe. Abschliessen vollen wir die Hilfsbetriebe mit der Batterie-ladung. Fiel diese aus, konnte der Triebwagen noch eine zeitlang verwendet werden.
Jedoch war das nur so lange möglich, bis die
Batterien
entladen waren und das Fahrzeug wegen zu geringer
Spannung
ausgeschaltet wurde. Auch jetzt war erneut eine
Hilfslokomotive
erforderlich, denn alleine konnte sich der
Triebwagen
ohne Steuerung keinen Meter bewegen.
Um die
Batterien
zu laden, wurde ein
Umformer
eingebaut. Diese
Umformergruppe
begann zu laufen, wenn der
Triebwagen
unter
Spannung
gesetzt wurde und die
Hilfsbetriebe
mit Energie versorgt wurden. Auch hier gab es ausser der
Sicherung
mit einem
Schaltautomat
keinerlei Schaltungen. Damit war gesichert, dass die sehr wichtige
Batterie sofort nach dem Einschalten des
Hauptschalters
und somit des Fahrzeuges geladen wurde.
Diese Anschlussart für die
Batterieladung
war schon immer so gewählt worden und stellte hier keine Besonderheit dar.
Auch sonst gab es bei den
Hilfsbetrieben
keine besonderen Bereiche, die noch erwähnt werden müssen. Gerade bei den
Hilfsbetrieben versuchte man immer wieder die Anzahl der Verbraucher zu
reduzieren. Dank einheitlicher Lösungen konnten zudem die Ersatzteile
verringert werden.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2018 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Da
in der Schweiz grundsätzlich auf
Da
in der Schweiz grundsätzlich auf
 Jedoch
war es möglich die Bauteile von anderen Fahrzeugen zu verwenden, da alle
über die gleiche
Jedoch
war es möglich die Bauteile von anderen Fahrzeugen zu verwenden, da alle
über die gleiche
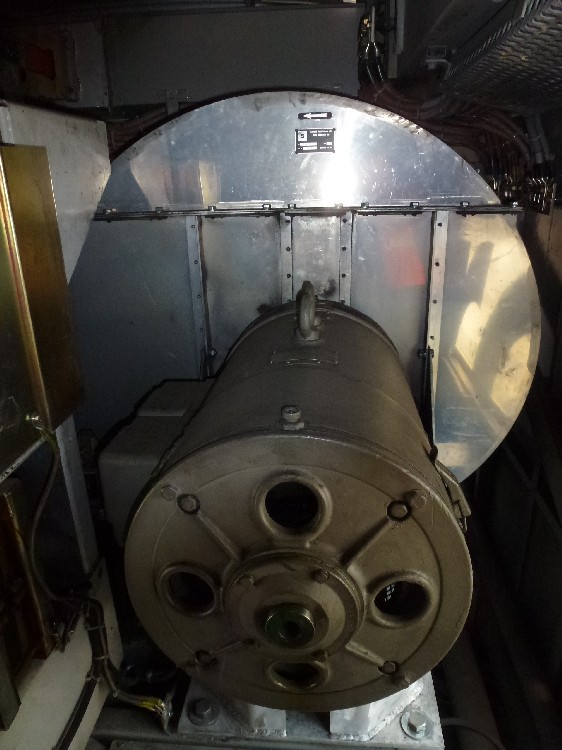 Danach
wurde die
Danach
wurde die
 Zu
einem mittelfristigen Ausfall führte der
Zu
einem mittelfristigen Ausfall führte der