|
Bedienung der Lokomotive |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Die Inbetriebnahme einer
Dampflokomotive war eine aufwendige Aktion. Daher wurde im Betrieb darauf
geachtet, dass dieser Vorgang nach Möglichkeit abgekürzt werden konnte.
Zudem wurde viel Personal bei der Inbetriebnahme benötigt. Wir gehen
jedoch davon aus, dass die Maschine in den vorangehenden Kapiteln neu
gebaut wurde und nun erstmals in Betrieb genommen werden soll. Daher
beginnen wir wirklich ganz von vorne.
Das war wichtig, denn im Kessel der Baureihe C 5/6 fanden 8,4 m3 Wasser Platz.
Das entsprach ungefähr der Hälfte des Inhaltes im
Tender. So musste
man die
Lokomotive vor der ersten Inbetriebnahme mit nicht weniger als
26,4 m3 Wasser befüllen. Das entsprich in etwa einem Badebecken
von 5x3x2 Meter. Eine ansprechende Menge Wasser.
Hinzu kamen dann noch die
verhältnismässig leicht zu beladende acht Tonnen
Kohlen. Diese wurden in
den
Depots mit Hilfe von speziellen
Kränen
in das oben offene
Kohlenfach geworfen. So musste weniger Handarbeit verrichtet werden.
Trotzdem diese Kohle musste natürlich so gut wie möglich verladen werden,
da nur so die volle Menge von acht Tonnen den notwendigen Platz auf dem
Tender fand. Auch der Kran musste mehrmals drehen.
Schliesslich wurde noch etwas
Holz
in unterschiedlicher Schnittgrösse und Reisig verladen. Auch die für
die beweglichen Teile benötigten
Schmiermittel fehlten nicht. Damit diese
Packliste abgeschlossen werden kann, musste auch das benötigte Werkzeug
mitgeführt werden. Nun war eigentlich der Punkt, bei dem die
Lokomotive
gewogen wurde. Schwerer werden konnte sie nicht mehr, denn alle Behälter
waren aufgefüllt worden.
Wir haben bereits erfahren,
dass unterschiedliche Gewichte für die
Lokomotive angegeben wurden. Dabei
wurde von 125,6 bis 129,5 Tonnen gesprochen. Bei acht Tonnen
Kohlen und
insgesamt rund 26 Tonnen Wasser lesen sich solche Differenzen komisch. Das
Gewicht der Lokomotive konnte sich im Betrieb um nicht weniger als 34
Tonnen verändern. Deshalb können wir ein mittleres Gewicht von 128 Tonnen
als üblich ansehen.
In diesem Zustand wurde die
Lokomotive vom Personal der
Depots übernommen. Das teure
Lokomotivpersonal kam
erst in einigen Stunden. Im Depot gab es auch Hilfsmittel, die verwendet
werden konnten. Standen diese Einrichtungen nicht bereit, war der Weg zur
betriebsbereiten Lokomotive sehr lange. Mit unserem Glück haben wir
absolut keinen Druck im
Kessel, das Depot ist ausgefallen und eine zweite
Lokomotive, die helfend zur Seite steht, gibt es auch nicht.
Damit begann die Entwicklung
von Wärme und im
Kessel wurde das kalte Wasser bereits erhitzt. Natürlich
war davon noch nicht viel zu erkennen. Ausgebaut wurde das Feuer
schliesslich mit
Holz und
Kohlen. Abgeschlossen war der Ausbau des Feuers mit dem komplett belegten Rost. Da jedoch nur die natürliche Zirkulation vorhanden war, kam aus dem Kamin beissender Rauch. Dieser wurde entweder in einem Abzug aus dem Gebäude geführt, oder bei im Freien stehender Lokomotive das Gelände einnebelte.
Man konnte so auch keine
grosse Wärme erzeugen. Daher stieg der Druck im
Kessel nur sehr be-scheiden
an und so lange konnte man nicht viel verändern.
Mit dem gestiegenen Druck im
Kessel konnte, sobald genügend Druck vorhanden war, der
Hilfsbläser
in der
Rauchkammer aktiviert werden. Durch den in das
Kamin geblasenen Dampf
wurde der Luftzug verstärkt und das Feuer begann kräftiger zu brennen.
Erst jetzt setzte die Dampfproduktion richtig ein und der Druck im Kessel
stieg. Der Vorgang endete, wenn der Betriebsdruck des Kessels und somit
der
Lokomotive erreicht wurde.
In den
Depots und Werkstätten
konnte man eher mit diesem Schritt beginnen, denn dort wurden spezielle
Anfachlanzen verwendet. Diese konnten in den
Kamin gesteckt werden. Mit
Hilfe von
Druckluft oder Dampf von einer
Rangierlokomotive wurde der Effekt des
Hilfsbläsers simuliert. In Depots remisierte Maschinen waren mit dem
Reservefeuer auf diesem Stand gehalten. Daher konnte man dort gleich mit
dem Hilfsbläser starten.
Da bis zu diesem Zeitpunkt
mehrere Stunden vergehen konnten. Wurde das damit beauftragte Personal mit
anderen Arbeiten beschäftigt. Die Kontrolle und Nährung des Feuers
erfolgte in einem regelmässigen Rhythmus. Zu den anderen an der
Lokomotive
anstehenden Arbeiten gehörte die
Schmierung. So wurden nun die Behälter
aufgefüllt. Damit wurde die Lokomotive betriebsbereit gemacht und wartete
auf das
Lokomotivpersonal.
Dieses erschien mit den
Lampen für die
Beleuchtung. Diese gehörten nicht zur
Lokomotive und
dienten aufgesteckt als Signal, dass die Lokomotive betriebsbereit ist.
Daher kamen die Lampen mit dem
Lokomotivpersonal.
Die
Beleuchtung wurde mit, in
der Lampisterie bezogenen,
Karbidlampen erstellt. Die entsprechenden
Laternen wurden in speziellen Halterung aufgesteckt, diese befanden sich
auf beiden Seiten über den
Puffern. Vorne wurde die obere Lampe mittig vor
der
Rauchkammertüre aufgesteckt. Hinten kamen selten alle drei Lampen zur
Anwendung. Dabei wurde die obere Lampe nur über den
Wasserkasten zur
Position gebracht. Angezündet wurden die Laternen nur auf Strecken mit längeren Tunnels oder in der Nacht, wo so oder so Licht benötigt wurde. Am Tag oder bei kurzen Tunnels fuhren die Dampflokomotiven ohne Licht, jedoch mit den aufgesteckten Laternen.
Die
farbigen
Signalbilder der damaligen Zeit wurden am Tag mit mitgeführten
Tafeln dargestellt. Bei Dunkelheit waren es Vorsteckgläser, die bei jeder
Lampe in einer Halterung mitgegeben wurden. Wenn genug Druck im Kessel vorhanden war, konnte die Luftpumpe in Aktion gesetzt werden. Diese musste nun Druckluft erzeugen, so dass die pneumatischen Bremsen in Betrieb genommen werden konnten.
Damit war die
Lokomotive mit dem Fahrpersonal
besetzt, korrekt signalisiert und der Betriebsdruck war vorhanden. Noch
konnte sie jedoch nicht losfahren, denn vor jeder Fahrt musste die
korrekte Funktion der
Bremsen geprüft werden. Daher wurde mit dem Regulierbremsventil die Bremse angezogen. Diese wirkte nur auf den Tender, so dass die Anzeigen der Lokomotive nur den Druck in der Leitung anzeigen konnten. Dieser sollte jedoch dem Druck im Bremszylinder entsprechen.
Die
Kontrolle war nötig, weil die
Lokomotive im
Rangierdienst in den meisten
Fällen mit dieser
Regulierbremse abgebremst wurde. Daher war es wichtig, dass die
direkte
Bremse korrekt geprüft wurde.
Um die
automatische Bremse zu
prüfen, musste die
Hauptleitung mit Hilfe des eingebauten
Führerbremsventils
Bauart
Westinghouse W4 auf fünf
bar
gefüllt werden.
Erst jetzt konnte die Hauptleitung mit Hilfe des
Ventils abgesenkt werden.
Die angezogenen
Bremsen der
Lokomotive wurden dem Lokführer an einem
Manometer angezeigt. Damit waren die
Bremsproben abgeschlossen und die
Handbremse
durfte gelöst werden.
Erst jetzt war die
Lokomotive
wirklich einsatzbereit. Wobei vor dem Einsatz die bisher verbrauchten
Vorräte ergänzt wurden. Dazu wurden zusätzliche
Kohlen verladen und der
Wasserkasten mit frischem Wasser aufgefüllt. Dazu musste man jedoch oft
eine erste Fahrt absolvieren. Diese Fahrt nutzen wir, um die Handlungen
des
Lokomotivpersonal anzusehen, denn gefahren wurde in den meisten Fällen immer
mit einem Lokführer.
Die Positionen im
Führerstand
wurde auf der Fahrt klar bezogen. Der
Heizer
hatte die linke Seite bis
weit über die Mitte für sich. Diesen Platz benötigte er, da er ja die
Kohlen in die
Feuerbüchse werfen musste und das war praktischer, wenn er
genügend Platz hatte. Die Arbeit des Heizers war also das Feuer und die
Versorgung desselben. Da das aber nicht ständig erfolgen musste, konnte er
auf der Fahrt auch andere Aufgaben übernehmen.
Angeordnet wurden diese auf der linken und rechten
Seite des stehenden Lokführers. So konnte der Lokführer die
Bremsen mit
der Hand bedienen und diese unabhängig von der anderen Bremse regulieren.
Er war also stets bremsbereit. Dazwischen war dann das Handrad für die Steuerung vorhanden. Hinzu kam ein Regler für den Regulator, der sich in der oberen linken Ecke befand.
Das waren schon alle
Bedienelemente, die der Lokführer für seine Arbeit benötigte. Hilfsmittel,
wie den
Fahrplan, konnte er in speziellen Halterungen, die an der
Feuerbüchsrückwand montiert wurden, ablegen oder aufspannen. Der Arbeitsplatz
war daher schlicht ausgefallen.
Bei den Aufgaben des
Heizers
müssen wir nicht nähergehende Informationen ansehen. Anders beim
Lokführer, denn er war die Person, die entschied, wann und wie sich die
Lokomotive in Bewegung setzte. Dazu nahm er seinen Standplatz bei den
Bedienelementen ein. Sie haben richtig gelesen, er nahm seinen Standplatz
ein, denn die Lokomotive wurde stehend bedient. Eine Sitzgelegenheit gab
es nicht, so dass während der Arbeit gestanden wurde.
Eine Dampflokomotive konnte
man auf zwei unterschiedliche Arten bedienen. Wie das zu machen war, war
eine Sache des Aufbaus, aber auch des Personals oder der Vorgaben durch
die Leitung. So wurde nicht jede Dampflokomotive gleich bedient. Die hier
vorgestellte Variante stellt daher nur eine Möglichkeit dar. Dabei gehen
wir davon aus, dass die optimale Fahrt erreicht werden sollte und daher
eine dynamische Lösung angestrebt wurde.
Der Lokführer stellte den
Dampfzufluss ein. Dazu war der beim
Dampfdom montierte
Regulator
vorhanden. Dieser konnte bei dieser
Lokomotive nur relativ grob geöffnet
und geschlossen werden. Daher wurde der Regulator unmittelbar vor der
Fahrt geöffnet. Damit wurde mehr oder weniger Dampf dem
Kessel entnommen
und so den
Zylindern zugeführt. Noch fuhr die Lokomotive jedoch gar nicht
los, denn der Dampf gelangte nur zu den
Schiebern.
Die
Lokomotive fuhr nun langsam los und je mehr die Steuerung eingelegt wurde,
desto grösser wurde die erzeugte
Zugkraft. Eine stufenlose Verstellung der
Zugkraft war daher mit Hilfe der Steuerung möglich. Feine Veränderungen
konnten mit der Steuerung angepasst werden. Unmittelbar nach der Abfahrt wurden die an den Niederdruckzylindern ange-brachten Schlemmhahnen geöffnet. Dadurch strömte Dampf aus dem Zylinder ins Freie und zog allenfalls sich im Zylinder gebildetes Wasser aus der Dampfmaschine.
Nach
ein paar Bewegungen konnten die
Schlemmhahnen wieder geschlossen werden.
Damit konnte die volle Kraft des Dampfes ausgenutzt werden. Die
Lokomotive
fuhr nun und wurde schneller. Der Lokführer konnte nun die Steuerung laufend verstellen und so die Zugkraft erhöhen oder verringern. Je grösser die Füllung der Zylinder war, desto mehr Zugkraft konnte die Lokomotive erzeugen.
Die
Zugkraft wurde also mit der Menge des Dampfes
reguliert. Bekamen die
Zylinder mehr Druck, bewegten sie sich schneller
und die Kraft darin stieg auch an. Die
Lokomotive konnte bei guter
Bedienung sehr sanft anfahren.
Die gefahrene Geschwindigkeit
konnte der Lokführer anhand der Anzeige am
Geschwindigkeitsmesser
ablesen.
Dieser wurde mechanisch ab der unter dem
Führerhaus montierten
Triebachse
abgetrieben. Er war nicht beleuchtet und so musste das
Lokomotivpersonal immer
eine geringe Grundbeleuchtung im
Führerstand haben und etwas zu erkennen.
Natürlich galt das auch für die anderen Anzeigen im Bereich des
Lokführers.
Der mechanischen
Geschwindigkeitsmesser
der
Lokomotive funktionierte sehr genau. So wusste
der Lokführer, wie schnell er fuhr. Die Fahrdaten wurden innerhalb des
Gerätes auf einem weissen Papierstreifen aufgezeichnet. Diese
Aufzeichnungen mussten nach der Fahrt beschriftet, gefaltet und der
Obrigkeit abgegeben werden. Dort erfolgte eine Kontrolle, die jedoch nach
dem Prinzip des Zufalls erfolgte und nur selten systematisch ausgeführt
wurde.
Ausgeschaltet wurde
die
Zugkraft mit dem Schliessen des
Regulators. So wurde die Zufuhr des
Dampfes unterbrochen und die
Dampfmaschinen liefen leer mit. Die Steuerung
blieb in der Position. Verzögert wurde die Lokomotive ausschliesslich mit den pneumatischen Bremsen. Dabei wurde für eine Fahrt im Gefälle die Regulierbremse genutzt. Um den Bremsweg vor einem Signal einhalten zu können, musste jedoch die automatische Bremse benutzt werden.
Nur jetzt wirkten auch die
Bremsklötze der
Lokomotive.
Letztlich wurde so angehalten und die Lokomotive blieb stehen. Die
Steuerung konnte nun in die neutrale Stellung genommen werden. Nachdem wir die Lokomotive in Betrieb genommen haben und damit auf die Fahrt gingen, wird es Zeit, dass wir die Maschine wieder ausser Betrieb setzen. Diesen Vorgang werden wir bis zu jenem Punkt verfolgen, an dem wir die Lokomotive übernommen haben.
Das bedeutet, dass wir die Dampflokomotive nach der Fahrt dem Unterhalt
zuführen. Das konnte in einem
Depot sein, aber auch in einer grösseren
Werkstätte. Die Maschine fuhr nach Ankunft im Depot zuerst auf die Schlackengrube. Dort wurden der Aschekasten und die Rauchkammer von den Überresten des Feuers befreit. Bei der Entleerung des Aschekastens, ging meistens auch das Feuer in die Grube.
Wobei das über den
Kipprost erfolgte.
Lokomotiven, die gleich
wieder einen Einsatz hatten, behielten natürlich das Feuer an Ort und
Stelle. Dann wurde die Reinigung der
Rauchkammer jedoch ungemütlich.
Sie können sich vorstellen,
dass mit dem Öffnen der
Rauchkammertüre der Luftzug augenblicklich
eingebrochen ist. Dadurch füllte sich die
Rauchkammer mit Rauch und die
Sicht wurde schlecht. Zudem war der Rauch auch nicht gesund, denn die
enthaltenen
Gase wirkten betäubend und waren zum Teil giftig. Daher war
diese Arbeit schmutzig und natürlich beim Personal unbeliebt. Oft war es
daher die Aufgabe des
Heizers.
Diese Arbeiten benötigten natürlich Zeit, so dass ein Stilllager
oft mit etwas mehr als einer Stunde geplant wurde. So hatte man Reserven,
wenn die
Lokomotive an einer Stelle nicht gleich behandelt wurde. Da wir unsere Lokomotive jedoch dem Unterhalt zuführen, ergänzen wir eventuell die Kohlen. Meistens war jedoch noch genug vorhanden um die Lokomotive wieder anheizen zu können. Daher fuhr man nach der Reinigung mit dem noch im Kessel vorhandenen Dampf an den Abstellort.
Auch wenn das Feuer nicht mehr
vorhanden war, die heissen Metalle vermochten noch genug Wärme abzugeben,
so dass der Dampf nicht gleich zu neige ging. So erreichte die Lokomotive ihren Standplatz. In der Folge wurde die Handbremse angezogen und die Maschine so vor dem Entlaufen gesichert. Die Arbeiten waren vorerst abgeschlossen, denn nun musste das heisse Wasser im Kessel zuerst abkühlen.
Das sich von der
Lokomotive entfernende
Lokomotivpersonal nahm die
Lampen der
Dienstbeleuchtung
mit und übergab diese der Lampisterie, wo die Laternen wieder für
den nächsten Einsatz aufbereitet wurden. Erst wenn sich das Wasser genug abgekühlt hatte, konnte der Kessel mit Hilfe eines Ablasshahns entleert werden. Das erfolgte meistens, wenn das Wasser von der Temperatur her so heiss war, wie wenn Sie das heisse Wasser zu Hause öffnen.
In der
Folge war der
Kessel leer und konnte dem Unterhalt zugeführt werden. Die
Arbeiten in der
Feuerbüchse waren daher schweisstreibend, da das Metall
immer noch eine gewisse Wärme hatte.
Wir haben die Bedienung
abgeschlossen. Das Wasser wurde entlassen und die
Druckluft ist ebenfalls
nicht mehr vorhanden. Damit beginnen die Arbeiten bei der Inbetriebnahme
wieder von vorne. Wir wissen jedoch, dass das eine lange Zeit in Anspruch
nimmt. Daher wurden
Lokomotiven längere Zeit mit einem kleinen Feuer
abgestellt. Dieses Reservefeuer reichte aus, dass das Wasser heiss ist,
aber nicht so heiss, dass zu viel Druck entsteht.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2017 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
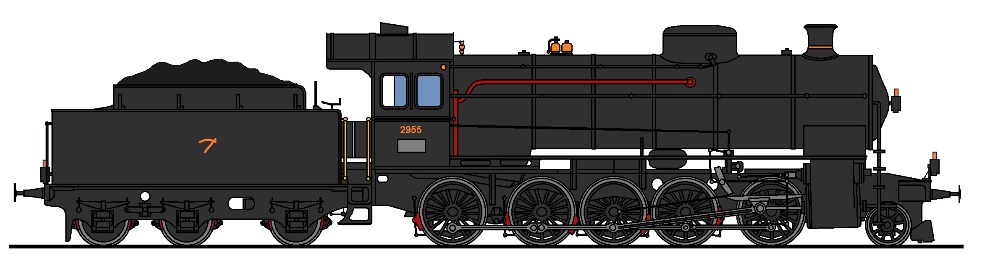 Wir gehen auch davon aus,
dass die
Wir gehen auch davon aus,
dass die  Um das Feuer in der
Um das Feuer in der
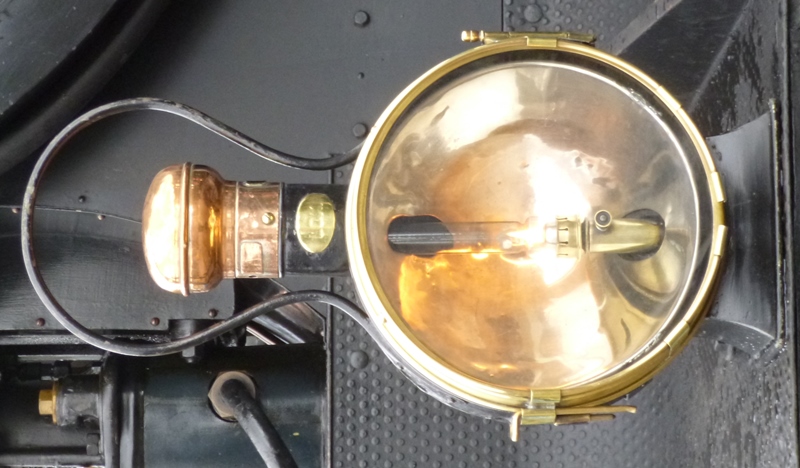 Bisher wurden die Arbeiten
vom Personal des
Bisher wurden die Arbeiten
vom Personal des  Die rechte Seite gehörte dem
Lokführer. Dort fand er seine für die Fahrt benötigten Bedienelemente vor.
Diese bestanden aus den
Die rechte Seite gehörte dem
Lokführer. Dort fand er seine für die Fahrt benötigten Bedienelemente vor.
Diese bestanden aus den  Um losfahren zu können wurde
die Steuerung aus der Mitte verschoben. Dazu begann der Lokführer am
grossen
Um losfahren zu können wurde
die Steuerung aus der Mitte verschoben. Dazu begann der Lokführer am
grossen
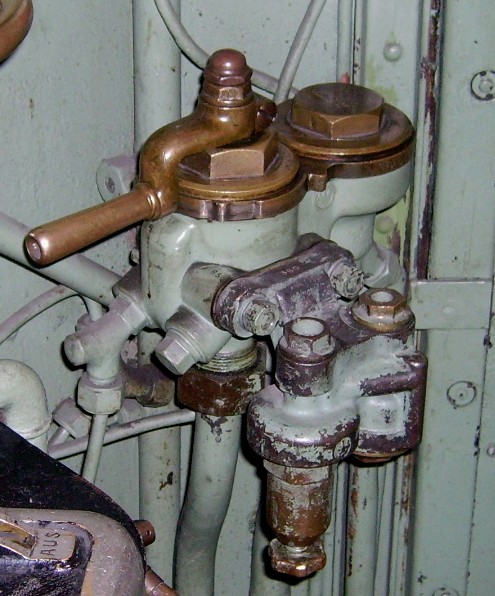 Traf man auf der Fahrt auf
ein
Traf man auf der Fahrt auf
ein
 Sofern wir die
Sofern wir die